Segeln mit Rücken- oder Gegenwind? Bei der WissKon23 – der NaWik-Konferenz für kommunizierende Forschende – sprechen unter anderem Amrei Bahr und Jens Brandenburg über Themen wie Wertschätzung und politische Unterstützung für Wissenschaftskommunikation sowie bessere Bedingungen im Job.
„Wissenschaftskommunikation ist nicht unser exzentrisches Hobby“
Stapelweise Positionspapiere zur Wissenschaftskommunikation, breite Anerkennung für kommunizierende Forschende, fieberhafte Arbeit an Outreach-Projekten: Bei ihrer Begrüßung zur WissKon 2023 am 5. Mai 2023 nennt Beatrice Lugger, Geschäftsführerin des Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation* Beispiele, die bezeugen, dass die Wissenschaftskommunikation ein Feld im Aufwind ist. Allerdings gibt es auch Gegenwind – beispielsweise in Form von Angriffen auf Wissenschaftler*innen, die in der Öffentlichkeit stehen.
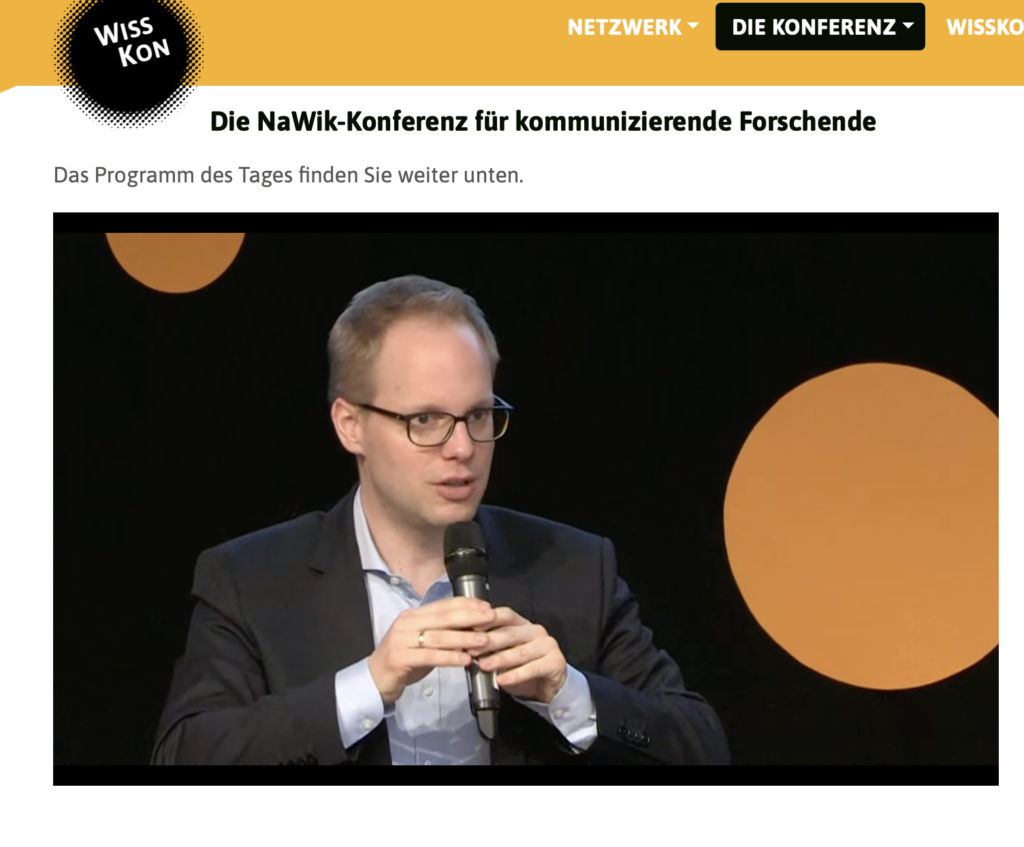
Hoffnungsschimmer und positive Entwicklungen genauso wie Herausforderungen und Dauerbaustellen werden bei der WissKon-Konferenz in Karlsruhe diskutiert, die seit 2020 kommunizierende Forschende einlädt, sich über ihren Dialog mit der Öffentlichkeit und den Medien auszutauschen. Zum ersten Mal steht die Konferenz unter einem Schwerpunktthema: Rücken- und Gegenwind für die Wissenschaftskommunikation.
Bevor am Nachmittag die Projektvorstellungs- und Workshophase beginnt, sprechen Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung, und Amrei Bahr, Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart, in ihren Keynote unterschiedliche Perspektiven auf das Feld an.
Ein viel diskutiertes Thema in der Wissenschaft die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Dieses liegt nach einem gescheiterten Entwurf im März erneut zur Überarbeitung beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Jens Brandenburg unterstreicht, dass sich das Ministerium als „Partner an Ihrer Seite“ verstehe. „Auch aus politischer Perspektive sehen wir Wissenschaftskommunikation als ein wichtiges gemeinsames Anliegen.“ Denn Wissenschaft – und ein Verständnis von Wissenschaft – seien unerlässlich, um aktuelle Herausforderungen zu bewältigen und Ziele zu erreichen, darunter Klimawandel, Digitalisierung, globale Gesundheit und Frieden zu schaffen. Was den Gegenwind betrifft, spricht Brandenburg wissenschaftsskeptische Haltungen und die Verbreitung von Fake News an – beispielsweise im Krieg Russlands gegen die Ukraine.
„Wir sind noch nicht am Ziel“

Angesichts dieser Herausforderung sei es wichtig für die Wissenschaftskommunikation, nicht in der eigenen Bubble zu verharren, sondern an gesellschaftliche Debatten anzuknüpfen. Als Anregung für eine gute Praxis bringt Brandenburg drei Thesen an: Erstens sei es wichtig, nicht nur einseitig Informationen zu vermitteln, sondern in einen Dialog zu treten. Nur durch aktives Zuhören könne es gelingen zu verstehen, welche Themen und Fragen gerade gesellschaftlich verhandelt werden. Zweitens solle der Fokus nicht nur auf der Kommunikation von Ergebnissen liegen, sondern auch das Wesen der Wissenschaft und die damit verbundenen Ambivalenzen und Unsicherheiten einbeziehen. Drittens ermutigt Brandenburg, neue Zielgruppen zu erschließen. Sicherlich seien Verschwörungstheoretiker*innen am schwersten zu erreichen, aber er appelliert auch daran, die große Gruppe derer nicht zu vergessen, die bis heute wenig Zugang zu Wissenschaft haben, aber dafür grundsätzlich empfänglich sind.
Der Staatssekretär unterstreicht das Ziel des Ministeriums, Wissenschaftskommunikation zu fördern – beispielsweise durch die Verankerung des Themas in Auswahlprozessen für Förderanträge.
Ein Konferenzteilnehmer im Publikum kommentiert, es sei toll, dass Wissenschaftskommunikation inzwischen in der Antragstellung eine Rolle spiele. Allerdings sei das für Menschen, die nicht gerade zum dem Thema forschen, zusätzlich Arbeit, die zeitlich nicht eingeplant sei. „On top zu den Sachen, die wir sowieso schon machen, machen wir Wissenschaftskommunikation.“ Natürlich müsse Wissenschaftskommunikation zeitlich eingeplant werden, erwidert Jens Brandenburg. Durch die Verankerung in den Förderkriterien seien Antragstellende dazu angehalten, sich – vielleicht erstmals – Gedanken über das Thema zu machen. Allerdings brauche es einen stärkeren Kulturwandel, der sich nicht allein durch Vorgaben des Ministeriums erreichen lasse. Ein erster Wandel sei angestoßen, resümiert Brandenburg, sagt jedoch auch: „Wir sind noch nicht am Ziel.“
Umsonst kommuniziert?
Letzteres wird auch im Vortrag von Amrei Bahr deutlich. Mitunter könnten Wissenschaftler*innen das Gefühl bekommen, sie würden umsonst kommunizieren, sagt die Juniorprofessorin. Einerseits, weil sie nicht die Wirkung erzielen, die sie sich wünschen – andererseits aber auch, weil sie nicht immer die erhoffte Anerkennung bekommen.

Ihre Forderung: mehr Wertschätzung für das, was viele „on top“ machen, zusätzlich zu den vielen anderen Aufgaben wie Forschung, Lehre, Fördermittel beantragen und administrativen Tätigkeiten. „Wissenschaftskommunikation ist nicht unser exzentrisches Hobby, sondern Arbeit“, sagt Bahr. Und für diese Arbeit brauche es angemessene Bezahlung und Perspektiven. Besonders Doktorand*innen und PostDocs stünden häufig vor der Herausforderung, mit befristeten Teilzeitverträgen viele verschiedene Aufgaben zu jonglieren und dabei hervorragend performen zu müssen, um im Wissenschaftsbetrieb zu bestehen. Wie soll da noch Zeit für Kommunikationsprojekte herkommen? Prekär sei die Jobsituation aber nicht nur in der Forschung, sondern teilweise auch in der Wissenschaftskommunikation, sagt die Juniorprofessorin. In diesem Bereich würden erfreulicherweise mehr Stellen ausgeschrieben – verwunderlich seien jedoch häufig die Bedingungen. Ein Beispiel: der Social-Media-Bereich. Oft werde angenommen: „Das machen die Digital Natives so nebenher. Aber das ist eine extrem anstrengende Arbeit.“
Selbst wenn Wissenschaftskommunikation inzwischen in Bewerbungsverfahren mehr Wertschätzung erfahre: „Sie ist immer noch weit entfernt davon, als gleichwertige Tätigkeit anerkannt zu werden“, sagt Bahr. Im Zweifelsfall zähle ein erfolgreicher Drittmittelantrag immer noch mehr als ein Radiointerview oder ein Podcast-Projekt. Junge Wissenschaftler*innen dürften demnach abgeschreckt werden, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Bahr rät ihnen, sich nicht zu stark von strategischen Erwägungen abhängig zu machen, sondern lieber das zu tun, was sie von sich aus gerne machen möchten.
Im Vortrag wird deutlich: Zeit und Geld sind ein wichtiger Aspekt, das Feedback ein anderer. Wissenschaftskommunikation stoße auch in der eigenen Fachcommunity mitunter auf Skepsis, sagt Bahr. Hinzu kommt das Risiko von Anfeindungen und Attacken in der Öffentlichkeit. „Sichtbarkeit ist Fluch und Segen zugleich“, kommentiert sie und geht unter anderem darauf ein, dass gerade weibliche Wissenschaftlerinnen häufig von Übergriffen betroffen sind, die ihnen die Sprechfähigkeit nehmen sollen. Ein Problem von Wissenschaftler*innen im Vergleich zu vielen anderen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sei ihre gute Auffindbarkeit: Ihre E-Mail-Adressen sind öffentlich einsehbar, genauso wie die Orte, an denen sie lehren oder Vorträge halten. Der Mayday-Button im WissKon-Netzwerk sei eine gute Sache, sagt Bahr, es brauche aber mehr.
Kompetenz und Hochglanzkommunikation
Die Vorträge zeigen: Die Zeit, sich unbeschwert vom Rückenwind treiben zu lassen, ist noch nicht gekommen. Die Diskussion um alles, was gut und schlecht läuft im weiten Feld der Wissenschaftskommunikation, setzt sich in einer Podiumsdiskussion fort, an der neben Bahr und Brandenburg auch Patrick Honecker, Chief Communication Officer an der TU Darmstadt, und Hanna Proner, Direktorin Science, Public, Education beim Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH in Hamburg, teilnehmen. Hanna Proner macht sich unter anderem für mehr Kompetenzaufbau stark. Schon in den ersten Semestern sollten Studierende Einblicke in die Wissenschaftskommunikation bekommen. Patrick Honecker plädiert dafür, Wissenschaftskommunikation stärker zu demokratisieren. Individuelle Wissenschaftler*innen sollten früh in die Lage versetzt werden, an ihre spezifischen Zielgruppen heranzutreten – ohne dass Pressestellen so stark als Gatekeeper fungieren wie es früher der Fall war. Trotzdem sei auch die zentrale Kommunikation von Institutionen wichtig, sagt er an einer anderen Stelle im Gespräch, an der das Thema „Hochglanzkommunikation“ und der Fokus auf wissenschaftliche Erfolge in der Kritik steht. Da Institutionen im Wettbewerb stehen, brauche es teilweise auch eine Wissenschaftskommunikation, die Reputationszwecken diene.
Statt nur die Errungenschaften der Wissenschaft in den Mittelpunkt zu stellen, ermutigt Jens Brandenburg dazu, auch Fehler zu kommunizieren. Es sei wichtig, sich auch darüber auszutauschen, was schiefgelaufen ist. Brandenburg regt an, dass Schüler*innen schon früh bei Experimenten die Erfahrung machen sollten, dass sich die eigenen Annahmen nicht immer bestätigen. Auf diese Weise könnten sie lernen, was wissenschaftliches Arbeiten ausmache. Auch Amrei Bahr unterstützt die Forderung, über die Bedingungen zu sprechen, unter den Wissenschaft entsteht – obwohl das manchmal mühseliger sei und eine große Sensibilität erfordere.
Muss jede*r kommunizieren?
*Das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation ist einer der Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de






