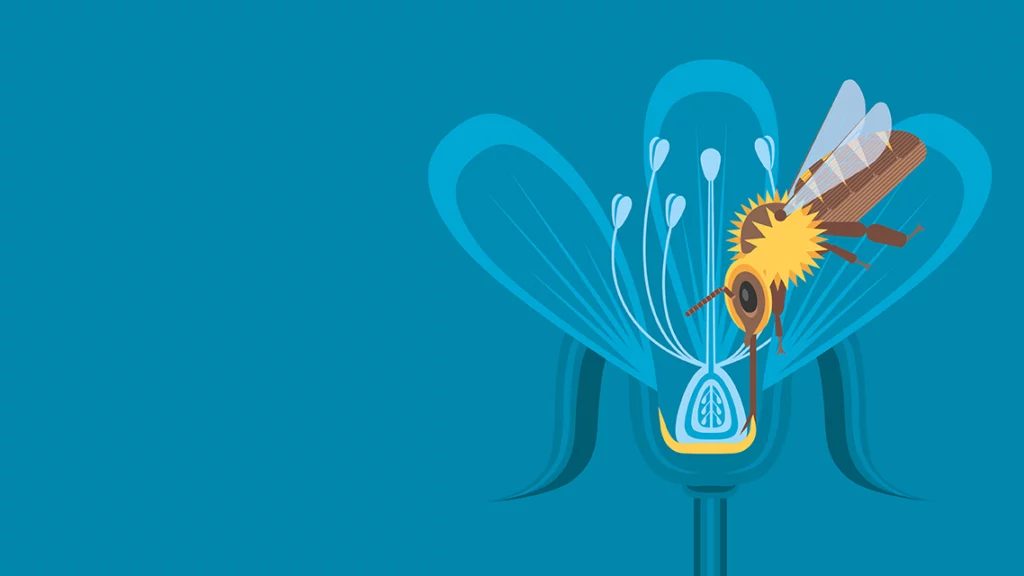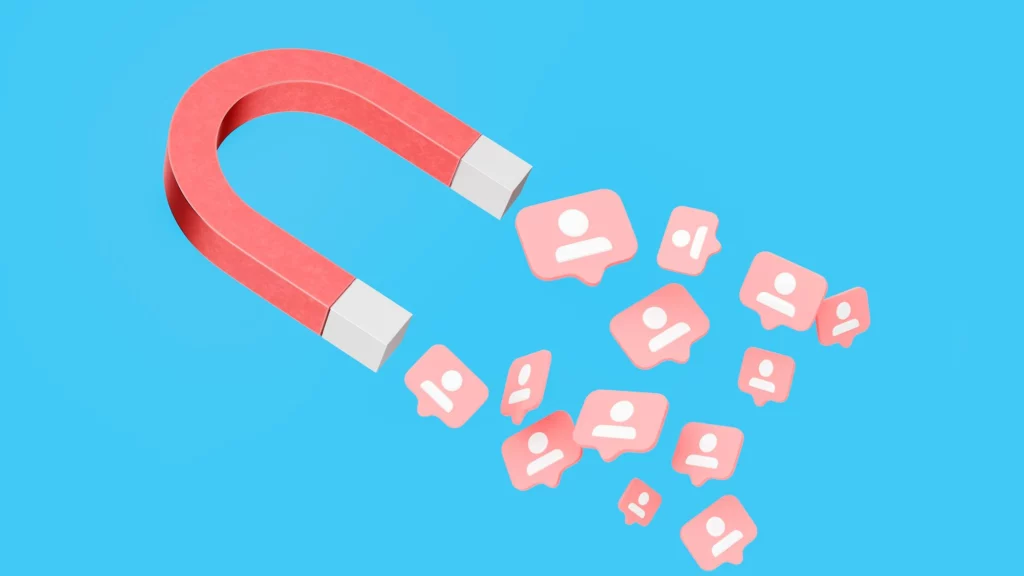Wissenschaftler sollten über ihre Forschung berichten – ehrlich und umfassend, auch wenn mal etwas schief läuft. Doch was, wenn die Reaktion offene Anfeindungen sind? Molekularbiologe Emanuel Wyler im Gespräch über die Rolle der Forschenden in der Gesellschaft, Freiräume für Wissenschaftskommunikation und die unterschiedliche Wahrnehmung der Disziplinen.
„Wissenschaftskommunikation ist eine Einstellung“
Herr Wyler, wie sehen Sie Ihre Rolle als Wissenschaftler im Bezug auf die Wissenschaftskommunikation?
Als Wissenschaftler agiert man ein bisschen als Ich-AG. Ich habe keine Verpflichtungen oder strategische Aufgaben wie die Kommunikationsabteilung einer Forschungsinstitution. Die machen ja vor allem PR, stellen Ergebnisse vor und richten sich an Wissenschaftspolitiker. Da geht es auch um Geld und es ist eine ganz zielgerichtete Kommunikation. Das muss ich als Wissenschaftler nicht machen. Werbung für mich mache ich ja in meinen Fachartikeln oder wenn ich Bewerbungen schreibe. In der Wissenschaftskommunikation kann ich dann einfach versuchen, zu berichten, was passiert. Da bin ich Reporter in eigener Sache.
Warum finden Sie es denn wichtig, dass Wissenschaftler selbst kommunizieren, wenn doch das Institut oder die Universität das bereits machen?

Ich finde, es gibt eine gewisse Verpflichtung, darüber zu berichten, was in der Wissenschaft passiert. Das sehe ich gar nicht vor dem Hintergrund der Fake News und Co., sondern eher als eine Art Bringschuld gegenüber der modernen Gesellschaft. Die Wissenschaft ist in ihr verankert und wird von ihr finanziert. Man sollte der Bevölkerung deshalb erzählen, was gut und auch was weniger gut läuft. Wenn sich also jemand in der Lage sieht, hier etwas beizutragen, dann sollte er oder sie das tun. Es ist gut, wenn die Wissenschaft mit der Gesellschaft interagiert.
Warum?
Weil es hilft, den Boden nicht zu verlieren. Da ist zum einen der utilitaristische Aspekt: Wenn man kommuniziert, kann man sich hineinfühlen in das, was die Menschen brauchen und wollen. Zweitens kann auch die Wissenschaft auf Abwege geraten. Da ist es gut, sich manchmal Feedback abzuholen. Ein dritter Aspekt sind Ängste. Es gibt zum Beispiel viele Vorbehalte und auch Vorurteile gegen Gentechnik. Da muss man genau erklären, was passiert und welche Risiken und Chancen diese Forschung birgt.
Sehen Ihre Kolleginnen und Kollegen das auch so?
Nicht alle. Im Vorfeld des Science Marches gab es eine Diskussion mit Anatol Stefanowitsch, einem Sprachwissenschaftler von der FU Berlin, der die Veranstaltung als „Wohlfühlveranstaltung für positivistische Sciencefanbois“ bezeichnet hat, weil die Wissenschaft nur unkritisch gelobt und verteidigt würde. Oder den Anstoß, den der Biologe und Kommunikator Martin Ballaschk in seinem Text „Mein ambivalentes Verhältnis zum March for Science“ gegeben hat. Daran würde ich gerne anknüpfen. Die Frage ist: Inwiefern müssen wir Werbung für die Wissenschaft machen? Wann müssen wir kritisch und wann wohlwollend aus der Wissenschaft berichten?
Wie würden Sie das beantworten?
Ich finde es wichtig, dass man als einzelner Wissenschaftler ein umfassendes und ehrliches Bild kommuniziert. Man muss auch sagen: Manches läuft falsch oder in ungünstige Richtungen. Das ist auch eine gute Reaktion auf das viel beschriebene Misstrauen in die Wissenschaft. Dem kann man mit Ehrlichkeit begegnen. Es fließt viel Geld von Pharmafirmen und Co.; es gibt Beeinflussung von außen – das muss man benennen. Wenn man dann aber kommuniziert, ist die Frage: Was ist tatsächlich relevant, wer wird damit erreicht? Es gibt einige Kollegen, die zum Beispiel kritische Blogs betreiben. Damit erreichen sie aber immer nur einen kleinen Zirkel. Für die Breitenwirkung viel wesentlicher sind die Wissensseiten und -sendungen in den Medien sowie Events wie die Lange Nacht der Wissenschaft oder Ausstellungen. Oder wenn es große Kontroversen wie in der Gentechnik gibt oder ein Politikwissenschaftler sich zu etwas äußert. Aber Blogs von Wissenschaftlern kommen in der Breite kaum an.
Was muss passieren, damit sich das ändert?
Das kann ich so pauschal nicht sagen, aber: Wissenschaftskommunikation ist mehr eine Einstellung als eine konkrete Sammlung an Formaten und technischen Mitteln. Es ist zum Beispiel die Bereitschaft, sich an Aktionen wie Langen Nächten oder Schülerlabors zu beteiligen und diese zu nutzen, um die Menschen zu erreichen. Wenn man das tut, ist man schon ziemlich weit. Kommunikation ist ja auch immer eine Reflexion der eigenen Arbeit und das kann sehr hilfreich sein. Ich finde aber nicht, dass man von Wissenschaftlern verlangen kann, die Initiative zu ergreifen. Das ist im Moment nicht zumutbar. Man müsste innerhalb des Systems zuerst Freiräume schaffen.
Wie könnten solche Freiräume geschaffen werden?
Erhebungen darüber, wie Professorinnen und Professoren ihre Zeit verbringen, zeigen in etwa: 60 Prozent Meetings, 20 Prozent Administration, 20 Prozent Wissenschaft. Wenn die Professoren ihre Zeit so verbringen, kann man nicht verlangen, dass sie auch noch bloggen. Da bleibt auch schon mal das Schreiben neuer Paper liegen, und das gehört eigentlich zum Kerngeschäft. Man muss aber auch mal die Frage stellen, ob es überhaupt wichtig ist, dass die Leute draußen im Detail verstehen, was wir machen. Ich würde das schon mit ja beantworten, aber es ist kein einfaches Ja.
Warum?
Es gibt Leute, die fasziniert sind von technischen Details und Informationen darüber. Die erreicht man dann auch mit Nischenblogs und es ist normal, dass diese Inhalte auch kompliziert sind. Und da ist es dann auch okay, wenn man nur wenige Menschen damit anspricht. Das scheint aber in der Wahrnehmung nur bei naturwissenschaftlichen Themen der Fall zu sein. Die Kultur- und Geisteswissenschaften werden ganz anders bewertet. Wenn Judith Butler komplizierte Sätze schreibt, wird ihr vorgeworfen, dass sie nicht allgemein verständlich kommuniziert. Als Philosophin und Philologin wird ihr aber unterstellt, dass ihre Themen näher an den Menschen dran sind und daher auch leicht verständlich sein sollten. Wenn ich aber kompliziert über Genregulation schreibe, dann ist das normal. Das ist doch absurd. Die Geisteswissenschaftler sollen verständlich erklären, was sie machen, und bei den Naturwissenschaften dürfen alle staunend dastehen?
Wie erklären Sie sich, dass von den Geistes- und Sozialwissenschaften erwartet wird, dass sie natürlich verständlich kommunizieren, während die Naturwissenschaften ein Faszinosum bleiben können?
Die Geistes- und Sozialwissenschaften reflektieren viel stärker, wie sie kommunizieren und wie sich ihre Erkenntnisse historisch einbetten lassen. Insofern sind manche wirklich viel näher an den Menschen und der Lebenswelt dran. Die Soziologie untersucht die Gesellschaft und man findet sich selbst als Objekt dieser Forschung wieder. Aber bei Molekularbiologie oder Genforschung sagen die Leute nicht: Huch, das ist ja mein Gen, das will ich wissen. Geisteswissenschaftler werden auch oft als public intellectuals eingeladen, um Dinge zu reflektieren, die nicht unbedingt zu ihrer Forschung gehören. Manche Leute sind deshalb auch sehr vorsichtig geworden.
Warum vorsichtig?
Weil zum Beispiel die Kollegen der Genderstudies auch öffentlich angegriffen werden. Eine Kollegin hat mal im Deutschlandfunk gesprochen und ist dann auf Twitter sehr heftig angegangen worden. Eine andere Kollegin, die zu Intimchirurgie forscht, bekommt ebenfalls regelmäßig Drohungen im Netz. So eine Aggressivität erlebe ich als Biologe nie. Als Naturwissenschaftler habe ich den Eindruck, mich auch nicht so oft erklären zu müssen. Natürlich gibt es bei uns ebenfalls polarisierende Themen wie Atomenergie, Gentechnik, Glyphosat und Tierversuche, aber viel mehr auch nicht. Manchmal wird dann noch über In-Vitro-Fleisch, also Steak aus der Petrischale, diskutiert. Das sind aber alles Themen, die mich als Molekularbiologe direkt nichts angehen.
Wie kommunizieren Sie ihre Forschung?
Ich betreibe einen Blog auf WordPress, in dem ich nicht nur über meine Forschung schreibe, sondern auch mal politische und gesellschaftliche Themen aufgreife. Außerdem beteilige ich mich an verschiedenen Kommunikationsangeboten des Max-Delbdrück-Centrums wie der Nacht der Wissenschaften oder dem Laborjournal. Ich habe aber auch schon in einem Philosophiemagazin geschrieben oder beim Café Scientifique in Berlin-Buch mitgemacht. Das ist eine Initiative in der Nachbarschaft meines Forschungsinstituts. Man könnte also sagen, ich mache Wissenschaftskommunikation immer dann, wenn es passt – meistens, wenn jemand auf mich zukommt und mich fragt, ob ich mich beteiligen möchte. Ich versuche aber auch, Projekte selbst aufzugleisen.