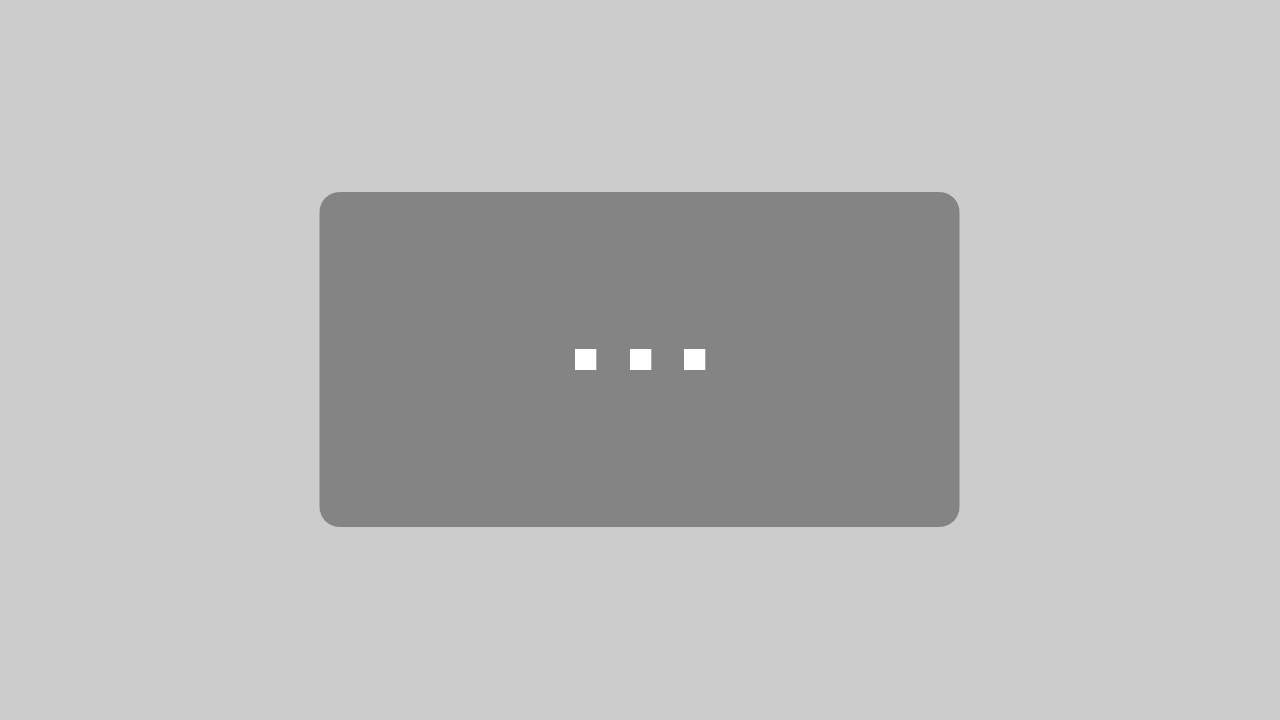Für den Physiker Ron Heeren sind Wissenschaft und Kommunikation untrennbar miteinander verbunden. Sein Credo: Jeder Wissenschaftler muss kommunizieren. Aber nicht allein, sondern im Team, seinen Talenten entsprechend und unterstützt von einer starken Kommunikationsabteilung. Ein Gespräch.
Wissenschaft und Kommunikation brauchen Teamwork
Herr Heeren, warum finden Sie es wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschung kommunizieren?
Ganz einfach: Wenn niemand weiß, was du tust, kann dich auch niemand dabei unterstützen. Deshalb geht gute Wissenschaft auch mit offener Kommunikation einher. Das kann wissenschaftliche Karrieren fördern oder beenden. Wenn niemand weiß, was du erforschst, werden deine Paper nicht zitiert, keine Interviews angefragt oder Berichte darüber geschrieben. Dann weiß niemand von den Fortschritten, die du erzielst.
Reicht es da nicht, mit seinen Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren?

Es gibt zwei Ebenen der Kommunikation. Die eine findet innerhalb der Forschungswelt statt und dreht sich um die Diskussion der Inhalte. Das ist wichtig. Aber Kommunikation nach außen ist noch wichtiger – mit der Gesellschaft, Politikern, Firmen, Medien. Wir Wissenschaftler können zum Beispiel Politiker informieren und ihnen eine Faktenbasis für ihre Entscheidungen geben oder sie erst auf Probleme aufmerksam machen, die auf politischer Ebene gelöst werden müssen. Aber nur wenn wir unsere Forschung öffentlich machen, weiß die Politik, wer ihr Partner für eine Fragestellung sein kann. Auch die Gesellschaft soll von den Ergebnissen der Forschung erfahren. Zum einen, weil für sie relevant ist, was wir herausfinden und zum anderen, weil wir öffentliche Förderung erhalten. Man tut den Menschen, die unsere Forschung finanzieren, großes Unrecht, wenn man sie nicht im Gegenzug über die Ergebnisse informiert, zum Beispiel über einen Durchbruch in der Krebsforschung. Das geht die Leute direkt etwas an und es ist für manche Menschen überlebenswichtig, dieses Wissen zu nutzen. Und nicht nur das: Forschung wird schneller und besser, wenn sie offen kommuniziert.
Inwiefern?
Wissenschaft funktioniert nur mit Kommunikation. Wenn man erst forscht und dann am Ende eine große Publikation veröffentlicht, dauert der ganze Prozess sehr lange. Wenn man jedoch schon währenddessen über seine Forschung berichtet, können andere Forschende oder auch Bürgerinnen und Bürger hier einsteigen und etwas beitragen oder selbst inspiriert werden. Der ganze Entstehungsprozess verändert sich, wird interaktiver. Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht zu früh kommuniziert und einem jemand den Durchbruch wegschnappt. Es ist mitunter schwierig zu entscheiden, wann der richtige Moment für eine Veröffentlichung ist und das wird in der wissenschaftlichen Community stark diskutiert.
Welche Kommunikationskanäle und -formate nutzen Sie an Ihrem Institut?
Man könnte eher fragen, welche wir nicht nutzen. Wir schreiben in Journals, geben Vorlesungen und nehmen an Podiumsgesprächen teil, um eine fachliche Zielgruppe zu erreichen. Um mit einer größeren Öffentlichkeit zu kommunizieren, nutzen wir Websites, Webinare, Soziale Medien oder Printmaterialien wie Flyer und Banner. Hierfür eignen sich besonders visuelle Medien, wie große Banner mit Grafiken oder Animationen. Eine Animation kann die Essenz der Forschung grafisch darstellen, oft besser als es so manche Geschichte kann. Menschen sind sehr gut darin, visuelle Reize zu verarbeiten und können sie viel besser aufnehmen als eine 20-minütige Rede. Wenn ich einen Vortrag halte, nutze ich so wenig Text wie möglich und arbeite mit wenigen, aber starken Bildern. Diese muss ich aber sehr gut auswählen und erklären, damit die Zuschauer sie nicht falsch interpretieren können, ihnen einen Rahmen geben. Der Trick ist, die Forschung zu visualisieren und ihr dabei trotzdem gerecht zu werden.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von maastrichtuniversity.bbvms.com zu laden.
Woher nehmen Sie die Grafiken und Bilder?
Da arbeiten wir mit Profis zusammen. Das können nur die wenigsten Wissenschaftler selbst. Es lohnt sich aber, hier Geld in die Hand zu nehmen. Forschungsergebnisse müssen auch gut aussehen, um zum Beispiel Schülerinnen und Schüler anzusprechen und für ein Studium zu begeistern. Das gehört auch zur Kommunikation, das Recruiting von neuen Forschergenerationen.
Werden Sie bei Ihren Kommunikationsvorhaben von der Universität unterstützt?
Ja, sehr sogar. Wir haben eine große Kommunikationsabteilung, die uns mit Maßnahmen von der Pressemitteilung bis zum Video unterstützt. Sie übernehmen Kommunikationsaufgaben oder erstellen die Medien, die wir dann wiederum bei Veranstaltungen nutzen können. Ich denke, Maastricht ist da sehr gut ausgestattet, weil es eine recht junge und innovative Universität ist, die eine verhältnismäßig große Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit hat. Es ist oft eine Frage des Personals.
Manche Wissenschaftler sagen, dass sie gar nicht die Zeit haben zu kommunizieren. Wie schaffen Sie das?
Ich habe das Glück, der Direktor dieses Instituts zu sein. So werde ich zum Beispiel oft für Interviews angefragt und muss nicht viel dafür tun. Generell muss man sich die Zeit für Kommunikation nehmen. Ich höre auch viel seltener, dass Kollegen keine Zeit haben. Viel eher sagen sie, dass sie nicht wissen wie. Ein Kollege von mir ist ein toller Physiker. Seine Forschung zu kommunizieren fällt ihm aber schwer. Ich denke, dass man Menschen zu nichts drängen sollte, mit dem sie sich nicht wohlfühlen. Aber man kann ihnen helfen. Manchmal erzählt er mir von seinen Ergebnissen und wir überlegen gemeinsam, wie man die Geschichte dazu erzählen kann. Manchmal erzähle ich seine Geschichte komplett, aber in seinem Namen. Das ist Teamwork. Das ist sowieso wichtig, weil die großen Fragen von heute nicht von einer einzigen Disziplin wie Chemie, Medizin oder Physik beantwortet werden können. Dasselbe gilt für die Kommunikation: Einer liefert den Inhalt, der nächste erzählt die Geschichte und der dritte bringt sie in die Öffentlichkeit.
Sie haben einmal einen TEDx talk gehalten, „The New Dawn of Cancer Surgery“. Wie war diese Erfahrung für Sie?
Es hat sehr viel Spaß gemacht. TEDx ist eine besondere Herausforderung, weil man nur wenig Zeit hat und ein Publikum von 1.100 Menschen einfangen muss, die sehr unterschiedlich sind. Ich habe viel gelernt, zum Beispiel, wie man Stille als rhetorisches Mittel einsetzen kann. Wenn man erst gleichmäßig spricht und dann eine Pause macht, haben die Leute Zeit, über den Satz nachzudenken und gleichzeitig gewinnt man mit dieser Pause ihre volle Aufmerksamkeit zurück. Außerdem habe ich im Vorfeld ein Feedback von professionellen Rednern bekommen, die Tipps und Tricks verraten. Generell ist es eine gute Idee, sich tolle Redner anzuschauen und zu analysieren, wie sie ihre Inhalte vermitteln.
Wem eifern Sie nach?
Mein Held ist Richard Feynman, ein Nobelpreisträger und Physiker. Er hat die beste Wissenschaftskommunikation gemacht. Schauen Sie sich mal den Film „The Last Journey of a Genious“ über ihn an. Die Art, wie er seine Forschung in Statements zusammenfassen kann, ist unerreicht. Wie er Komplexität auflöste, indem er Analogien schuf, ist toll. Schon 1985 hat er in seinen Vorlesungen vorausgesagt, wie wir heute mit Computern arbeiten werden. Und das ist auch eine Aufgabe der Wissenschaft: Den Mut aufzubringen, mit dem vorhandenen Wissen eine gut informierte Voraussage darüber zu treffen, wohin uns die Forschung bringen wird.
Welchen Tipp würden Sie Kolleginnen und Kollegen für den Start in die Wissenschaftskommunikation geben?
Ich würde mich zuerst eine halbe Stunde lang mit einer Person unterhalten, bevor ich einen Tipp gebe. Das Wichtigste ist, etwas über die Persönlichkeit herauszufinden, wie sie spricht und bei welchem Thema die Person leidenschaftlich dabei ist. Das ist dann das Thema, das sie am besten kommunizieren kann. Und dann würde ich sagen: Sprich mit deiner Oma über deine Forschung, ohne dass sie dabei einschläft. Wenn du das schaffst, hast du deine Geschichte gefunden. Und fangt so früh wie möglich damit an, auch wenn deine Idee oder These noch nicht ganz fertig ist. Sprich mit anderen Wissenschaftlern aber zum Beispiel auch Schülerinnen und Schülern. Sie stellen Fragen, die dich weiterbringen können und unterstützen dich so bei deiner Forschung.