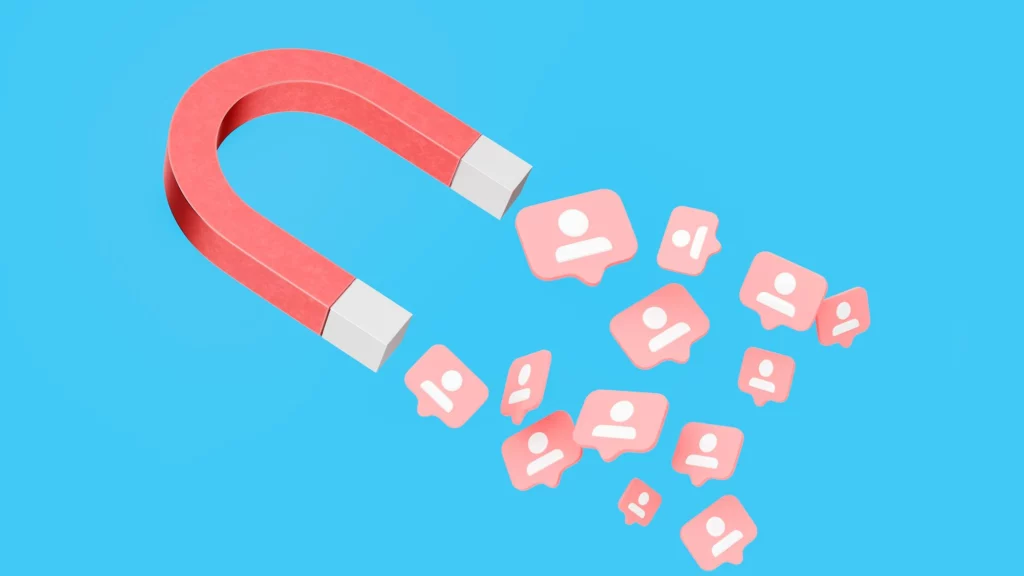Ängste, Skepsis, Vorurteile und Wissenschaftsfeindlichkeit begegnen Wissenschaftler*innen in der Pandemie immer wieder – gerade beim Thema Impfen. Die Immunbiologin Clarissa Braun und der Psychologe Philipp Schmid berichten von eigenen Erfahrungen, diskutieren über psychologische Kommunikationsstrategien und den Umgang mit Menschen, die sich von Informationen abschotten.
„Wir müssen mit Empathie und Respekt arbeiten“
Frau Braun, Sie sind Doktorandin an der Medizinischen Universität Wien und forschen im Bereich der Immunbiologie. Welche Fragen oder auch Vorbehalte gegenüber Ihrer Tätigkeit begegnen Ihnen im privaten Umfeld – und wie reagieren Sie darauf?

Clarissa Braun: Ich bin die einzige in der Familie, die studiert und unseren kleinen bayerischen Heimatort verlassen hat. Für mich war es immer eine positive Herausforderung, mit meinen Verwandten oder Menschen mit anderen beruflichen Hintergründen zu diskutieren. Diskutieren ist im konstruktiven Sinne gemeint, ohne Streiten. Vor allem seit Beginn der Pandemie ist es aber so, dass Leute viel weniger diskutieren, sondern einfach auf ihre Meinung bestehen. Mich verwundert und bestürzt dabei, dass sich Menschen in den letzten 50, 60 Jahren einfach haben impfen lassen, aber jetzt wird auf einmal gesagt: „Das ist viel zu gefährlich“ – obwohl an den Covid-19-Impfungen weitaus mehr Labore, auf der ganzen Welt und mit hoher Intensität, gearbeitet haben und sie in Studien gesundheits- und sicherheitstechnisch besser durchgecheckt wurden als andere Impfungen.
Philipp Schmid: Es gab in den 1960er-Jahren einen Psychologen, William J. McGuire, der Theorien zu Persuasion, der Kunst der Überzeugung, aufgestellt hat. Den würde die Situation mit dem Impfen heutzutage nicht wundern. Er hat beschrieben, dass gerade „Cultural Truisms“, also Binsenweisheiten, über die wir nie richtig nachdenken und zu denen wir keine Streitkultur pflegen, besonders anfällig für Falschinformationen sind. Wir haben uns einfach nie übers Impfen gestritten und kennen deshalb auch keine Argumente. Mama hat’s gemacht, Papa hat’s gemacht, also mache ich es auch. Wenn jetzt Falschinformationen auftauchen, gibt es einen Wow-Effekt: „Ich habe darüber noch nie so richtig nachgedacht. Was ist, wenn das wirklich so ist?“
Gerade bei Themen wie Impfen muss man dafür sorgen, dass Menschen ein Bewusstsein dafür haben, worüber sie sprechen. Es reicht nicht, auf soziale Normen zu setzen und zu denken: „Das haben die Leute immer gemacht, also geht es so weiter“. Das ist auch ein Argument gegen eine Impfpflicht, weil sich Menschen dann weiterhin nicht damit beschäftigen müssen, warum Impfungen sinnvoll sind.

Der extreme gefühlte Kontrollverlust und eine Umgebung aus Unsicherheit in der Pandemie sind ein perfekter Nährboden für Verschwörungstheorien. In dieser Situation greifen wir zu allen Strohhalmen, die einfache Erklärungen liefern.
Impfdiskussionen sind derzeit in Familien- und Freundeskreisen an der Tagesordnung. Wie gehen Sie als Wissenschaftlerin damit um, Frau Braun?
Braun: Ich habe das Glück, dass sich die Menschen in meinem Freundes- und Verwandtenkreis gerne selbstständig informieren und mir zuhören. Wir haben immer gute Diskussionen geführt. Ich akzeptiere es, wenn jemand eine andere Meinung hat, das gehört für mich zu einer respektvollen Diskussion dazu. Überraschend ist für mich die Erfahrung, dass sich einige Menschen sehr zurückziehen. In der ländlich geprägten Nachbarschaft meiner Eltern ist es so, dass manche Leute nicht so viel mitkriegen oder mitkriegen wollen. Nach bereits einem Jahr Pandemie wurde meine Mutter von einer Nachbarin gefragt: „Glauben Sie denn an dieses Corona?“ Es ist schwierig, einen Diskussionsansatz zu finden, wenn sich jemand komplett abschottet.
Auch im beruflichen Kontext treffe ich manchmal auf Menschen, die nicht aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen und sagen: „Es gibt keine Beweise. Die Studien existieren nicht.“ Mit so etwas tue ich mich sehr schwer. Schließlich kann man nachvollziehen, was in der Forschung passiert und man kann bei Forschungsgruppen, die diese Studien gemacht haben, an- und nachfragen. Alle klinischen Studien sind offiziell in Registern eingetragen, die Grundlagenforschungsergebnisse auf PubMed abrufbar. Trotzdem lassen sich die Leute nicht davon überzeugen. Einige meiner Arbeitskolleg*innen haben den Kontakt zu Impfgegner*innen radikal abgebrochen. Wobei ich dazu sagen muss: Das hilft in der Gesamtsituation vermutlich auch nicht weiter.
Frau Braun hat über den ländlichen Raum gesprochen. Hat der Wohnort etwas damit zu tun, wie sehr man sich zurückziehen kann? Was sagt die Forschung dazu, Herr Schmid?
Es ist immer noch so, dass viele Leute im Internet nach einem Begriff suchen und sich nur die ersten Ergebnisse angucken. Früher war es so, dass man beispielsweise bei der Kombination der Suchbegriffe „Masern, Mumps, Röteln“ und „Autismus“ unter den ersten Treffern mit Sicherheit irgendeinen Schwachsinn fand. Das hat sich verbessert, aber die Medienkompetenz muss weiter gestärkt werden, um mit diesem Wust an Informationen zurechtzukommen.
Wie gehen Menschen mit der erdrückenden Informationsflut um?
Schmid: Frau Braun hat es angedeutet: Man schaltet einfach ab. Da sind wir alle nicht gefeit vor, wenn wir täglich in den Nachrichten etwas zu steigenden Inzidenzen hören. Man blockiert dann, weil es extrem herausfordert, damit umzugehen.
Wie kommt man an Menschen heran, die dichtmachen?
Das heißt, wir müssen im Dialog bleiben. Aber auch empathische Ansätze haben Grenzen. Wenn Themen sehr belastend werden oder wenn man Hasskommentare bekommt, muss man die Diskussion nicht auf Teufel komm raus am Leben erhalten. Irgendwann muss man aus psychologischer Selbsthygiene bestimmte Diskussionen beenden.
Welche Strategien wählen Sie, Frau Braun?
Braun: Ich habe noch nicht die perfekte Lösung gefunden. Ich weiß auch nicht, ob es die gibt. Grundsätzlich versuche ich es immer auf spielerische, freundliche Art, weil ich sage: Eine Diskussion sollte Spaß machen. Es muss nicht immer alles gleich in Streit ausarten. Für uns Wissenschaftler*innen ist es normal, den ganzen Tag zu diskutieren und bei unvollständigen Lösungen auch gern immer wieder auf die Diskussion zurückzukommen.
Wenn ich jemanden treffe, der biologische Forschung generell abwertet, dann versuche ich klarzumachen: „Du kriegst es im Alltag mit. Ob es banal um deine Zimmerpflanzen oder komplexer um Krebsforschung geht, das ist alles Teil der Biologie.“ Ich verlange nicht, dass jemand seine Meinung ändert. Aber man muss zumindest diskutieren können. Wenn man davon ausgeht, dass man selbst immer die einzig richtige Meinung hat, kommt man nicht weit. Die absolut richtige Antwort wird es nie geben.
Ich kenne auch einen Professor, der sich selbst nicht impfen lassen will. Er verweigert die Impfung nicht etwa, weil sie gefährlich sei, sondern: Er wolle sich nicht zwingen lassen. Solchen Ansagen vermitteln mir den Eindruck, derjenige will nicht erwachsen werden. Außerdem kommt zusätzlich die Vorbildfunktion hinzu.
Was sagen Sie dazu, Herr Schmid?
Schmid: Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen bestimmte Anti-Impf-Argumente anbringen – und eines davon ist Reaktanz. Also genau das, was Frau Braun beschreibt: im Prinzip eine Trotzreaktion gegen bestimmte Arten der Kommunikation. Es ist natürlich eine schwache Basis für eine starke Reaktion, weil die Person im Prinzip sagt: Ich opfere meine eigene Gesundheit aus Trotz gegenüber bestimmten Botschaften. Das kommt schon kindischem Verhalten sehr nahe.
Wie kommt man aus dieser Reaktanz-Spirale heraus?
Schmid: Frau Braun hat darüber gesprochen, solche Debatten mit positiven Emotionen zu begleiten. In der Psychologie gibt es das sogenannte Motivational Interviewing, das genau diesen Ansatz fährt: Bevor ich den*die andere*n mit meinem Faktenwissen überfahre, gebe ich erst einmal die Möglichkeit, Ängste, Sorgen und Gegenargumente darzulegen. Ich stelle offene Fragen – wie zum Beispiel: „Warum möchtest du dich nicht impfen lassen?“ Wenn ich das nicht mache, reden wir möglicherweise die ganze Zeit komplett aneinander vorbei.
Wichtig ist auch, die andere Person zu bestätigen und Respekt zu zeigen. Wenn sie sagt: „Auf Facebook habe ich gelesen, dass ganz viele Kinder daran gestorben sind“, dann sag ich nicht: „Was ist das für ein Schwachsinn“, sondern: „Wenn ich das gelesen hätte, hätte ich das auch beängstigend gefunden“. Im Nachgang kann man dann ein Informationsangebot geben. Ein emotionaler Konfrontationskurs führt hingegen oft zu Reaktanz – gerade, wenn man einander nicht gut kennt.
Ist dieser empathische Kurs immer die richtige Wahl?
Schmid: Es gibt auch Situationen, in denen es Konfrontation braucht. Zum Beispiel, wenn man in einem Pressegespräch – wie bei Markus Lanz auf der Couch – nur ein paar Minuten Zeit hat, Falschinformationen zu korrigieren. Dann kann man keinen empathischen Ansatz fahren, denn einem läuft die Zeit davon. Das Ziel in solchen Debatten muss sein, das Publikum zu schützen. Dann ist es oft besser, sofort zu sagen, was an der Argumentation des Gegenübers falsch ist.
Desinformations-Methoden
Fünf gängige Tricks der Desinformation werden unter dem Akronym PLURV zusammengefasst: Pseudo-Expert*innen stehen für Personen, die zum Beispiel wegen eines akademischen Titels als Fachleute wahrgenommen werden, auf dem entsprechenden Gebiet aber keine Expertise haben. Logik-Fehler bedeutet, dass wissenschaftliche Daten falsch gedeutet werden. Unerfüllbare Erwartungen bedeutet, dass an die Wissenschaft unrealistische Ansprüche gestellt werden. Rosinenpickerei steht für die Methode, Einzelfälle herauszupicken und als Belege für bestimmte Thesen anzuführen. Verschwörungsmythen sind beispielsweise vereinfachte Erklärungen, bei denen nach Schuldigen gesucht werden. Mehr Informationen gibt es unter anderem bei klimafakten.de.
Braun: Gerade für Wissenschaftler*innen ist das sehr schwierig. Viele sind – auch bedingt durch das Arbeitspensum – eher zurückgezogen und konzentrieren sich auf ihre Forschung. Wenn sie Zeit und Mühe investieren, um in den Medien bestimmte Sachverhalte zu erklären, werden sie dann sogar mit Morddrohungen bombardiert. Ich habe den Eindruck, dass sich die Gesellschaft immer mehr in die Richtung entwickelt, dass wir keine Konflikte mehr lösen können oder wollen. Herr Schmid hat die Hintergründe dazu bereits sehr gut veranschaulicht und ich stimme ihm vollkommen zu.
Schmid: Auf bestimmte Diskussionen kann man sich vorbereiten. Wir wissen, dass Wissenschaftsleugner*innen, egal ob im Klimawandelbereich, beim Impfen oder in der Evolutionstheorie, immer wieder dieselben fünf rhetorischen Techniken anwenden: falsche Expert*innen, unmögliche Erwartungen, Rosinenpicken, falsche Logik und Verschwörungstheorien.
Nichtsdestotrotz muss man eine Debatte nicht unnötig polarisierend führen. Ich muss niemanden beleidigen oder ein Schwarz-Weiß-Denken kreieren, wie es Verschwörungstheoretiker*innen oft machen. Wir sollten nicht in die Falle tappen und sagen: Es gibt die „Aufgeklärten“ und die „Dummen“. Viel sinnvoller ist zu sagen, dass wir alle dasselbe Ziel verfolgen. Wir wollen alle nicht, dass die Todeszahlen hochgehen. In schriftlichen Texten hat man noch andere Möglichkeiten, die auch im Debunking-Handbuch beschrieben werden.
Welche Rolle spielen Wissenschaftler*innen beim Entlarven von Falschinformationen?
Braun: Mir ist es wichtig zu sagen, dass man uns immer fragen kann. Wir antworten gerne. Ich selbst habe bei Diskussionen allerdings manchmal das Problem: Ich kann Leuten, die sich nicht selbst mit Forschung beschäftigt haben, nicht innerhalb von einer Minute alle komplexen Zusammenhänge des Immunsystems erklären. Wir müssen unbedingt als Forscher*innen daran arbeiten, dass wir Dinge weniger komplex erklären können.
Gleichzeitig gibt es in der Wissenschaft immer mehr Citizen Science und andere Projekte, bei denen Menschen eingebunden werden. Wir haben auch mit Open Science eine tolle Initiative, die versucht, Wissenschaft transparent zu gestalten. Vielleicht sind die aktuellen antiwissenschaftlichen Bewegungen auch der letzte Atemzug von etwas, das überholt ist.