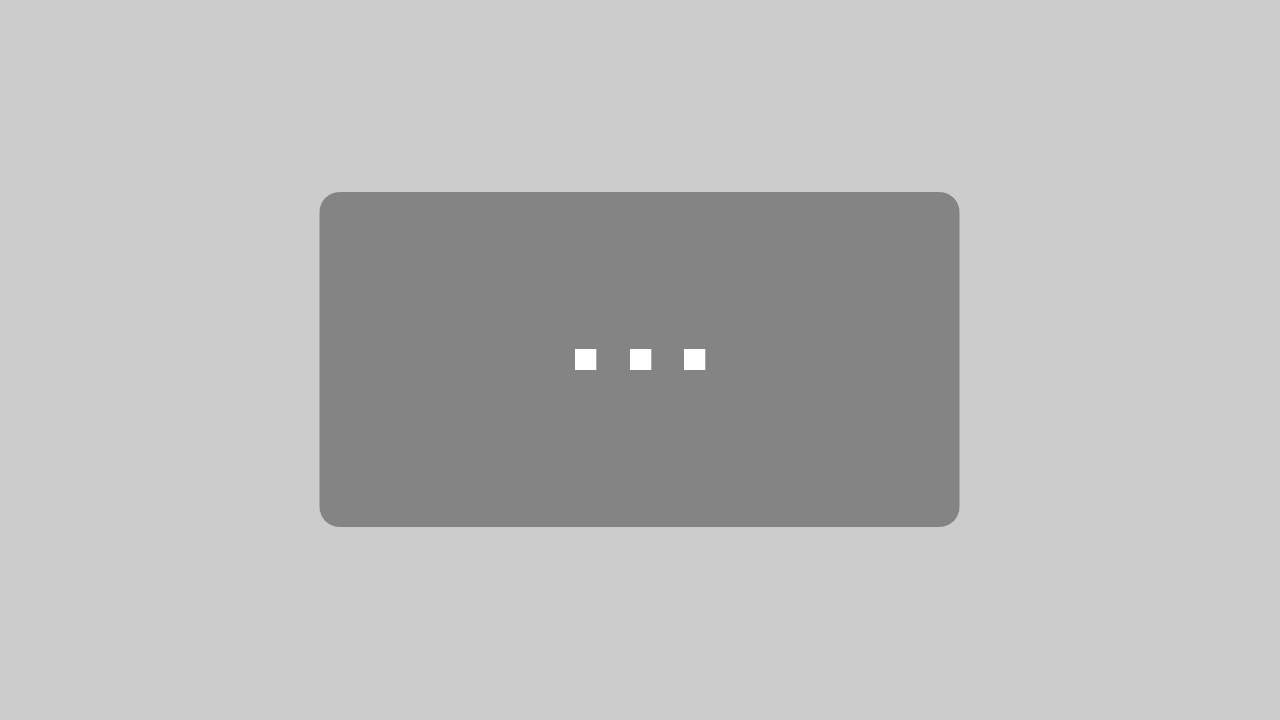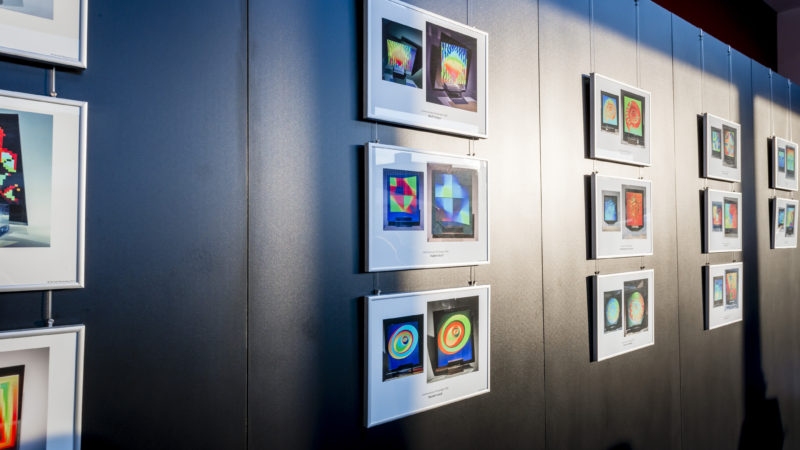Der Communicator-Preis 2019 geht an die Informatikerin Katharina Anna Zweig für ihre Kommunikation zum Thema Algorithmen und Künstliche Intelligenz. Im Interview spricht sie über durcheinandergeratene Begriffe, ihre Vorbilder in der Kommunikation und wann Forschende unbedingt selbst kommunizieren sollten.
„Wir müssen kommunizieren, um das Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken“
Frau Zweig, Sie bekommen heute den Communicator Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Stifterverbands. Was bedeutet das für Sie?
Ich bin sehr dankbar dafür, denn Wissenschaftskommunikation ist oft etwas, das nicht so sehr gesehen wird. Und gerade ein so hoch dotierter Preis hilft natürlich, auch eine Sichtbarkeit in die Wissenschaft hinein zu erzeugen.
Was motiviert Sie, sich in dem Bereich so stark zu engagieren?
Definitiv der Inhalt. Bei mir geht es um Künstliche Intelligenz und um Algorithmen des maschinellen Lernens. Wenn man sich anguckt, wie darüber in den Medien geschrieben oder überhaupt diskutiert wird, sieht man, dass viele Begrifflichkeiten durcheinandergeraten. Die wenigsten Personen besitzen eine informatische Ausbildung und haben schon einmal mit solchen Daten oder Algorithmen gearbeitet. Es ist aber fundamental wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger verstehen, was da passiert, weil sie im Alltag immer stärker damit konfrontiert werden. Daraus ergeben sich verschiedene ethische und auch praktische Fragen. Und um mitdiskutieren zu können, braucht es eben ein gewisses Verständnis der Technik dahinter.
Was ist das Besondere an der Kommunikation über Informatik?
Es geht sehr oft um Statistik und das ist ein Bereich, der wirklich schwer zu vermitteln ist. Dann kommen noch die Algorithmen dazu, die Handlungsanweisungen, nach denen Computer aus Daten Entscheidungsregeln extrahieren. Da braucht man die richtigen Analogien und Bilder, um das Thema irgendwie greifbar zu machen.

Haben Sie eine Lieblingsanalogie?
Ich erkläre zum Beispiel viel am Lernen meiner Kinder oder mit Alltagsutensilien, wie etwa einem Grillspießchen aus Holz. Den nehme ich mit in meine Vorträge, zusammen mit einem Datenblatt, auf dem rote und grüne Punkte eingezeichnet sind. Dann bitte ich die Teilnehmenden, dieses Spießchen so zu legen, dass die grünen von den roten Punkten auf dem Datenblatt getrennt sind. Das ist eine gute Analogie für eine Methode aus dem maschinellen Lernen. Damit kann man zeigen, dass eine Maschine nicht magisch herausfindet, wie hoch zum Beispiel die Rückfallquote bei Straftaten ist, sondern dass dem eine gewisse Methode und eine Datenbasis zugrunde liegen. Und dass dabei auch immer Fehler passieren.
Welche Kommunikationskanäle und -formate nutzen Sie persönlich und an Ihrem Institut?
Alle, die ich kriegen kann. Mit den Kolleginnen und Kollegen haben wir schon einen Erklärfilm gedreht, Broschüren geschrieben oder Studien für politische Stiftungen erstellt. Außerdem bin ich in der Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz“ des Deutschen Bundestages, halte wirklich viele Vorträge – etwa 100 im Jahr – und habe an Fernsehdokumentationen mitgewirkt. Dann bin ich noch auf Twitter unterwegs als @nettwerkerin. Also habe ich wirklich fast nichts ausgelassen.
Haben Sie Vorbilder für Ihre Kommunikation?
Das sind je nach Format und Kanal immer andere. Aber was die Kommunikation allgemein betrifft, haben meine Eltern schon früh darauf geachtet, dass meine Texte gut geschrieben sind. Sie sind beide Journalisten und da war es immer wichtig, dass Texte lesbar und interessant sind und einen Spannungsbogen haben. Sie haben mich in den letzten 25 Jahren bei jedem meiner deutschsprachigen Texte unterstützt. Außerdem bin ich eine begeisterte Sachbuchleserin, wenn ich mir neue Themengebiete erschließen möchte. Da lese ich dann Bücher von Dan Ariely oder Gerd Gigerenzer. Das sind im Buchbereich meine ganz konkreten Vorbilder.
Finden Sie es wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ihre Forschung selbst kommunizieren?
Das kommt darauf an. Meine Motivation war vor allem, dass der öffentliche Diskurs über mein Thema von vielen Verwirrungen geprägt ist. An der Stelle ist es die Pflicht von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Kommunikation selbst zu übernehmen – vor allem, wenn es darum geht, wie wir zu bestimmten Forschungsergebnissen gekommen sind.
Wo gibt es im Bereich des maschinellen Lernens noch Handlungsbedarf für die Wissenschaftskommunikation?
Wir sehen immer wieder, dass neue Studienergebnisse sehr stark zusammengefasst und die Hintergründe wenig bis gar nicht kommuniziert werden. Ein solcher Fall war die Nachricht, dass man mit Algorithmen depressive Menschen anhand ihrer Kommunikation in Sozialen Medien erkennen kann. Da wird in den Redaktionen schnell drübergeguckt und dann das Ergebnis aus dem Abstract veröffentlicht. Man müsste aber eigentlich erst mal fragen: Wie groß war die Studie? Wie viele Depressive haben teilgenommen? Wie wurden sie ausgewählt? Und wie viele Nichtdepressive wurden von dem Algorithmus trotzdem als angeblich depressiv eingeteilt? Das waren in dem Fall 50 Prozent und damit ist die Methode gar nicht so brauchbar, wie die Schlagzeile es suggeriert.
Wichtig ist also, dass Journalistinnen und Journalisten erst mal wissen, wo sie hingucken müssen und welche Fragen sie stellen sollten. Das ist bei politischen Themen viel klarer als bei Algorithmen. Dafür bräuchte es in den Redaktionen eine Checkliste, um Ergebnisse solide einordnen zu können. Um das Handwerkszeug dafür zu vermitteln, haben wir zum Beispiel extra eine Firma gegründet, die Workshops für Journalistinnen und Journalisten zum Thema Künstliche Intelligenz anbietet.
Haben Sie eine Botschaft, die Sie heute bei der Verleihung des Communicator-Preises an Wissenschaftskommunikation und -journalismus senden möchten?
Es gibt noch einen wichtigen Grund, aus dem wir dringend Wissenschaftskommunikation betreiben sollten: Wir arbeiten heute in der Wissenschaft bereits viel transparenter als früher. Das führt auch dazu, dass viele Fehler und Unklarheiten, die früher vielleicht unter den Tisch gefallen wären, heute offen zutage treten. Etwa Studien, die zurückgezogen werden, die sich widersprechen und so fort. In der Wissenschaft können wir das ganz gut aushalten, weil das Teil des Systems ist. Für Politik und Gesellschaft ist es aber schwierig, diese Fehler als Teil des Prozesses zu sehen und dabei nicht das Vertrauen zu verlieren. Darum müssen wir alle als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr kommunizieren, warum wir der wissenschaftlichen Methode vertrauen und sie der beste Weg ist, an Wissen zu kommen. Und insbesondere muss klar sein, dass es dabei nicht um Meinungen geht. Zu manchen Dingen kann man keine Meinung haben, sondern muss sich anhören, was erforscht wurde und wo die Ungewissheiten und Gewissheiten liegen.
Gesucht: Kommunikationsgenies aus der Wissenschaft – Interview mit Jutta Rateike von der DFG und Andrea Frank vom Stifterverband über den Preis
Leuchten, fühlen, Zähne zeigen – Rede der Preisträgerin 2018, Antje Boetius
Der „Communicator-Preis wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Stifterverband ausgeschrieben. Der persönliche Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Fachgebieten vergeben, die in herausragender Weise die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit sowie die ihres Faches in die Medien und die nicht wissenschaftliche Öffentlichkeit vermitteln.