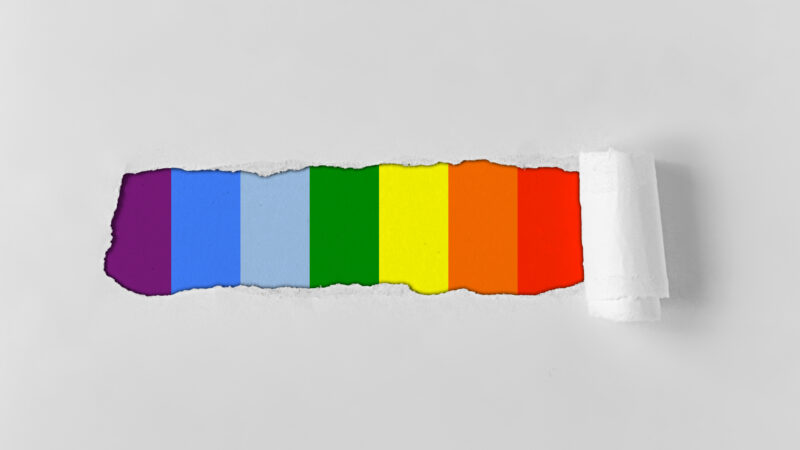Die Teilhabe an Forschung und Lehre wird für Wissenschaftler*innen mit Behinderungen durch vielfältige Barrieren erschwert. Marco Miguel Valero Sanchez gibt im Interview Einblicke in seine Forschung zur Inklusion im Wissenschaftsalltag und was für eine bessere Sichtbarkeit von Behinderungen notwendig ist.
„Wir müssen den Fokus auf bestehende Barrieren setzen”
Herr Valero Sanchez, Sie promovieren zum Thema Inklusion von Akademiker*innen mit unsichtbaren Behinderungen. Womit beschäftigen Sie sich genau?

Ich habe mir angeschaut, wie die Teilhabe von behinderten Akademiker*innen im deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystem gestaltet ist. Dafür habe ich problemzentrierte Interviews mit Akademiker*innen mit unsichtbaren Behinderungen, also Beeinträchtigungen, die man auf den ersten Blick nicht sieht, geführt. Themenschwerpunkte waren die Offenlegung von Behinderungen im Hochschulbereich und die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Behinderung, aber auch die rechtliche Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Landeshochschulgesetzen.
In meiner Dissertation war es mir wichtig, nicht über behinderte Menschen zu forschen, sondern mit ihnen. Ich habe beispielsweise meinen Interviewleitfaden im Vorfeld mit anderen behinderten Wissenschaftler*innen besprochen. Gerade in Bezug auf die Anrede muss mehr auf das gehört werden, was Betroffene und die Community sagen. Formulierungen wie „Menschen mit Handicap” oder andere Euphemismen sind abwertend und ableistisch. ‚Behinderung‘ oder ‚behindert‘ sind völlig angemessene und akzeptierte Begriffe aus der Community.
In der Hochschulforschung gibt es umfangreiche Daten zu Behinderungen von Studierenden. Sie machen allerdings in Vorträgen darauf aufmerksam, dass kaum Zahlen über Wissenschaftler*innen mit Behinderungen vorliegen. Woran liegt das?
Wissenschaftler*innen können an der Hochschule lehren, forschen und arbeiten, ohne dass in irgendeiner Weise bekannt ist, dass sie behindert sind. Es hat vielfältige Gründe, warum man das nicht sieht oder nicht mitbekommt. Oftmals befürchten Betroffene, stigmatisiert und diskriminiert zu werden, wenn sie offen über ihre Behinderungen sprechen, oder sie haben Angst vor beruflichen Nachteilen. In der Wahrnehmung der Forschungsförderung sind Wissenschaftler*innen mit unsichtbaren Behinderungen einfach nicht vorhanden.
Wie schätzen Sie die aktuelle Situation von Wissenschaftler*innen mit Behinderungen in der Forschung ein?
Grundsätzlich haben die Hochschulen mit Diversitäts- und Inklusionsbeauftragten und Schwerbehindertenvertretungen Angebote geschaffen, um die Teilhabe von behinderten Wissenschaftler*innen zu fördern. Diese Beauftragten sind auch dafür zuständig, inklusive Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu forcieren. Teilhabe und Barrierefreiheit sind Menschenrechte und diese gelten ebenso für den Hochschulbereich.
Können Sie konkrete Beispiele für diese Barrieren geben, auf die behinderte Wissenschaftler*innen im Hochschulkontext stoßen?
Es fängt schon in der baulichen Barrierefreiheit an. Oftmals gibt es keinen barrierefreien Zugang zu Hochschulgebäuden, Vorlesungssälen oder Laboren. Da mangelt es einerseits an finanziellen Mitteln, andererseits an dem Willen, bauliche Barrierefreiheit umzusetzen, obwohl es dafür klare Richtlinien gibt. Häufig ist es auch der Deckmantel des Denkmalschutzes, der vorgeschoben wird.
Zusätzlich müssen behinderte Menschen auf ihre Gesundheit achten und sich intensiv um diese kümmern. Das kollidiert aber mit dem Leistungsdruck, der in der Wissenschaft existiert. Die strikten und vielfältigen Leistungsanforderungen, wie Drittmittelgelder einwerben, Forschungsprojekte durchführen und leiten, Ergebnisse publizieren, präsentieren, kommunizieren und das möglichst international sorgen für organisatorische Barrieren. Damit sind zudem Dienstreisen verbunden, also zusätzliche Überlegungen, wie ich möglichst barrierefrei von einem Ort zu einem anderen komme.
Hinter den sozialen und kommunikativen Barrieren verbirgt sich vor allem das Netzwerken. Großveranstaltungen mit vielen sozialen Kontakten können insbesondere für neurodivergente Menschen eine Reizüberflutung darstellen. Viele Konferenzen finden zudem in einem analogen Setting statt, bei dem Essen und Alkohol eine zentrale Rolle spielen. Für Menschen mit bestimmten psychischen Erkrankungen ist das kein optimales Umfeld. Die meisten Veranstaltungen werden auch ohne Gebärdensprachdolmetscher*innen durchgeführt, wodurch Taube und hörbehinderte Wissenschaftler*innen kommunikativ ausgeschlossen werden.
Welche Maßnahmen müssen getroffen werden, um eine inklusive Umgebung für Wissenschaftler*innen mit Behinderungen zu schaffen?
Zusätzlich wäre es wichtig, eine finanzielle und berufliche Stabilität im Wissenschaftsbetrieb zu gewährleisten. Behinderte Wissenschaftler*innen sind oftmals in ein umfangreiches therapeutisches, medizinisches und soziales Netzwerk eingebunden. Es stellt einen enormen Aufwand dar, ein neues Netzwerk an einem anderen Hochschulort aufzubauen. Die Rolle von unbefristeten Arbeitsverträgen für die gesundheitliche Stabilität sollte daher nicht unterschätzt werden. Für behinderte Menschen bedeuten die aktuellen Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft eine zusätzliche Belastung.
Was kann die Wissenschaftskommunikation tun, um die Themen Inklusion und Behinderung sichtbarer zu machen?
Behinderte Menschen brauchen Möglichkeiten, um über ihre Forschung, aber auch über das Thema Behinderung in der Wissenschaft zu sprechen. Häufig wird aus einer Außenperspektive über Behinderung und damit über behinderte Menschen hinweg gesprochen. Zudem ist es wichtig, die erschwerten Teilhabemöglichkeiten, mangelnde Barrierefreiheit und ableistische Praktiken im Wissenschaftssystem zu thematisieren. Behinderte Wissenschaftler*innen dürfen kommunikativ keinesfalls als Problem oder Belastung dargestellt werden.
Die sozialen Medien dürfen auch nicht unterschätzt werden. Wir sehen bei der #IchBinHanna-/#IchBinReyhan-Bewegung, dass bereits auf verschiedene Ungleichheitsdimensionen aufmerksam gemacht wird. Das Thema Behinderung wird in der Regel aber nur von Betroffenen selbst hervorgehoben und hat sich noch nicht als eigenständiges Thema etabliert. Das kann in den sozialen Medien noch viel präsenter geschehen und sollte nicht nur die Aufgabe betroffener Wissenschaftler*innen sein. Behinderte Menschen sollten keine Stigmatisierung oder berufliche Nachteile befürchten müssen, nur weil sie offen über ableistische Strukturen und Einstellungen im Wissenschaftsbetrieb sprechen.

Wissenschaft lebt von einer vielfältigen Wissensproduktion. Wenn behinderte Menschen systematisch aus der Wissenschaft aussteigen, können sie nicht mehr zu dieser Wissensproduktion beitragen. In der Konsequenz geht der Wissenschaft eine wichtige Perspektive für Forschung und Lehre und speziell für das Thema Behinderung verloren. Meiner Meinung nach wird zu wenig geleistet, um das Potenzial und die Expertise behinderter Wissenschaftler*innen dauerhaft zu binden.