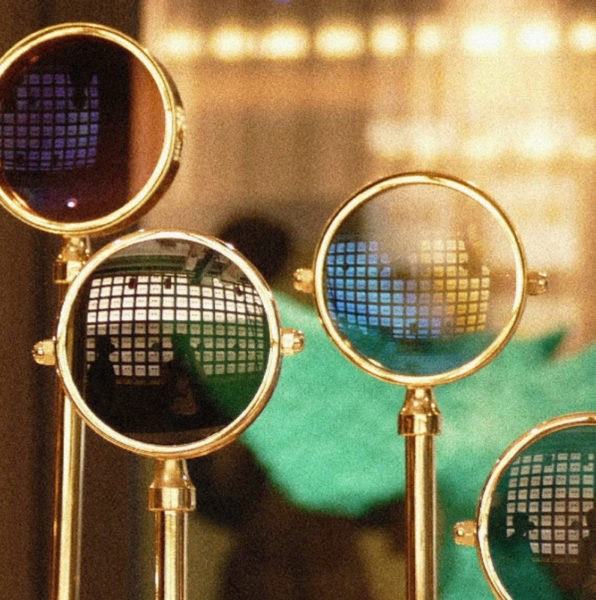Evaluation zielt häufig darauf ab, herauszufinden, ob kurzfristig eine gewünschte Wirkung erreicht wurde. Die Kommunikationswissenschaftlerin Senja Post plädiert dafür, auch die langfristigen, gesamtgesellschaftlichen Effekte von Wissenschaftskommunikation in den Blick zu nehmen. Das bedeutet: Auch unerwünschte Wirkungen sollten bedacht werden.
„Wir müssen auch unerwünschte Nebeneffekte mitdenken“
Frau Post, was bedeutet Evaluation in der Wissenschaftskommunikation für Sie?

Spontan fällt den meisten Menschen zu dem Begriff ein: Man hat ein Ziel, führt eine Maßnahme durch und dann evaluiert man, ob man das Ziel erreicht hat. Man misst also, ob die beabsichtigte Wirkung erreicht wurde. Für mich ist aber ein wesentlicher Aspekt, dass sich wissenschaftliche Evaluation auch mit Wirkungen beschäftigen muss, die man vielleicht nicht beabsichtigt hat. Wenn mein Ziel beispielsweise ist, dass Wissenschaftler mehr kommunizieren, geht es natürlich darum zu gucken: Haben die Anreize, die ich gebe, die erwünschte Wirkung? Aber es ist aus Sicht der Grundlagenforschung auch wichtig zu gucken: Was haben sie für Nebenwirkungen? Kommen die Anreize bei bestimmten Wissenschaftlern besonders gut an? Sind diese Personen als Folge meiner Bemühungen besonders häufig in der Öffentlichkeit zu sehen? Und geht dadurch vielleicht eine bestimmte Sichtweise unter?
Wie lässt sich denn Wirkung von Wissenschaftskommunikation messen?
Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Sie können zum Beispiel die Mediennutzung in Form von Befragungen erheben und dabei messen: Wer ist eigentlich mit welchen Inhalten in Kontakt gekommen? Sie können auch Experimente machen, in denen Sie prüfen: Wie wirkt eigentlich eine bestimmte Art der Kommunikation auf Menschen? Wie wirkt eine Nachricht, in der wissenschaftliche Unsicherheit benannt wird, gegenüber einer Nachricht, in der diese Unsicherheit weglassen wird? Welche Nachricht sorgt für mehr Vertrauen in die Wissenschaft? Langfristig könnten Sie zum Beispiel auch die Sichtbarkeit einer Universität in den Medien messen und parallel dazu in einer Längsschnittstudie zu mehreren Zeitpunkten Befragungen durchführen. Dann könnten Sie so etwas feststellen wie: Wenn die Universität regelmäßig in der Lokalpresse erwähnt wird, dann steigt auch der Eindruck der Menschen, dass sich die Universität für Belange der Region stark macht.
Was wäre ein Beispiel für unerwünschte Effekte von Maßnahmen?
Ein Beispiel ist die Frage, ob man zukünftig in Berufungsverfahren Wert auf Sichtbarkeit der Wissenschaftler in den Medien legen sollte. Ich finde, es spricht sehr viel dafür. Aber was hätte das für Folgen für Menschen, die auf einem Gebiet forschen, das politisch heikel ist? Sagen wir, da ist jemand, der aufgrund seiner Forschung guten Grund zur Annahme hat, dass Glyphosat ein Baustein für eine nachhaltige Gestaltung der Landwirtschaft ist. So jemand hat es sehr schwer, sich in klassischen Medien oder auf Twitter zu äußern, ohne massive persönliche Kosten in Form von Anfeindungen zu riskieren. Wenn es aber für die Karriere wichtig ist, in die Medien zu kommen, dann tue ich mir ein solches Forschungsgebiet als Postdoc unter Umständen gar nicht an. Dann würde ich vielleicht sagen: Gut, die Forschung mit Glyphosat lasse ich sein, dann forsche ich lieber zu alternativen Herbiziden oder zu Bio-Landbau, da kann ich viel besser Interviews geben oder mich auf Twitter äußern. Gerade in ideologisierten gesellschaftlichen Debatten, in denen man sich mehr wissenschaftliche Evidenz wünschen würde, können solche Anreize also nach hinten losgehen.
Wie denkt man solche Nebeneffekte von Anfang an mit?
Kann man denn von Praktiker*innen in der Wissenschaftskommunikation erwarten, unerwünschte Nebeneffekte aufdecken zu wollen, wenn sie ihren Geldgebern gegenüber Rechenschaft ablegen müssen?
Evaluation ist erst einmal eine Frage der Interessen. Ich möchte zum Beispiel, dass meine Organisation sichtbarer wird. Das ist dann mein Kriterium. Ich finde, man kann von den Organisationen nicht verlangen, dass sie sich darüber hinaus mit den gesellschaftlichen Folgen beschäftigen. Es geht um sehr komplexe sozialwissenschaftliche Sachverhalte. Wie misst man Selbstzensur von Wissenschaftlern? Das ist Sozialwissenschaft auf allerhöchstem Niveau. Solche Aspekte im Blick zu behalten, ist Aufgabe der Science of Science Communication, der Forschung zu Wissenschaftskommunikation. Ich sehe es als meine große Pflicht an, dazu beizutragen und ich glaube, das geht meinen Kollegen, die zu Wissenschaftskommunikation forschen, genauso. Das bedeutet, dass wir selbst in unserem Feld auch Wissenschaftskommunikation betreiben müssen, um Institutionen wie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu vermitteln: Wir müssen auch unerwünschte Nebeneffekte mitdenken.
Gibt es denn ausreichend unabhängige, wissenschaftliche Evaluationsprojekte in der Wissenschaftskommunikation?
Die Praxis geht durch solche Evaluationen das Risiko ein, dass unerwünschte Effekte zutage treten. Sehen Sie darin eine Problematik?
Presseabteilungen setzen auf Sichtbarkeit und passen sich deshalb tendenziell bestimmten Aufmerksamkeitsmechanismen an. Dabei kann es passieren, dass jemand aus der Science of Science Communication kommt und sagt: Auf diese Weise vermittelt ihr kein realistisches Bild von Wissenschaft. Solche Interessenkonflikte können vorkommen. Für die Forscher ist es nur wichtig zu wissen, dass sie am Ende die Freiheit haben, die Ergebnisse auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die sie für richtig halten.
Wie kann die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis gestärkt werden?
Eine Möglichkeit ist, neben der Grundlagenforschung auch bei praktischen Kommunikationsprojekten kleine Begleitforschungen einzubauen. Praktiker könnten sagen: Wir wollen, dass unsere Kommunikationsmaßnahmen evidenzbasiert durchgeführt werden. Das könnte heißen: Bevor wir uns auf ein Kommunikationskonzept festlegen, prüfen wir, wie bestimmte Darstellungen wirken. Zum Beispiel: wirkt es vertrauensbildend, wenn ich Ungewissheiten thematisiere und inwieweit geht das zulasten der Verständlichkeit meiner Botschaften? An den Ergebnissen solcher angewandter Untersuchungen könnte sich die praktische Wissenschaftskommunikation dann orientieren.Seit dem 1. Februar 2021 gendert die Redaktion auf diesem Portal mit *, schreibt dies Interviewpartner*innen und Gastautor*innen jedoch nicht zwingend vor.