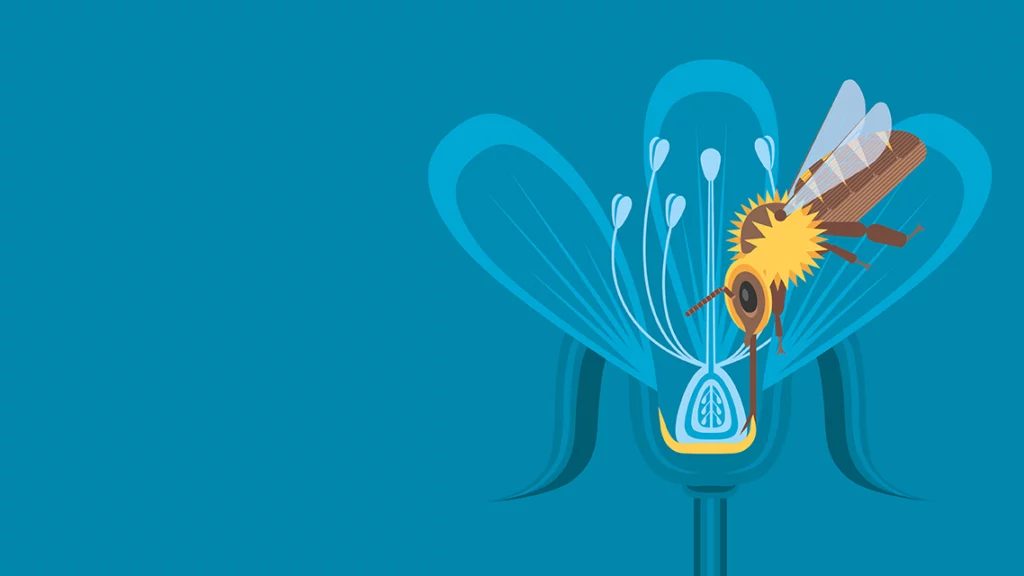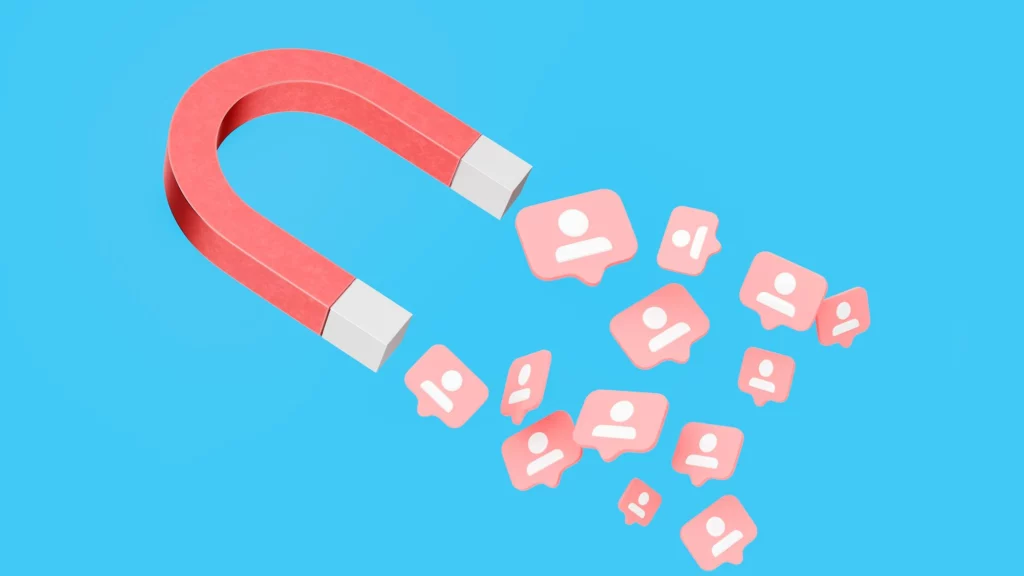Während seiner Postdoc-Zeit begann Lars Dittrich mit der Kommunikation über Tierversuche. Warum es schwierig war, dafür am Anfang überhaupt eine deutschsprachige Plattform zu finden und wieso er nun komplett in die Wissenschaftskommunikation wechselt, erzählt der Neurowissenschaftler im Interview.
„Wir brauchen mehr Menschen in der Wissenschaft, die sich klar positionieren“
Herr Dittrich, wie sind Sie zur Kommunikation gekommen?
Ich hatte von Anfang an Lust darauf, auch schon bevor ich Wissenschaftler geworden bin. In der Schule habe ich zum Beispiel gerne Theater gespielt und später als Job während des Studiums in Köln Führungen durch den Botanischen Garten gemacht. Das war super. Während meiner Promotion habe ich dann immer wieder darüber nachgedacht, was ich in dem Bereich machen kann und zum ersten Mal Aktionen wie Science Slams wahrgenommen. Mitgemacht habe ich aber nie, weil ich keine Zeit hatte, beziehungsweise nicht so richtig begründen konnte, weshalb ich die Zeit, die übrig war, nicht auch noch für die Forschung nutze.

So richtig dazu gekommen, Wissenschaftskommunikation zu machen, bin ich erst während meines zweiten Postdocs am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE). Den Ausschlag hat die Debatte um Tierversuche gegeben. Ich fand es unglaublich wichtig, mich dazu zu äußern, weil ich ein absolutes Kommunikationsvakuum wahrgenommen habe.
Wie haben Sie dann angefangen?
Als Allererstes habe ich einen Artikel zu diesem Thema aus Wissenschaftssicht geschrieben. Es war aber schwierig, überhaupt eine Plattform zu finden, auf der man so etwas veröffentlichen kann. Ich habe dann alle möglichen Homepages, die etwas mit dem Thema zu tun haben, angefragt und bin dann bei der European Animal Research Association (EARA) gelandet. Die haben eigentlich nur auf Englisch kommuniziert, aber dann zugestimmt, meinen Text auf Deutsch zu veröffentlichen, weil mir das superwichtig war.
Dann bin ich in Kontakt mit den Leuten von Pro-Test Deutschland gekommen. Ich habe begonnen, mich dort zu engagieren und Faktenchecks durchzuführen oder Blogartikel zu schreiben. Dabei kam mir entgegen, dass ich damals gependelt bin. Meine Freundin arbeitete in einer anderen Stadt und wir sind dann zusammen in die Mitte gezogen und beide von dort zur Arbeit gependelt. Eigentlich wollte ich dann immer pro Zugfahrt ein Paper lesen. Das hat aber nicht so gut geklappt und dann habe ich die Zeit für die Kommunikation für Pro-Test genutzt.
Es hat mir Spaß gemacht, Sachverhalte möglichst einfach zu formulieren, online mit Menschen zu diskutieren und natürlich das Gefühl zu haben, damit etwas zu bewegen. Das war einfach eine andere Art der Belohnung als ich sie in der Forschung erlebe und deswegen ein echter Zugewinn für mich.
Inzwischen kommunizieren Sie aber auch eigenständig. Weshalb?
Zum einen, weil ich nicht nur zu einem Thema kommunizieren wollte. Deshalb habe ich eine eigene Facebook-Seite erstellt, einen eigenen Blog gegründet und angefangen zu twittern. Zum anderen habe ich Spaß daran gefunden, neue Formate auszuprobieren, so wie beispielsweise mal beim FameLab mitzumachen oder eigene kleine Videos zu produzieren. Über Twitter bin ich dann letztes Jahr sogar bei dem amerikanischen Fernsehmoderator Bill Nye in der Wissenschaftssendung gelandet, mein bisheriges Kommunikationshighlight. Und das FameLab hat da sogar auch eine Rolle gespielt.
Wie genau ist das zustande gekommen und was haben Sie da gemacht?
Anfangs habe ich Twitter eher weniger genutzt, bin aber innerhalb der Science-Twitter-Community einigen spannenden Leuten gefolgt. Dort gab es eine Diskussion über Reichweite und wie die Wissenschaft diese besser generieren kann. Teil der Diskussion war auch, ob Leute wie Bill Nye in dieser Hinsicht nützlich oder eher schädlich sind. Einerseits machen solche Persönlichkeiten Wissenschaft populär, andererseits stecken sie natürlich nicht in allen Themen so tief drin wie aktive Forschende. So ist dann irgendwann der Hashtag #BillmeetScienceTwitter entstanden, bei dem sich Leute quasi bei Bill Nye mit ihrer Forschung vorgestellt haben. Der hat ziemlich cool darauf reagiert und einige der Leute in seine Netflix-Sendung eingeladen. Ich habe in diesem Zuge dann eine etwas kryptische und geheimnisvolle Mail bekommen, dass man bei der Recherche zu meinem Forschungsthema Schlaf auf mich gestoßen wäre und ob ich bereit sei, einmal dazu zu telefonieren. Ich dachte erst, es wäre Spam. Aber es hat sich herausgestellt, dass Bill Nyes Team auf meinen Tweet unter dem Hashtag gestoßen ist. Als sie meinen Namen gegoogelt haben, haben sie das Video von meinem Auftritt beim FameLab gesehen. Das fanden sie wohl gut. Schließlich haben sich mich zum Dreh der Sendung ins Studio in Los Angeles geflogen. Eine super Erfahrung, auf die ich echt sehr stolz bin.
Wie ist das bei den Kolleginnen und Kollegen angekommen?
Die wären sicherlich noch beeindruckter gewesen, wenn ich ein Science Paper veröffentlicht hätte. Aber sie fanden es schon cool. Mein Chef hat es sofort unterstützt und mir sogar bei der Vorbereitung geholfen. Insgesamt erlebe ich die Rückmeldung der Kolleginnen und Kollegen meistens als sehr positiv.
Weshalb finden Sie es allgemein wichtig, dass Forschende sich öffentlich äußern?
Ich glaube, es ist vor allem in der Kommunikation zu kritischen Themen, wie eben Tierversuchen, superwichtig, dass die Forschenden sichtbar in die Diskussion einsteigen und Stellung beziehen. Sonst sind es immer Organisationen, die zu diesen Themen kommunizieren, aber eben keine Menschen. Dabei ist es ganz wichtig, dass die Öffentlichkeit versteht, warum es wichtig ist, diese Art der Forschung zu betreiben, und sieht, wer dahinter steht. Da muss sich aus meiner Sicht einiges tun. Gerade wenn es brenzlig wird, verstecken sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu oft hinter ihren Einrichtungen und Organisationen. Aktuell ist die Debatte rund um die Grüne Gentechnik auf Twitter ein gutes Beispiel, wie Forschende verschiedener Einrichtungen aktiv werden könnten, um etwas zu bewegen. Wir brauchen mehr Menschen in der Wissenschaft, die sich klar positionieren.
Weshalb gibt es davon zu wenige?
Wenn man an einer wissenschaftlichen Karriere arbeitet, muss man immer seinen Lebenslauf im Blick haben. Wer irgendwann eine Professur erhalten will, muss sich genau überlegen, wie er seine Zeit investiert. Kommunikation gilt da noch zu häufig als Zeitverschwendung. Da muss sich auch im System etwas ändern, damit es sich für Forschende lohnt zu kommunizieren.
Für mich jedenfalls lohnt sich Kommunikation auch, weil man sich dadurch ein zweites Standbein aufbauen kann, falls es am Ende doch nicht klappen sollte mit der wissenschaftlichen Karriere. Außerdem glaube ich auch, dass man beispielsweise davon profitiert, sich in diesem Bereich zu engagieren. Wenn es etwa darum geht, nachzuweisen, dass man gute Lehre anbietet. Wer Spaß daran hat, komplexe Sachverhalte für alle verständlich zu vermitteln, dem nimmt man eher ab, dass er das auch mit Studierenden gut hinkriegt. Insgesamt entwickelt sich in dem Bereich derzeit einiges und es wird immer wichtiger. Langfristig muss es aber ein echtes Anreizsystem geben. Wie genau das aussehen könnte, weiß ich aber auch noch nicht.
Sie selbst machen in Zukunft aber den Schritt raus aus der Wissenschaft und werden Kommunikator in Vollzeit. Weshalb und was genau wollen Sie machen?
Die Entscheidung hat mehrere Gründe. Erstens macht es mir sehr viel Spaß und es ist längst mehr als nur ein Hobby. Außerdem sind meine Chancen auf eine Professur nicht mehr so groß und ich sehe jetzt eine gute Gelegenheit zu wechseln, beziehungsweise fand den Zeitpunkt richtig, es in diesem Bereich zu versuchen. Ich habe inzwischen ja einige Erfahrung sammeln und auch ein paar Kontakte knüpfen können. Aktuell arbeite ich mit einer Produktionsfirma daran, ein Fernsehformat zu entwickeln. Darauf hätte ich sehr große Lust. Aber auch sonst bin ich für viele Dinge offen.