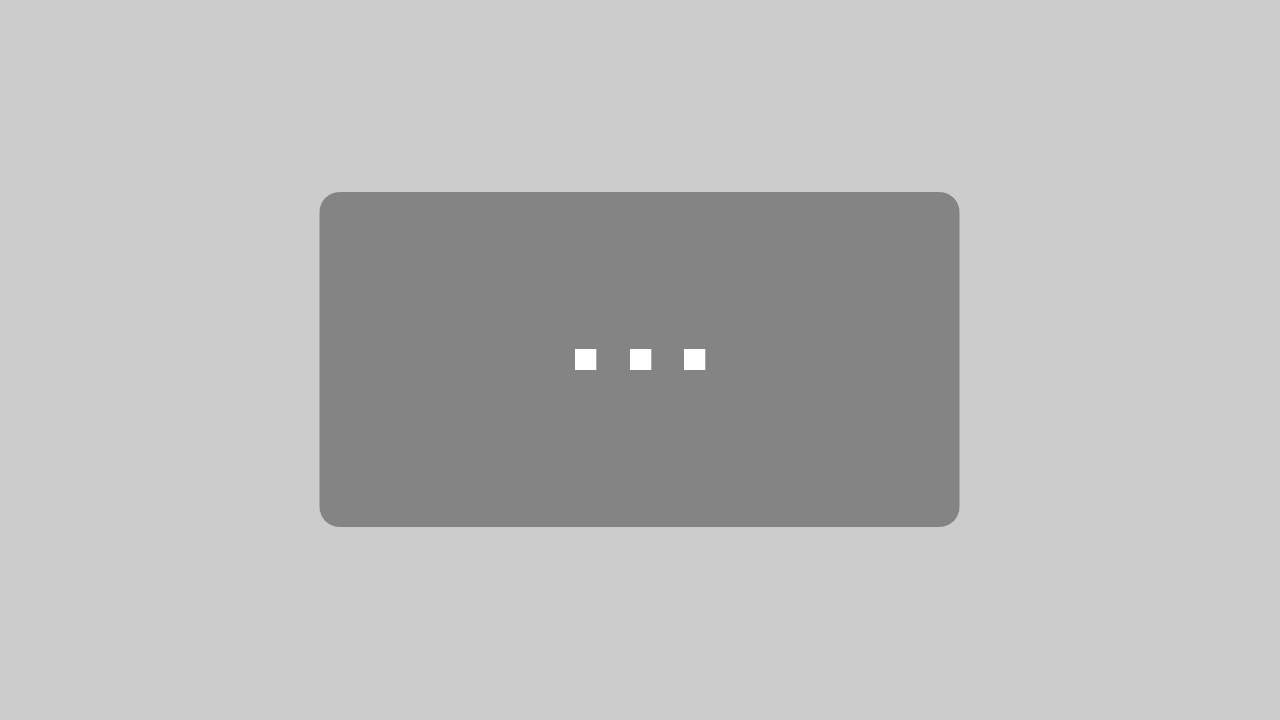Mit der Strategieagentur Ellery Studio begleiten Hanna Rasper und Dodo Vögler partizipative Prozesse. Was es dabei zu beachten gilt und welche Rolle man dabei einnehmen sollte, erklären sie im Interview.
„Wenn Partizipation funktioniert, ist es nicht nur ein Nehmen“
Frau Vögler, Frau Rasper, mit der Strategieagentur Ellery Studio begleiten Sie partizipative Prozesse. Welche sind das und wie gelingt das?

Dodo Vögler: Wir begleiten partizipative Prozesse zu Transformationsvorhaben wie Energiewende, Digitalisierung oder Mobilität. Dabei arbeiten wir beispielsweise mit Forscher*innen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, Praxisakteur*innen und auch Lai*innen zusammen. Verschiedene wissenschaftliche Disziplinen müssen gemeinsam und über die Wissenschaft hinaus miteinander kooperieren und eine transdisziplinäre Wissensintegration anstreben, um sich dem wachsenden globalen Problemdruck zu stellen. Schließlich geht es dabei immer auch um realweltliche Problemstellungen. Je nach zu bearbeitender Fragestellung und den im Prozess beteiligten Akteur*innen kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Wir entwerfen digitale als auch analoge Formate wie Zukunftswerkstätten, Spekulative Design Workshops, Reallabore, Festivals oder Roadshows.
Hanna Rasper: Partizipation lebt davon, dass unterschiedliche Leute zusammenkommen. Sie haben meist verschiedene fachliche Hintergründe. Dabei ist es entscheidend, dass wir mit einem gemeinsamen Verständnis der Aufgabe, die wir zusammen erarbeiten wollen, anfangen.
Wie kann ein gemeinsames Verständnis geschaffen werden?

Rasper: Als Methode benutzen wir dazu gerne eine semantische Analyse. Wir nehmen ein großes Stück Papier, schreiben die Fragestellung darauf und dröseln jedes einzelne Wort auf. Dann schauen wir, wer eigentlich was darunter versteht. Das führt meist zu einem Aha-Effekt und der Erkenntnis, dass es häufig so viele Definitionen wie Teilnehmende gibt. In einem Strategieprozess, den wir als Ellery Studio begleitet haben, kam beispielsweise in der Aufgabenstellung der Begriff Plattform vor. Die semantische Analyse hat dabei geholfen, viele Fragezeichen und Irritationen am Anfang aufzugreifen. Es müssen sich auch nicht alle über die Definition einig sein. Man sollte aber anerkennen, dass es unterschiedliche Verständnisse des Worts Plattform gibt.
Könnten Sie ein Beispiel für ein ko-kreatives oder partizipatives Wissenschaftskommunikationsprojekt näher beschreiben, das Sie mit dem Ellery Studio begleitet haben?
Vögler: Wir haben 2018 das erste Mal das Solar Punk Festival in Berlin veranstaltet. Solar Punk ist eine Story-Punk-Richtung wie Steam Punk oder Cyber Punk. Im Gegensatz zu ihnen ist sie aber utopisch und nicht eher dystopisch. Ihr liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Menschheit in Einklang mit der Natur lebt. Bei diesem zweiwöchigen englischsprachigen Format ging es um partizipative Zukunftsgestaltung. Wir haben Künstler*innen, Aktivisit*innen, NGOs und Wissenschaftler*innen in ganz unterschiedlichen Formaten zusammengebracht, um zu erarbeiten, wie wünschens- und lebenswerte Zukünfte aussehen können.
Wie lief das ab?
Vögler: Wir sind mit wissenschaftlichen Inputs gestartet, um eine Wissensbasis zu schaffen und ins Thema einzutauchen. Dann haben wir Field Trips zu unterschiedlichen Orten gemacht, um uns inspirieren zu lassen – beispielsweise zur Floating University.
Welche praktischen Ansätze und Strategien gibt es, um partizipative Prozesse zu begleiten?
Rasper: Gerade wenn man mit unterschiedlichen Zielgruppen arbeitet, entsteht sehr schnell eine Hierarchie, beispielsweise zwischen Expert*innen und Lai*innen. Dabei entsteht wenig Partizipation. Dann ist es nur noch ein Zuhören und Darauf-Reagieren. Augenhöhe zu schaffen ist deshalb eine der größten Herausforderungen. Wir nutzen dazu oft und gerne Graphic Recordings, um das Gesagte auf grafischer Ebene sichtbar zu machen. So können unterschiedliche Sinne und damit auch Lerntypen angesprochen werden. Das hilft uns bei der Dokumentation der Ergebnisse – und zwar nicht als wissenschaftlicher Report, sondern als visuelles Protokoll – und kann von uns an die Teilnehmenden zurückgegeben werden.
Welche Rolle und Haltung sollte man als Facilitator oder Begleiter*in eines Beteiligungsprozesses selbst einnehmen?
Vögler: Als Facilitator geht es nicht darum, sein eigenes Wissen in den Mittelpunkt zu stellen. Man sollte seine eigene Meinung deshalb zurückstellen und versuchen, eine Begleitung zu sein und den Prozess bewusst zu lenken. Man sollte die Aufgabenstellung und die Ziele nicht aus dem Blick verlieren. Wenn es hakt, kann man einen Impuls geben.
Während des Prozesses fungiert man auch als Übersetzer*in und Brückenbauer*in. Man vermittelt zwischen Positionen, bricht Hierarchien auf und fängt die unterschiedlichen Sprachen auf. Es ist auch wichtig, das Gesagte zusammenzufassen und immer wieder eine Reflexion anzustoßen. Dabei darf und sollte man immer nachfragen, was gemeint ist, und auch Fragen stellen, die sich andere womöglich gar nicht trauen zu fragen. Häufig gibt es sehr dominante Charaktere in Workshops. Aber auch diejenigen, die schüchterner sind, haben vielleicht wichtige Dinge zu sagen. Sie sollte man ermutigen, sich zu äußern. Die Moderation schafft durch den Ton und die Atmosphäre idealerweise ein Gefühl der participatory safety, sodass die Leute sich trauen mitzumachen.

Die „Solar Capsule“ ist eine begehbare Installation, die über Zukünfte erzählt. Sie entstand während des Solar Punk Festivals. Foto: Ellery Studio

Gemeinsam malen die Teilnehmenden des Solar Punk Festival ein Mural. Foto: Ellery Studio

Beim Solar Punk Festival entstand ein Mural in Ferropolis. Foto: Ellery Studio

Wissenschaftlichen Inputs beim Solar Punk Festival schufen eine gemeinsame Wissensbasis. Foto: Ellery Studio

Die Projektpitches der Teilnehmenden des Communication Lab for Research and Media wurden in Graphic Recordings visuell festgehalten. Foto: Ellery Studio
Es kam bereits zur Sprache, dass Sie den Teilnehmenden mit der Dokumentation etwas zurückgeben und ihre Arbeit sichtbar machen möchten. Warum ist das wichtig?
Vögler: Ich finde es wichtig, dass partizipative Formate eine Rahmung haben. Dass man vorab schon den richtigen Ton trifft, wenn man dazu einlädt und das Teilnehmendenmanagement macht. Dass man aber im Anschluss auch ein Follow-up schreibt, in dem man zusammenfasst, was das Ziel war, was erarbeitet wurde und was jetzt mit den Ergebnissen passiert. Dabei stellt sich wieder die Frage, wofür Partizipation überhaupt gemacht wird und worin ihre Vorteile liegen. Das sollte man am Schluss wieder auffangen.
Rasper: Beim Communication Lab for Research and Media der Alexander von Humboldt-Stiftung und der Internationalen Journalisten Programme, das wir mit dem Ellery Studio begleiten, arbeiten beispielsweise je zehn Wissenschaftler*innen und Journalist*innen an großen Meta-Themen wie Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit oder Gleichberechtigung. Dabei entsteht gemeinsam ein journalistisches Projekt über die Wissenschaft – von Podcasts, Zeitungsartikeln bis hin zu Multimediaprojekten. Die Ideen bleiben also nicht auf einem Post-it hängen, sondern gelangen nach draußen in die Welt, und man ist Teil davon.
Warum lohnt es sich, partizipative Prozesse anzustoßen und durchzuführen?
Rasper: Auf der anderen Seite ist es für die Partizipierenden eine schöne Gelegenheit, in andere Bereiche hineinzuschauen und eine Art capacity building zu machen. Sie lernen neue Methoden, netzwerken und treffen Leute, die ganz anders sind als sie selbst. Wenn Partizipation funktioniert, ist es nicht nur ein Nehmen.
In welche Schritte des Prozesses kann – und sollte – man Menschen einbeziehen?
Rasper: Man kann Menschen bereits bei der Problemdefinition einbeziehen, um an der Aufgabenstellung zu feilen. Vielleicht gibt es blinde Flecken, die das Projektteam gar nicht sieht. Dabei hilft die Perspektive von außen. Die Menschen müssen nicht erst als das lösende Partizipativ in den Umsetzungsteil integriert werden. Man darf aber nicht vergessen, dass partizipative Prozesse zeit- und kommunikationsaufwendig sind. Das führt oft dazu, dass Teilnehmende nur partiell in den Prozess mit eingebunden werden, zum Beispiel in Form eines Workshops zu einer spezifischen Projektphase oder Thema.
Das Solar Punk Festival war ein Projekt, das noch vor der Pandemie stattfand. Welche Erfahrungen haben Sie mit partizipativen Projekten im digitalen Raum?
Vögler: Im letzten Wissenschaftsjahr haben wir gemeinsam mit dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung und Wenzel Mehnert von der Universität der Künste Berlin das Projekt bio:fictions durchgeführt. Dabei ging es darum, wie bioökonomische Zukünfte aussehen könnten. Das ist ein riesiges Themenfeld. Dementsprechend vielfältig sah es in der Ausgestaltung aus.
Wie sah das Projekt aus?
Vögler: Wir haben zuerst Interviews mit Innovateur*innen über die drei Innovationsfelder Bio(r)evolution der Ernährung, Beyond Farming und Künstliche Biowelten geführt und die wichtigsten Erkenntnisse so aufbereitet, dass sie auch für fachfremde Menschen verständlich sind. Das war die Grundlage für einen digitalen Workshop mit etwa 20 Teilnehmenden, darunter Expert*innen aus Forschung oder Wirtschaft, Studierende unterschiedlicher Disziplinen und weiteren Interessierten. 
Was versteht man unter Design Fictions?
Vögler: Design Fiction ist ein relativ junger Ansatz aus der Designforschung. Er ist verwandt mit dem spekulativen Design und Critical Design. Es geht darum, Szenarien durch eine entwerfende und formgebende Disziplin erlebbar und erfahrbar zu machen. Man verlässt die Realität und begibt sich in die Welt der Fiktion und fängt an zu spekulieren. Das ist gerade für abstrakte Sachverhalte und Ideen geeignet, die nicht sofort klar oder greifbar sind – und sich über Design und Formgebung konkretisieren lassen. Daher halte ich Design Fictions für eine gute Methode in der Wissenschaftskommunikation und für Partizipation, um beispielsweise nicht greifbare Zukünfte vorstellbar zu machen.
Welche Design Fictions sind im Projekt entstanden?
Vögler: Wir sind beispielsweise der Frage nachgegangen, was wäre, wenn wir der Natur eine Stimme zurückgeben. Könnte eine Sonnenblume auch Bürgermeister*in werden oder könnten Pflanzen einen Pass bekommen? Das war alles sehr spekulativ. In den Design Fictions entstand daraus die Frage, wie es wäre, wenn es eine gemeinsame Sprache gäbe und wir als Menschen lernen würden, mit der Natur zu kommunizieren. Wir haben das „planet lingual“ genannt.
Welche Schritte im Projekt bio:fictions waren tatsächlich partizipativ?
Vögler: Der ganze Prozess hat es zum einen ermöglicht, unterschiedliche Sichtweisen zu integrieren und einen bidirektionalen Austausch zu ermöglichen. Das Wissen wurde nicht wie bei „Stille Post“ einfach weitergegeben, sondern immer wieder neu verhandelt und über visuelle Formate und Design Fictions kommuniziert. Es konnte also die rein sprachliche Ebene verlassen. Ich sehe das Projekt als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Es hat versucht, Leute, die oft in verschiedenen Blasen arbeiten, zusammenzubringen und die Meinungen, Perspektiven, Ängste und Hoffnungen von Nicht-Expert*innen miteinfließen zu lassen.