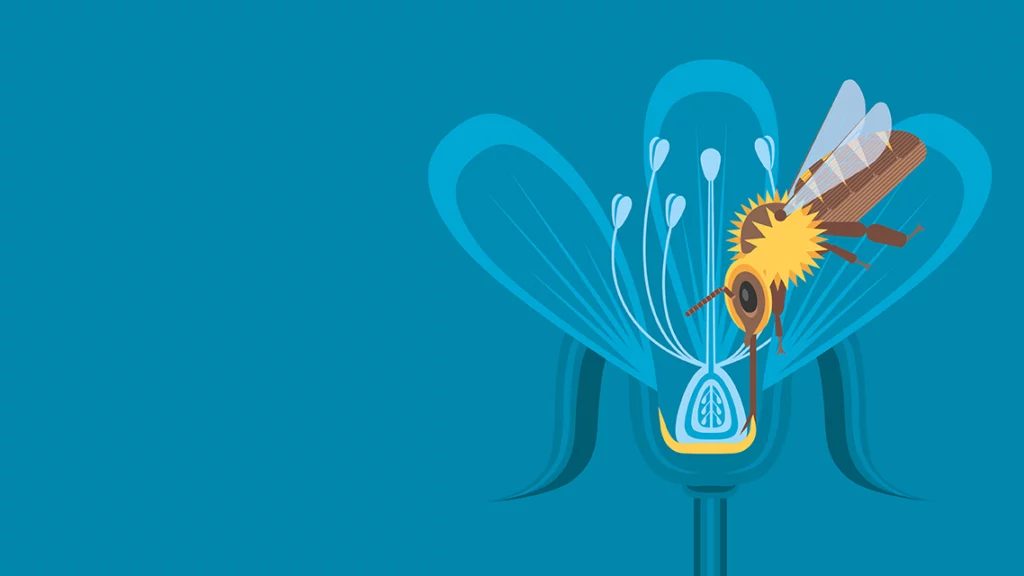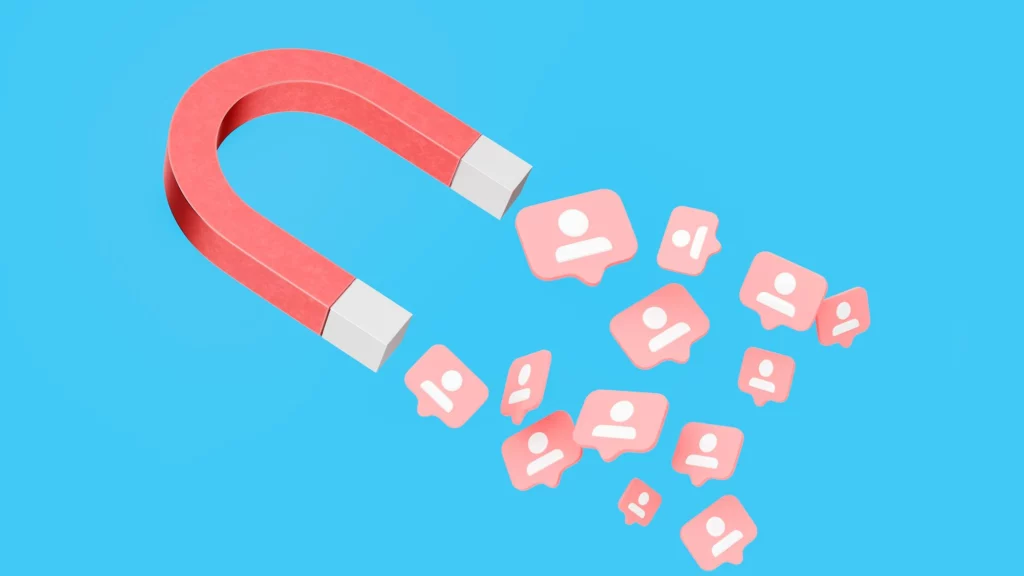Was ist anders in der Wissenschaftskommunikation – früher und heute? Seit 25 Jahren ist Susann Morgner in der Branche. Erst als Journalistin, dann als Pressesprecherin einer Uni und jetzt als Geschäftsführerin von con gressa. Malte Behlau ist seit genau drei Jahren im Geschäft, als Kommunikator im Sonderforschungsbereich 747 „Mikrokaltumformen“ an der Uni Bremen. Ein Generationengespräch.
Weniger Pressearbeit, mehr digitale Direktansprache
Frau Morgner, Herr Behlau, was sind die wichtigsten drei Bausteine der Wissenschaftskommunikation aus Ihrer Sicht?
Susann Morgner: Ich glaube, ein besonders wichtiges Kriterium ist Offenheit in der Kommunikation.
Malte Behlau: Das kann ich nur unterschreiben. Für mich ist außerdem vor allem die Zielgruppenansprache und überhaupt auch das Kennen der eigenen Zielgruppe wichtig.
Morgner: Oh, ja, auf jeden Fall und da sind wir natürlich direkt bei einem der großen Unterschiede zwischen früher und heute: Wir haben heute viel mehr Kanäle, um Leute direkt und schnell dort zu erreichen, wo sie sich auch bewegen. Das ist ein großer Vorteil, früher haben wir eine einzige Universitätszeitung für alle produziert.
Viele Kanäle, wenig qualitative Evaluation
Behlau: In der Theorie ist das natürlich der Fall, aber ich glaube, praktisch ist das noch gar nicht so richtig umsetzbar. Es fehlt noch ein bisschen daran, den Impact auch wirklich qualitativ messen zu können, trotz Evaluation.
Morgner: Ich glaube auch, dass wir manchmal durch die Vielfalt unserer Möglichkeiten vielleicht zu kleinteilig werden und fast schon zu differenziert. Da frage ich mich manchmal, ob es überhaupt noch einen Zweck erfüllt oder wir manche Aktionen nicht nur zum Selbstzweck machen, weil wir es eben können.
Behlau: Die Tendenz beobachte ich durchaus auch. Manchmal wäre es sicherlich besser, sich mehr Zeit für die Analyse einzelner Aktionen zu nehmen.

Die Wissenschaftskommunikation hatte weder heute noch früher Priorität im System
Morgner: Eine andere Sache, die sich aus meiner Sicht auch verändert hat, ist die Art und Weise, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren und wie stark sie überhaupt an Kommunikation interessiert sind.
Behlau: Ob es sich verändert hat, kann ich natürlich nicht ganz so gut sagen, aber meistens sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei uns durchaus motiviert, sich zu beteiligen. Wobei es natürlich immer auch daran liegt, wie viel sonst zu tun ist. Vor allem wenn es auf die Endphase der Promotion zugeht, wird die Bereitschaft sich an kommunikativen Formaten zu beteiligen, doch eher geringer. War das früher auch schon so?
Morgner: Ja, ich denke schon. Die Wissenschaftskommunikation hatte weder heute noch früher die Priorität im System, die sie aus meiner Sicht haben sollte. Das macht sich dann natürlich besonders bemerkbar, wenn man in Phasen kommt, die für die wissenschaftliche Karriere entscheidend sind, also beispielsweise der Abschluss der Promotion. Das ist nur minimal besser geworden. Was sich aus meiner Sicht aber verändert hat, ist die Fähigkeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit verschiedenen Zielgruppen und auf verschiedene Art und Weise zu kommunizieren. Ich glaube, da sind wir heute viel weiter, vor allem, weil es mehr vorausgesetzt wird und weil sie es öfter machen müssen. Es gibt eine viel höhere Qualität der Kommunikation als früher. Es gibt aber natürlich auch viele kritische Stimmen, was sowohl die Beteiligung von Wissenschaftlern an Kommunikation angeht, als auch an den konkreten Maßnahmen, die wir machen. Hören Sie solche Kritik auch?

Früher war es schwieriger die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu überzeugen
Behlau: Es gibt schon Kritik an einzelnen Maßnahmen. Insgesamt ist die Unterstützung allerdings da. Was einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gut gefällt – einen Blogbeitrag zu schreiben oder eine Schulklasse zu betreuen – ist oft auch typabhängig.
Morgner: Das war früher auf jeden Fall anders. Da war es schwieriger den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu erklären, warum sie an einem Format teilnehmen sollten. Sie haben es doch manchesmal nur widerwillig gemacht. Da hat sich viel bewegt.
Viel mehr kommunizierenden Wissenschaftler als Vorbilder
Behlau: Ich würde vermuten, dass es früher auch an Vorbildern mangelte. Inzwischen haben die Leute ein Bild von den Kommunikationsformaten, kennen kommunizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wissen, was sie erwartet. Das macht es einfacher.
Morgner: Ja, auf jeden Fall. Je normaler und üblicher es wird, Wissenschaft zu kommunizieren, desto weniger wird der Sinn in Frage gestellt. Die Einstellung ist jetzt nicht mehr „Was für ein Quatsch!“, sondern eher „Ist es das richtige Format für mich?“. Eine Frage, die mich interessieren würde, ist: Wieviel Ihrer Arbeit findet eigentlich online statt?
Behlau: Ich würde sagen, etwa zwei Drittel.
Weniger direkte Pressearbeit, mehr digitale Direktansprache
Morgner: Das ist natürlich spannend, weil es damit ja zwei Drittel Ihrer heutigen Arbeit gar nicht gab, als ich mit Wissenschaftskommunikation angefangen habe. Was ich mich manchmal frage ist, ob wir eigentlich irgendwelche Maßnahmen zugunsten von Online aufgegeben haben. Ich glaube zum Beispiel, heutzutage wird weniger der direkte Pressekontakt gepflegt, sondern viel mehr direkte Kommunikation in die Gesellschaft betrieben. Wie ist es bei Ihnen?
Behlau: Da würde ich Ihnen recht geben. Wir machen eigentlich selten etwas speziell für Journalisten, abgesehen von Pressemitteilungen. Wir fokussieren uns sehr auf die direkte Kommunikationsarbeit. Insofern kann man dies durchaus auch als Wandel wahrnehmen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass das auch an unserem sehr speziellen Thema liegt.
Morgner: Stimmt, daran könnte es natürlich auch liegen. Wobei ich die Tendenz schon auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus Pressestellen von Wissenschaftseinrichtungen wahrnehme. Eine andere Veränderung, die ich beobachte, ist eine stärkere Internationalisierung. Dadurch verändert sich beispielsweise auch die interne Kommunikation. Und noch vieles mehr. Damit sind wir in Deutschland fast schon ein bisschen spät dran.
Behlau: Bei uns nehme ich das nur in der Kommunikation mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wahr und natürlich in der Fachwelt. Ansonsten richten wir uns aber schon viel an den lokalen Raum. Ich glaube, die Internationalisierung der Wissenschaftskommunikation nimmt man vor allem in den größeren Institutionen wahr. Sinnvoll fände ich es aber auf jeden Fall und vielleicht liegt da unsere nächste Herausforderung für unsere Arbeit. Was ist denn derzeit die größte Herausforderung in Ihrem Bereich?
Die größten Herausforderungen: Transparenz und Qualitätssicherung
Morgner: Transparenz beziehungsweise Offenheit in der Wissenschaftskommunikation ist eine der wichtigsten Herausforderungen. Nur so schafft man langfristig Verständnis für das System und die Wissenschaft als solche. Sonst verlieren wir irgendwann tatsächlich das Vertrauen der Bevölkerung.
Behlau: Dem kann ich nur zustimmen. Für mich ist eine weitere große Herausforderung die Qualitätssicherung. Sich also in seiner Arbeit an die Leitlinien der Wissenschaftskommunikation zu halten und diese auch wirklich in seinen Alltag zu integrieren, ist aus meiner Sicht enorm wichtig und kommt manchmal zu kurz. Dazu bedarf es auch einer noch stärkeren Vernetzung innerhalb der Branche. Das würde durchaus helfen.Morgner: Das ist sicherlich sinnvoll. Und wenn wir eine konstruktive Fehlerkultur etablieren, haben wir schon viel geschafft.
Zum Abschluss noch eine Frage von uns. Warum ist heute alles besser als es früher war, Herr Behlau?
Behlau: Ich glaube, durch die steigende Zahl der Kommunikationskanäle ist eine direkte Zielgruppenansprache einfacher und kostengünstiger möglich. Das ist natürlich ein klarer Vorteil der heutigen Kommunikationswelt. Auch die höhere Bereitschaft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist auf jeden Fall ein Fortschritt.
Oder war früher doch alles besser, Frau Morgner?
Morgner: Nein auf keinen Fall, sonst würde ich den Job nicht mehr machen. Es gibt eigentlich nichts, wonach ich mich zurücksehne. Das Einzige, was ich manchmal gerne mehr hätte, wäre Ruhe. Aber die hatten wir, wenn man ehrlich ist, früher auch nicht. Insofern war es früher auf keinen Fall besser!