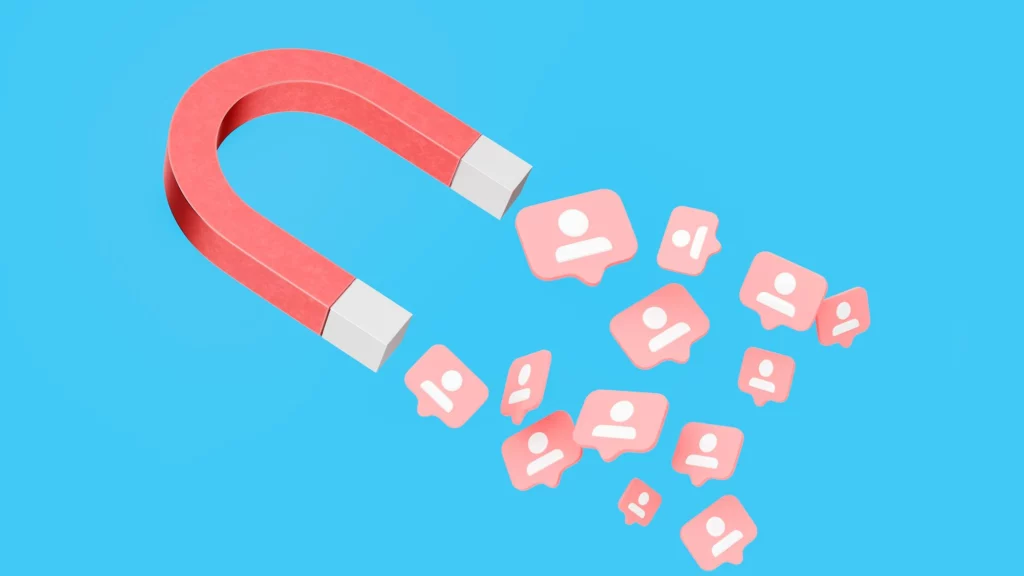Das Forum Wissenschaftskommunikation legt in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf das Thema „Sprache und Wissenschaftskommunikation”. Ein Gespräch mit der Autorin Kübra Gümüşay über Sprache, gesellschaftliche Diskurse und die Rolle der Wissenschaft.
„Sprache ist ein Ort, an dem wir uns treffen können“
Liebe Frau Gümüşay, Ihr Buch trägt den Titel „Sprache und Sein”. Weshalb ist für Sie das Thema Sprache ein so wichtiges?
Sprache ist eine Möglichkeit, Menschen, die nicht die gleiche Erfahrungswelt haben, miteinander zu verbinden. Sprache ermöglicht es uns einzutauchen in fiktive Leben, in die Zukunft oder auch in die Welt wildfremder Menschen, zu deren Leben man niemals Zugang gehabt hätte. Sprache ist also ein Ort, an dem wir uns treffen können. Ich habe mich viel mit der Frage beschäftigt, ob ein Mensch in einer Sprache ein vollständiger Mensch sein kann, in der er als sprechender Mensch nicht vorgesehen war. Und wie die Architektur unserer Sprache dies ermöglichen könnte.

Ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich immer wieder gegen die Mauern der Sprache gelaufen bin. In den politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Diskursen, an denen ich teilgenommen habe, ist mir vielfach aufgefallen, dass die Art und Weise, wie wir sprechen und die Sprache, die wir benutzen, hinderlich dabei ist, darüber zu sprechen, worum es eigentlich geht.
So habe ich versucht, so tief zu graben, bis ich auf etwas stoßen würde, was essenziell und grundsätzlich genug ist, um dieses Phänomen zu erklären. Dabei bin ich auf die Architektur der Sprache gestoßen.
Wie müsste Sprache denn angelegt sein, damit solche Diskurse für alle zugänglich sind?
Das Wichtigste ist – und in der Wissenschaft ist das selbstverständlich – das Bewusstsein für die Begrenztheit der Sprache. Das Bewusstsein darüber und dafür, dass die Strukturen, die wir schaffen, die Sprache, die wir nutzen, und das Wissen, das wir aufbauen und erwerben, nicht universell und allumfassend, sondern eben begrenzt ist. Das Bewusstsein für unsere Begrenztheit eröffnet auch das Bewusstsein für die Relevanz von Wachstum und die Notwendigkeit von Fehlern, die wir machen müssen, um aus ihnen lernen zu können.
Die Veränderlichkeit von Sprache polarisiert sehr stark. Wie schafft man aus ihrer Sicht einen besseren Diskurs darüber?
Aus meiner Sicht hat das viel damit zu tun, in welchem Rahmen und unter welchen Voraussetzungen man darüber diskutiert. Ich bin deshalb in meinem Buch bewusst einen Umweg gegangen. Ich bin bewusst in andere Sprachen als die hiesige eingetaucht, quasi in anderen Gewässern geschwommen. Und zwar mit dem Ziel, dass Menschen dann, wenn sie wieder in das heimische Gewässer zurückkehren, das Wasser überhaupt sehen, spüren und erkennen können. Ein Bewusstsein für das bekommen, was uns umgibt. Dies zu betrachten und mit etwas Abstand uns zu fragen: Geht es anders? Geht es besser?
Für mich war also sehr wichtig, nicht sofort in die politische Diskussion einzutauchen, sondern zunächst die Rahmenbedingungen abzustecken, innerhalb derer wie über unser Miteinander verhandeln.
Was bedeutet das in der Praxis?
Überträgt man es auf die Praxis, dann heißt es, dass Wissenschaftskommunikation nicht ein Rezept für alle Formen von Öffentlichkeit bereithalten kann. Je nachdem, zu wem man spricht, muss man den Menschen woanders abholen. Verständlichkeit und Zugänglichkeit bedeuten für eine 13-jährige Schülerin aus Kiel etwas komplett anderes als für einen 80-jährigen Rentner aus Köln. Zu wem sprechen wir? Wen möchten wir erreichen? Und wie? Die Frage nach der Zielgruppe ist von zentraler Bedeutung, wird aber noch zu selten ehrlich gestellt und tatsächlich beantwortet. So bauen wir uns dann ein Bild eines vermeintlich homogenen Publikums mit bestimmten Ängsten und Befindlichkeiten und sprechen dann zu diesem imaginären Publikum. Diese Homogenisierung und Reduktion führt paradoxerweise zu einem gewissen Antagonismus unserer Gesellschaft – also dazu, dass es die eine Front mit diesen Befindlichkeiten und die anderen mit jenen Befindlichkeiten gibt. Weder durchdringen wir damit die Komplexität unserer Gesellschaft, noch werden wir den Ansprüchen gelungener Kommunikation gerecht.
Können Sie hierfür ein Beispiel nennen?
Auf Sprache bezogen bedeutet es, dass es nicht nur diejenigen abzuholen gilt, die sich grundsätzlich fragen, wieso man beispielsweise überhaupt gendert, sondern auch jene, die sich mit Nuancen der Fragestellung befassen und eher die Frage stellen: Wie gendern wir idealerweise? Eine solche Fragestellung führt zu einem völlig anderen Diskurs als die Frage, ob wir gendern sollten oder nicht. Wenn sich jede Diskussion für eine gerechtere Gesellschaft darin erschöpft, ob eine Ungerechtigkeit überhaupt existiert – die Klimakrise, Sexismus, Rassismus, Armut – dann haben wir hier einen eklatanten Missstand.
Geht es dabei auch um Demut oder gibt es ein passenderes Wort dafür, sich darüber bewusst zu sein, aus welcher Rolle und Position man spricht?
Ich finde das Wort Demut tatsächlich sehr passend. Gute Wissenschaftler*innen sind für mich Menschen, die demütig sind. Menschen also, die sich ihrer selbst bewusst sind, die wissen, was sie wissen, aber auch ein Bewusstsein dafür haben, was sie eben noch nicht wissen und wo es noch Lücken gibt. Dieser Aspekt kommt im öffentlichen Diskurs zu kurz. Hier werden zu oft Menschen belohnt, die so tun, als wüssten sie alles. Wissenschaftler*innen, die mit Demut kommunizieren und somit auch die Grenzen ihres Wissens transparent vermitteln, werden hingegen oft dafür kritisiert und angegriffen. Genau das müssen wir kritisch hinterfragen und beleuchten. Wir sollten uns diesen Dynamiken entgegenstellen statt uns an sie anzupassen.
Wir haben viel über Diskursräume gesprochen, die nicht konstruktiv sind. Wie kann man das ändern und wieder konstruktive Debatten führen?
Indem beispielsweise auch mal zwei Personen – meinetwegen Wissenschaftler*innen –, die zu einem Thema arbeiten und einen gewissen Grundkonsens dazu haben, aber unterschiedliche Sichtweisen auf beispielsweise die politische, soziale Umsetzung, dazu konstruktiv öffentlich diskutieren und streiten. Eine konstruktive Diskurskultur können wir nur dann etablieren, wenn wir sie auch wagen und erproben.
Dafür müssen wir sichtbar machen, unter welchen Bedingungen wir sprechen. Sind also alle Menschen in einer Diskussion gleich mächtig? Und wie kommen sie eigentlich zu ihren Aussagen und welche Faktoren bedingen ihre Ansichten? Spielen etwa neben der eigenen Forschung oder angelesenen Wissens auch biografische, persönliche Erfahrungen eine Rolle oder auch politische Verstrickungen und berufliche Umstände? Das müssen wir transparenter machen, denn es beeinflusst Debatten. Niemand ist neutral und unbefangen. Niemand kann Objektivität für sich beanspruchen – lediglich danach streben.
Letztlich ist die Aufgabe unserer Gesamtöffentlichkeit, verschiedene Perspektiven abzuwägen, die relevanten sichtbar zu machen und zusammenzuführen. Sie kennen sicher das Beispiel des Elefanten in einem großen, dunklen Raum, den alle, die ihn anfassen, beschreiben sollen. Der Eine sagt: „Er ist ganz weich und lang.” Die Andere sagt: „Der ist ganz dünn und haarig.” Jemand anderes sagt: „Er ist ganz breit und ledrig.” Und jemand anderes sagt: „Ganz lang und haarig.” Alle haben recht. Sie beschreiben das gleiche Lebewesen. Aber sie alle beschreiben es aus einer anderen Perspektive heraus, die mal relevanter, mal essenzieller, mal begrenzter, mal umfassender ist. Und genau das ist die Herausforderung in großen Gesellschaften wie der unseren. Das Zusammenführen dieser Perspektiven, um zu erkennen, was da vor uns steht, was uns umgibt. Das geht allerdings nur, wenn alle Beteiligten auf ihren Absolutheitsanspruch verzichten und sich ihrer jeweiligen Begrenztheit bewusst sind.
Kann sowas tatsächlich funktionieren in einer Medienöffentlichkeit, in der sich vieles um Aufmerksamkeit und größtmögliche Schlagzeilen dreht?

Die Debatte um Diskursräume ist derzeit sehr präsent. Was würden Sie sich wünschen, dass bei dieser Debatte herauskommt?
Ich würde hoffen, dass der Prozess nicht zum Abschluss kommt, sondern dauerhaft weitergeführt wird. Damit unsere Strukturen und die Bedingungen, unter denen wir existieren und agieren, konstant hinterfragt, diskutiert, beleuchtet, angepasst und verbessert werden können.
Gleichzeitig erhoffe ich mir, dass experimentiert wird. Wir also neue Räume schaffen, die nach anderen Parametern ausgelegt sind. Ich wünsche mir, dass wir die Art, wie wir Diskurse führen, immer wieder feinjustieren, einen konstruktiven Diskurs allem trotzend selbst ausleben, erproben und das Projekt nicht für gescheitert erklären. Dafür geht es einfach um zu viel.