Anfang November wurde der Public-Engagement-Kodex im Rahmen der Berlin Science Week vorgestellt. Der Kodex soll als Leitbild für Personen dienen, die den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gestalten. Ein Gespräch mit den Organisator*innen Rebecca Beiter und Patrick Klügel über die Bedeutung des Kodex, das Verhältnis von Public Engagement und Wissenschaftskommunikation sowie ihre Vision für Public Engagement in Deutschland.
„Public Engagement ist ein radikaler Kommunikationsansatz“
Frau Beiter, bei der Vorstellung des Public-Engagement-Kodex am 4. November in Berlin sagten Sie, bislang fehle eine klare Definition von Public Engagement in Deutschland. Wie definieren Sie den Begriff?

Rebecca Beiter: Wir definieren Public Engagement als den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und als dreigliedrigen Begriff: Public Engagement ist zum einen ein Feld in der Wissenschaftslandschaft. Es ist zweitens eine Haltung, die aussagt, dass dieser Austausch von beiden Seiten sinnstiftend sein kann, von dem beide Seiten profitieren und den wir vorantreiben wollen.
Patrick Klügel: Und drittens ist es eine Praxis. Ergänzend dazu war uns besonders wichtig, dass der Begriff in eine Strategie eingebettet ist. Das ist ein Prinzip des Kodex, das besonders hervorgehoben werden muss. Wir fordern, dass Public Engagement nicht nur einzelne Austauschveranstaltungen umfasst, sondern im Sinne einer Institutionalisierung ein langjähriges strategisches Vorgehen beinhaltet, das dieses Engagement erst ermöglicht.

Dem Launch des Kodex ging ein anderthalbjähriger offener Prozess voraus. Wie lief dieser Prozess ab?
Beiter: In unserer Arbeit als Public-Engagement-Manager*innen haben wir realisiert, dass ein solcher Kodex im Alltag fehlte. Als Journalistin ist der Pressekodex handlungsleitend, als Fachreferentin in der politischen Bildung bietet der Beutelsbacher Konsens Orientierung. Zwar gibt es unterschiedliche Leitlinien in der Wissenschaftskommunikation und -PR, doch die Art und Weise, wie wir die Öffentlichkeit in die Wissenschaft einbeziehen möchten, fehlte darin.
Wir haben sehr schnell Hilfe von unterschiedlichen Stellen erhalten, insbesondere von der Berlin School of Public Engagement and Open Science, die diesen Prozess maßgeblich unterstützt und begleitet hat. Zunächst haben wir Geschichten, Erfahrungsberichte und Probleme von Wissenschaftskommunikator*innen und Public-Engagement-Praktizierenden gesammelt. Es gab eine von uns geschriebene erste Version des Kodex, die wir im weiteren Prozess als Grundlage genutzt haben. Das war hilfreich, denn schon bestehenden Inhalt zu kommentieren und neue Ideen einzubringen, funktioniert in einem co-kreativen Prozess deutlich besser. Die neu gegründete Public-Engagement-Arbeitsgruppe war für die Feinarbeit am Text und die Einarbeitung der einzelnen Kommentare zuständig. An dem Prozess waren jedoch durchgehend unterschiedliche Gruppen beteiligt, wie zum Beispiel Studierende ohne Vorkenntnisse in dem Feld.
Klügel: Das war das Spannende: Es sind ganz unterschiedliche Perspektiven eingeflossen, auch von Leuten aus Museen oder aus dem sozialen Bereich. Public Engagement ist ja nicht auf die Wissenschaft begrenzt, sondern wird in anderen Branchen seit vielen Jahren praktiziert. Davon kann die Wissenschaft profitieren und wir waren froh, auch diese Perspektiven einbinden zu können.
Was waren die größten Herausforderungen bis zum Launch des Kodex?
Beiter: Die organisatorische Herausforderung in dieser sehr offenen Kodex-Entwicklung war, erst einmal das Vorgehen zu definieren. Trotz der Offenheit brauchte die Kodex-Entwicklung eine Struktur und jemanden, der den Zeitplan im Blick behält.
Klügel: Eine weitere Herausforderung war die Gradwanderung zu meistern, dass der Kodex einerseits einen universellen Anspruch hat, der viele Bereiche abdecken soll. Das haben wir in der Vision und Mission für Public Engagement zu Beginn des Kodex beschrieben. Andererseits haben wir aber den Anspruch, dass der Kodex handlungsleitend und hilfreich für die tatsächliche Praxis werden soll. Dazu dienen die Prinzipien. Im Prinzip „Transparent handeln“ ist das beispielsweise schon sehr konkret formuliert. Trotzdem: Das bleibt eine Herausforderung für die Weiterentwicklung des Textes, denn diese handlungsleitende Hilfestellung ist in der jetzigen Flughöhe so vielleicht noch nicht gegeben.
Im Vorwort des Kodex steht, Public Engagement unterscheide sich deutlich von anderen Spielarten der Wissenschaftskommunikation. Wo sehen Sie die Unterschiede?
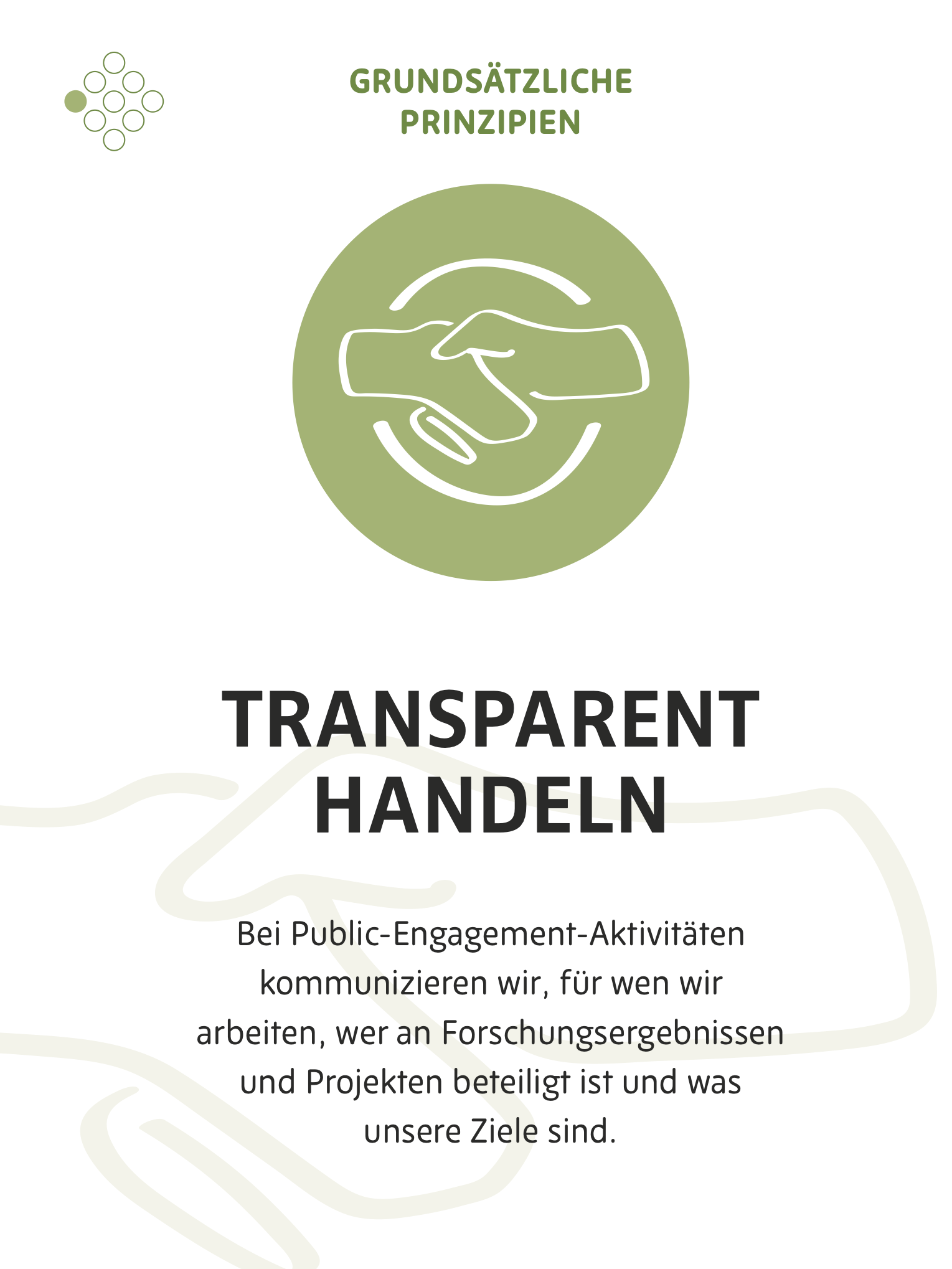
Klügel: Public Engagement ist ein radikaler Kommunikationsansatz. Jegliche dialogische Kommunikationsaktivität soll in ein Nachdenken über die Wirkung im Forschungszusammenhang eingebettet sein. Forschende und Praktiker könnten sich so schon zu Beginn eines Forschungsprojekts Gedanken machen: Wie trete ich in den Austausch mit einer Interaktionsgruppe, um deren Expertise einzubinden? Diese Kommunikation hat vielleicht keine große Reichweite, aber möglicherweise eine intensive Wirkung. Wenn man das durchspielt, müsste man ganz viele Kommunikationsaktivitäten wie Tage der offenen Tür oder Podiumsdiskussionen in ihrer jetzigen Form sein lassen, weil sie in dieser Wirkungskette keine wesentliche Rolle spielen. Nimmt man aber den strategischen Aspekt hinzu, dann wiederum können viele Kommunikationsaktivitäten einen vorbereitenden und inspirierenden Beitrag leisten. Dieser Grundgedanke unterscheidet uns aus meiner Sicht deutlich von anderen Spielarten der Kommunikation, die eben sehr singulär, sehr projektorientiert sind, und nicht diesen Hintergedanken der Wirkung innerhalb der Forschungskette haben.
Beiter: Wir wollen ein Miteinander. Es braucht weiterhin die „klassische Wissenschaftskommunikation“, die Forschungsergebnisse einfach und verständlich aufbereitet. Es braucht aber auch Public Engagement als eigenständiges, selbstbewusst etabliertes Feld, damit wir letztlich auch das benötigte Personal, die Mittel und die Zeit eingeräumt bekommen.
Klügel: Außerdem macht das auch deutlich, dass Public-Engagement-Manager*innen, wie wir sie sein dürfen, die verschiedenen Spielarten der Wissenschaftskommunikation draufhaben und mitdenken müssen. Wir sind sowohl in klassische Kommunikationsaktivitäten involviert, müssen aber auch das Instrumentarium der partizipativen Forschung kennen. Es gibt viele partizipative Projekte, die zwar als Projekt funktionieren, aber auf frühen Stufen der Partizipation stehen bleiben. Am Ende fehlt oft die Zeit und Finanzierung ¬– das wiederum ist etwas, das durch den generalistischen Anspruch des Public Engagements erreicht werden kann.

Ist Public Engagement damit der partizipative Arm der Wissenschaftskommunikation?
Klügel: Ich wäre vielleicht so mutig zu sagen, dass Public Engagement der strategische Arm der Wissenschaftskommunikation ist. Der, wenn er wirklich strategisch angelegt ist, auch ganz im Zentrum der Forschungsstrategien angesiedelt sein muss. Nicht in den Kommunikationsabteilungen.
Beiter: Auch auf europäischer Ebene ändert sich dazu wahnsinnig viel. In den Förderprogrammen von Horizon Europe zählt Open Science, und damit auch Public Engagement, als ein Kriterium für exzellente Wissenschaft. Dadurch erhält Public Engagement mehr Gewicht und Forschende sollten es schon bei der Antragsstellung mitdenken. Aber wie genau Public Engagement und die Umsetzung des Kodex in den einzelnen Institutionen angesiedelt sein wird, möchten wir 2023 im nächsten Schritt, der Institutionalisierung des Kodex, gemeinsam mit allen Beteiligten erarbeiten.
Die Veröffentlichung des Public-Engagement-Kodex ist erst der Start: als „lebendiges Dokument“ soll weiter daran gearbeitet werden. Was sind die nächsten geplanten Schritte?
Beiter: Es gibt zwei Wege, die gleichzeitig beschritten werden. Das ist zum einen die Public-Engagement-AG, die weiter den Kodex schärft und eine Neuauflage für Ende Oktober 2023 plant. Unser Ziel in der AG wird sein, Erfahrungen zu sammeln, ob der Kodex im Alltag schon zum Einsatz kam, welche Prinzipien hilfreich, welche weniger hilfreich sind, und ob etwas fehlt. Über alles, was im aktuellen Kodex steht, darf debattiert werden. Dann kommen die nächsten Runden, in denen wir die gesammelten Ideen und Kommentare in Schriftform gießen. Und womöglich auch einen Kern des Kodex festlegen, an dem nicht mehr gerüttelt wird. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligen, bei unserer LinkedIn-Gruppe vorbeizuschauen oder am nächsten AG-Treffen teilzunehmen.
Klügel: Der zweite Weg sind Senior Roundtables, bei denen die Berlin School of Public Engagement mit Multiplikator:innen aus wissenschaftlichen Einrichtungen diskutieren wird, wie wir die Institutionalisierung von Public Engagement in Deutschland strategisch angehen können. Wir wollen auf verschiedenen Ebenen dafür werben, welchen Mehrwert nicht nur der Kodex, sondern vor allem Public Engagement als Praxis für den Transformationsprozess, den unsere Gesellschaften durchlaufen müssen, haben können. Hinter all dem steht die Vision: Wenn Public Engagement konsequent durchgeführt und nicht-wissenschaftliches Wissen stärker in wissenschaftliche Prozesse eingebunden wird, dann werden auch unsere Gesellschaften resilienter.





