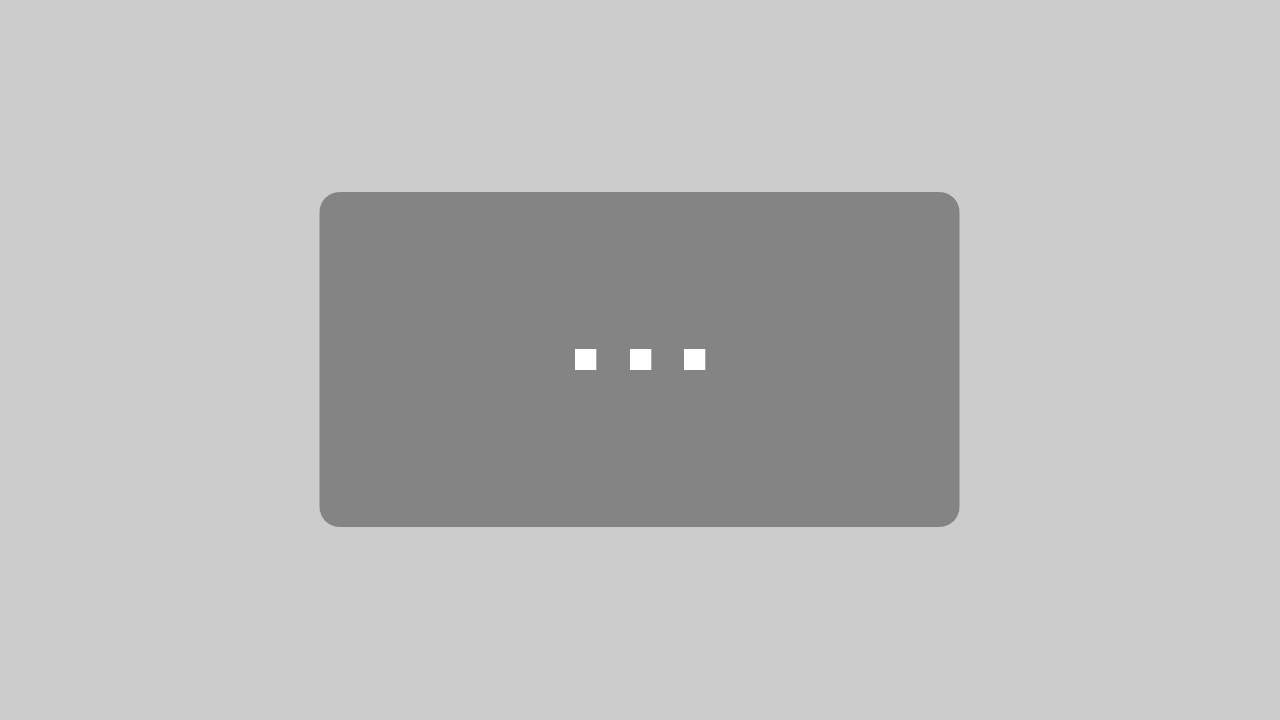Welche Forschenden werden von der Presse als Fachleute interviewt? Laut einer aktuellen Studie spielt die wissenschaftliche Reputation zwar eine Rolle – ist aber nicht entscheidend. Ein Gespräch mit Melanie Leidecker-Sandmann vom Karlsruher Institut für Technologie.*
„Meistens hätte es Leute gegeben, die noch mehr Ahnung vom Thema haben“
Frau Leidecker-Sandmann, Sie haben gemeinsam mit Markus Lehmkuhl untersucht, inwieweit Journalistinnen und Journalisten bei wissenschaftlichen Themen tatsächlich die renommiertesten Forschenden interviewen. Gibt es denn Anlass, an der Auswahl der Redaktionen zu zweifeln?
Wahrscheinlich kommen jedem von uns manchmal Zweifel daran, ob in den Medien zitierte Fachleute auch wirklich die geeignetsten Expertinnen oder Experten für das jeweilige Thema sind. Als Laie auf einem Forschungsgebiet hat man allerdings meist keine Möglichkeit, das abschließend zu bewerten. Außerdem haben einige ältere Studien aus den USA ergeben, dass die wissenschaftliche Reputation von Forschenden nicht das entscheidende Kriterium dafür ist, ob sie in den Medien auftauchen. Für die deutschsprachige Presse gibt es aktuell keine solche Untersuchung, obwohl die Frage auch hier relevant ist. Deshalb haben wir uns das einmal näher angesehen.

Was kommt denn noch als Auswahlkriterium in Frage außer der fachlichen Expertise?
Da kann es viele Gründe geben. Etwa wie charismatisch oder wie medienaffin Forschende sind, oder ob sie bereits Kontakte zur Presse haben. Gordon Shepherd hatte in seiner Studie von 1981 festgestellt, dass 69 Prozent der von den Medien als wissenschaftliche Autoritäten präsentierten Quellen noch nie etwas zum konkreten Thema in einschlägigen Fachzeitschriften publiziert hatten. Damals ging es um die Freigabe von Marihuana. Stattdessen wurden oft Forschende aus verwandten Gebieten nach ihrer Meinung gefragt, die einen gewissen Bekanntheitsgrad hatten – auch wenn sie zum Thema selbst gar nicht forschten.
Wie sind Sie in Ihrer aktuellen Studie vorgegangen?
Wir haben untersucht, wie verschiedene deutsch- und englischsprachige Nachrichtenmedien zwischen 1993 und 2015 über drei Gesundheitsthemen berichteten: Antibiotikaresistenzen, Ebola und eine drohende Grippe-Pandemie. Zunächst haben wir für jeden Artikel aufgelistet, welche Akteurinnen und Akteure überhaupt zu Wort kamen. Wenn es sich um Forschende handelte, haben wir anschließend versucht, deren Renommee auf dem jeweiligen Fachgebiet zu bestimmen. Dazu haben wir in einer großen Literaturdatenbank danach gesucht, wie viele Publikationen sie zum Thema vorzuweisen haben. Außerdem haben wir den sogenannten h-Index herangezogen. Er drückt, grob gesagt, aus, wie häufig jemand in den Fachpublikationen anderer Autorinnen und Autoren zitiert wird. Mehr Querverweise sprechen für einen größeren Impact auf dem jeweiligen Forschungsgebiet. Zuletzt haben wir diese Berechnung des Renommees noch für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgenommen, die auf den drei Forschungsfeldern aktiv sind. So konnten wir vergleichen, ob die Expertinnen und Experten in den Presseberichten wirklich zu den zentralen wissenschaftlichen Persönlichkeiten ihres Fachs gehören.
Und was kam dabei heraus?
Unsere Ergebnisse zeichnen ein positiveres Bild als die frühen amerikanischen Arbeiten. In unserer Stichprobe von Presseartikeln hatten die befragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fast immer einschlägige Publikationen auf dem Themenfeld vorzuweisen, zu dem sie befragt wurden – im Schnitt 14 Stück. Am häufigsten kommen dabei allerdings Forschende mit einem eher niedrigen Renommee zu Wort, die also vergleichsweise wenig publiziert haben und seltener zitiert werden. Forschende, die zu den Koryphäen ihres Fachs zählen – gemessen an thematisch einschlägigen Veröffentlichungen und Zitationen – tauchen dagegen seltener in den Medien auf. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten achten zwar darauf, dass die Interviewten zum Thema forschen, aber die wissenschaftliche Reputation stellt offenbar nicht das zentrale Auswahlkriterium dar.
Wäre es denn nicht wünschenswert, dass die renommiertesten Forschenden häufiger auftauchen?
Normativ gesprochen wäre es natürlich besser, wenn fachlich besonders einschlägige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich auch am häufigsten in den Medien äußern würden. Aber das ist in der Praxis natürlich schwer umzusetzen. Denn es gibt nur wenige von diesen sehr renommierten Forschenden, und sie sind meist schwer für ein Interview zu gewinnen. Das kann schon leicht daran scheitern, dass sich nicht rechtzeitig ein Termin für ein Gespräch findet. Insofern: Meistens hätte es zwar Leute gegeben, die noch mehr Ahnung vom Thema haben. Verglichen mit den früheren Befunden zu dieser Fragestellung kommen die Medien in unserer Untersuchung aber nicht so schlecht weg.
Gab es Unterschiede zwischen den Redaktionen, etwa denen in Deutschland und den USA?
Wissen Sie, welche Auswahlkriterien in den von Ihnen untersuchten Artikeln noch zum Tragen kamen außer dem Renommee der Forschenden?
Darüber können wir mit unseren Daten leider keine Aussage treffen. Das ist aber etwas, was wir in künftigen Studien untersuchen wollen. Die Literatur deutet darauf hin, dass neben der Bekanntheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen zum Beispiel ihre regionale Nähe zum Sitz der Redaktion, ihre Bekanntheit und ihre Kommunikationsfähigkeit eine Rolle spielen könnten.
Aktuell wird eine Stellungnahme heftig diskutiert, mit der sich rund einhundert Lungenärztinnen und -ärzte in die Feinstaub-Debatte eingemischt haben, dabei aber wissenschaftlich gesehen eine Minderheitenposition vertreten. Die Unterzeichnenden erfüllen in der Mehrzahl nicht das Kriterium, selbst auf dem entsprechenden Gebiet geforscht zu haben. Was ist da schiefgelaufen?
Das ist tatsächlich, wenn man es mit unseren Ergebnissen vergleicht, ein eher ungewöhnlicher Vorgang. Normalerweise können Medienschaffende nämlich durchaus einschätzen, wie es um das fachliche Renommee von Expertinnen und Experten bestellt ist. Meine Vermutung wäre, dass hier einfach die Menge an Unterzeichnenden viele Redaktionen beeindruckt hat – und die Tatsache, dass der Inhalt der Stellungnahme unerwartet war, weil sie dem bisherigen Konsens widersprach. Das alles erhöht den Nachrichtenwert. Die Erkenntnis, dass die große Mehrheit der Mitglieder der Fachgesellschaft das Papier ja gerade nicht unterschrieben hat, kam da wohl zu spät.
Die Jahrestagung der Fachgruppe Wissenschaftskommunikation der DGPuK (Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft) zum Thema „Gefühlte Wissenschaft“ findet vom 6. bis 8. Februar 2019 in Braunschweig statt. Melanie Leidecker-Sandmann und Markus Lehmkuhl präsentieren die hier besprochene Studie am 8. Februar ab 13:30 Uhr im offenen Panel unter dem Titel „‚Visible scientists revisited‘: Wissenschaftliche Akteure in der medialen Berichterstattung über gesundheitliche Risikophänomene“.
Mehr zur Tagung
Livestream der Paneldiskussion „Emotional(isierend)e Inhalte“ vom 7. Februar:
*Das Teilinstitut für Wissenschaftskommunikation am Institut für Technikzukünfte (ITZ) des KIT ist einer der drei Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de