Musikwissenschaftlerin Leila Zickgraf beschäftigt sich nicht nur in ihrer Forschung mit dem Zusammenspiel von Kunst und Technologie, sie entwickelt auch Kunstprojekte auf Basis ihrer Arbeiten mit. Wie diese gut gelingen und wie Wissenschaft und Kunst einander bereichern können, erklärt sie im Interview.
Mehr als kreative Ressource
Frau Zickgraf, Sie beschäftigen sich mit Automatisierung und Technologie in der Kunst. Was fasziniert Sie an dieser Kombination?

Mich fasziniert die Aktualität dieser Thematik. Schaut man sich gegenwärtige Kulturproduktionen an – seien es Bücher, Kinofilme, Theaterstücke oder eben auch Kompositionen –, scheint das Thema der sogenannten Künstlichen Intelligenz allgegenwärtig zu sein. Zwei Punkte kommen dabei immer wieder zur Sprache: zum einen die Frage nach den Möglichkeiten, die uns neue Technologien bieten. Zum anderen die Angst davor, dass der Mensch eines Tages die Kontrolle über die Maschinen und Algorithmen verliert oder gar durch sie ersetzt werden könnte. Wohin diese Entwicklung führt, ist momentan noch nicht abzusehen. In solch einer Situation der Unsicherheit können die Geisteswissenschaften Orientierung geben. Ein Blick in die Vergangenheit kann – wie so oft – lohnen, um eventuelle Chancen und Risiken zu antizipieren.
Es ist nämlich kein neues Phänomen, dass Kunst auf neue Technik reagiert. Was die Musik angeht, findet man in der Geschichte immer wieder Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit neuen Technologien befasst haben. Einige sahen darin viel Positives, andere wiederum haben bewusst die Finger davon gelassen. Bei meinem Forschungsprojekt „Mensch Maschine Musik“, bei dem ich mich historisch mit dem Umgang mit neuen Technologien seitens von Künstlerinnen und Künstlern befasse, ist es mir deshalb besonders wichtig, meine Forschungsfragen und -ergebnisse auch einem breiteren Publikum begreifbar zu machen.
Worum geht es denn konkret in Ihrem Forschungsprojekt?
Es geht mir grob zusammengefasst darum, einen Überblick darüber zu geben, welchen Einfluss die Industrielle Revolution zwischen dem ausgehenden 18. und dem beginnenden 20. Jahrhundert auf die Musikkultur hatte. Dabei interessiert mich besonders, dass im Zuge dieser Revolution Körperkraft durch Maschinenkraft ersetzt wurde und dass das wiederum Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche der Menschen hatte. Im Mittelpunkt meines Projekts steht deshalb die Frage, wie sich dieses Ersetzen der körperlichen Arbeitskraft durch Maschinenkraft auf die Musikkultur ausgewirkt hat – Begriffe und Phänomene, die dabei eine wichtige Rolle spielen, sind Mechanisierung, Technisierung, Automaten und Marionetten.
Inwieweit kann denn Technologie aus Ihrer Sicht die Musik bereichern?
Als Jurymitglied des „Beats & Bits“-Wettbewerbs, bei dem die Teilnehmenden sehr unterschiedlich mit der Herausforderung umgegangen sind, KI-Programme in ihre Stücke zu integrieren, habe ich dafür ganz schöne Beispiele beobachten können. Eine Künstlerin hat beispielsweise eine KI mit ihrem Gesang gefüttert, um so neues Klangmaterial zu bekommen, das sie dann wiederum als Grundlage für ein Duett mit ihrer natürlichen Stimme benutzt hat. Solche KI-Stimmen können Dinge, die natürliche Stimmen nicht vermögen – zum Beispiel, ganz plakativ gesagt, einen Ton viel länger halten, als es einem Menschen möglich ist. Was eine KI nicht kann, ist Kreativität: Der Mensch muss sie weiterhin mit Inhalten füttern beziehungsweise künstlerisch mit ihr umgehen. Auch das konnte man beim Wettbewerb sehr gut sehen: Das Zusammenspiel zwischen KI und Komponierenden war für unsere Bewertung ein ganz entscheidendes Kriterium. Es geht eben nicht darum, dass Künstlerinnen und Künstler mit neuen Technologien in Konkurrenz treten oder gar durch sie ersetzt werden – was meines Erachtens auch gar nicht möglich ist –, sondern viel eher darum, dass neue Technologien Künstlerinnen und Künstlern dabei helfen, ihre Ideen umzusetzen – oder sie auf neue Ideen bringen.
Können Sie uns mehr über ein Kunstprojekt erzählen, das Sie im Rahmen Ihres Forschungsprojekts planen?
Zurzeit arbeite ich zusammen mit dem Berliner Choreografen Sebastian Matthias und dem Virtual-Reality-Team um Eckart Köberich von ZDF Digital an einer Mixed-Reality-Performance-Installation mit dem Titel „The Pétrouchka Experience“. Wir versuchen gemeinsam, eine über 100 Jahre alte Idee des Komponisten Igor Strawinsky, die mit der damaligen Technik noch nicht realisierbar war, mit aktuellen neuen Technologien erstmals zu verwirklichen. Strawinsky beschäftigte sich Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Frage, wie er die Tänzerinnen und Tänzer in seinen Ballettwerken mit Marionetten ersetzen könnte, um sie so in ihren Bewegungen besser kontrollieren zu können. Gleichzeitig fing er auch an, sich mit dem Pianola zu beschäftigen – einem selbstspielenden Klavier und der bahnbrechenden Musiktechnologie jener Zeit. Strawinsky interessierte sich dafür, weil er das Publikum in eine Art Rausch versetzen und ins Bühnengeschehen integrieren wollte. Eine denkende, selbständig agierende Person war hierfür als Akteur auf der Bühne weniger geeignet als eine bewusstlos agierende, von außen kontrollierbare, humanoide Figur.
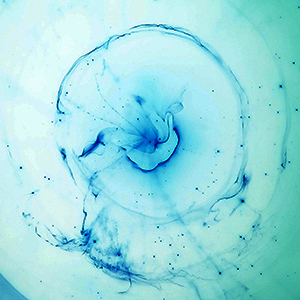
Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Kunst und Wissenschaft in diesem Projekt beschreiben?
Ich würde „The Pétrouchka Experience“ als ein Kunstprojekt beschreiben, das von einer Idee inspiriert worden ist, die auf neuesten musikwissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Wenn Kunstschaffende und Forschende auf Augenhöhe kommunizieren und zusammenarbeiten, können spannende Projekte wie dieses entstehen.
Wie kann man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler solche künstlerischen Kollaborationen anstoßen?
Was erhoffen Sie sich von diesen kollaborativen Projekten, sowohl für das Publikum als auch für die Projektbeteiligten?
Ich bin fest überzeugt davon, dass sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch Künstlerinnen und Künstler von diesem Austausch profitieren können. Im besten Falle entstehen neue Ideen, Fragestellungen und Erkenntnisse. Gerade die Geisteswissenschaften stehen gegenwärtig unter einem großen Legitimationsdruck, da leider allzu oft verkannt wird, was sie zu leisten im Stande sind. Dabei sind gerade diese oft schwer quantifizierbaren Disziplinen in unserer globalisierten, immer komplexer werdenden Welt unentbehrlich und lehren genau das, was wir unbedingt brauchen: nämlich kritisches Denken. Wenn ein Kulturprogramm es schafft, unterhaltend, hinterfragend und anregend zu sein und beiläufig Interesse an geisteswissenschaftlichen Inhalten fördert, wäre schon viel erreicht.






