Am Deutschen Institut für Japanstudien (DIJ) in Tokyo wird zum modernen Japan geforscht. Wie das Institut seine Wissenschaftskommunikation ausbauen will und was Deutschland und Japan voneinander lernen können, erklärt der Wissenschaftskommunikator des Instituts, Torsten Weber, im Interview.
„Man sollte nicht für sich beanspruchen, alles besser zu wissen“
Herr Weber, seit 1988 wird am Deutschen Institut für Japanstudien zum modernen Japan geforscht. Was ist die Mission des DIJ?

Als das DIJ Ende der 1980er Jahre gegründet wurde, herrschte in westlichen Gesellschaften die einhellige Meinung, dass Japan demnächst wirtschaftlich die ganze Welt beherrscht. Man wollte herausfinden, wie die Japaner*innen das machen, ihr wirtschaftlicher Erfolg, die Innovationskraft, dazu noch die höchste Lebenserwartung der Welt. Vor dem Hintergrund ist auch das DIJ gegründet worden. Kurze Zeit später platzte die wirtschaftliche Blase und man fand heraus, dass alles gar nicht so glänzend war, wie es schien. Doch das DIJ blieb erhalten und widmete sich nicht nur den Erfolgen, sondern auch den Schattenseiten und den Wandlungen der japanischen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Zuletzt ist auch die Beschäftigung mit Japan im globalen Kontext und transnationalen Verbindungen hinzugekommen. Neben der Forschung ist die Nachwuchsförderung und Ausbildung von Nachwuchswissenschaftler*innen ein zweiter großer Pfeiler der Mission des DIJ.
Sie forschen seit 2013 als Historiker am Institut und leiten zudem seit 2020 den Bereich Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Was sind Ihre Aktivitäten in dem Bereich?
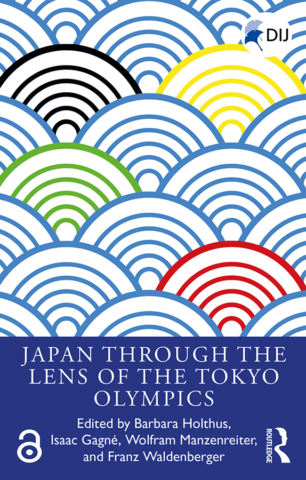
Nachdem die Öffentlichkeitsarbeit und vor allem auch die Wissenschaftskommunikation am DIJ lange eine untergeordnete Rolle gespielt haben, waren die ursprünglich für 2020 geplanten Olympischen Spiele in Japan ein Wendepunkt. Wir haben ein Projekt initiiert, das an eine breitere Öffentlichkeit gerichtet war und aus dem ein Open Access Buch entstanden ist. Das Projekt „Japan through the lens of the Tokyo Olympics“ rückte die Wissenschaftskommunikation in den Fokus und wir haben versucht, unser vorhandenes Repertoire in dem Bereich zu stärken. Unser zuvor analoger Newsletter erscheint nun digital und vierteljährlich. Wir haben Twitter zu einem Hauptmedium gemacht und unsere Kommunikation dort ausgebaut. Inzwischen sind wir auch auf LinkedIn aktiv und haben zielgerichtete Netzwerke zu Journalist*innen aufgebaut.
Im Sommer 2020 haben wir zudem unseren YouTube Kanal gestartet und stellen dort Vorträge, Diskussionsveranstaltungen und Interviews digital zur Verfügung. Insofern haben uns die Pandemie in Kombination mit den Olympischen Spielen einen digitalen Schub verliehen.

Darüber hinaus briefen wir regelmäßig Delegationen aus Deutschland, die sich in Japan über unterschiedliche Themen und Ansätze zur Lösung gesellschaftlicher Probleme informieren wollen. Hierfür stellen wir unser Netzwerk und unseren wissenschaftlichen Input zur Verfügung. In der Wissenschaftskommunikation bin ich natürlich auch abhängig davon, inwieweit unsere Wissenschaftler*innen bereit sind, mitzuwirken. Manche sind noch etwas verhalten, andere haben wiederum kein Problem damit, in die Öffentlichkeit zu treten. Ich sehe es als Teil meiner Arbeit, das Bewusstsein für Wissenschaftskommunikation unter den Wissenschaftler*innen unseres Instituts zu stärken, sie zu beraten und ihnen durch meine Aktivitäten zu helfen, selbst in dem Bereich aktiv zu werden.
Was sind die Zielgruppen eines deutschen Auslandsinstituts in Japan?
Im Prinzip definieren wir unsere Zielgruppe als ein globales, wissenschaftlich interessiertes Publikum und beschränken uns nicht nur auf die deutsche oder japanische Öffentlichkeit. Das hängt vor allem mit Englisch als Hauptsprache unserer Veröffentlichungen und Veranstaltungen zusammen. Wenn primär auf Englisch publiziert wird, dann muss auch die Wissenschaftskommunikation auf Englisch funktionieren.
Hinzu kommen Veranstaltungen und Publikationen für deutsch- oder japanischsprachige Zielgruppen. Hin und wieder nutzen wir für Veranstaltungen auch Simultanübersetzungen, die uns Zugang zu einem breiteren japanischen Publikum verschaffen und besonders den binationalen Austausch fördern.
Gibt es beim japanischen Publikum ein Interesse dafür, was deutsche Forschende über ihr Land herausfinden?
Ja, auf jeden Fall. Deutschland hat in Japan ein gutes Image. Es gibt sehr viele Japaner*innen, auch solche, die noch nie in Deutschland waren und kein Deutsch sprechen, die sich für Deutschland interessieren. Eben auch, weil die Gesellschaften gewisse Parallelen aufweisen. Der demografische Wandel ist ein klassisches Beispiel dafür. Am Institut beschäftigen wir uns vor allem mit dem gegenwärtigen Japan aus geistes- und sozialwissenschaftlicher Sicht. Unsere Forschungsbereiche umfassen die digitale Transformation, den demografischen Wandel, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Resilienz. Hinzu kommen aktuelle Themen wie der Umgang mit COVID-19 in Japan. Viele Japaner*innen interessiert, wie Deutschland mit diesen gesellschaftlichen Herausforderungen umgeht. Auch wenn der Blick auf Deutschland nicht zu unseren Kernkompetenzen zählt, berücksichtigen wir diese Nachfrage, weshalb viele unserer Veranstaltungen und Publikationen vergleichende Elemente beinhalten. Dazu gehört, dass wir beispielsweise Expert*innen, Praktiker*innen und Interessierte aus beiden Ländern zusammenbringen. Diese Vernetzungsfunktion entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mission. Schwieriger gestaltet es sich, wenn ausländische Forscher*innen den Japaner*innen Japan erklären möchten. Da muss man auch in der Wissenschaftskommunikation eine interkulturelle Sensibilität entwickeln und entsprechend vorsichtig und präzise kommunizieren. Aber natürlich sollte man selbstbewusst kommunizieren, wenn deutsche Forscher*innen wichtige Ergebnisse zu Japan erforscht haben. Man sollte jedoch nicht für sich beanspruchen, alles besser zu wissen oder eine Patentlösung für die Probleme des Landes gefunden zu haben.
Wie sieht die Wissenschaftskommunikationslandschaft in Japan aus und was können Deutschland und Japan im Vergleich voneinander lernen?
Aus meiner Perspektive sehe ich da vor allem Gemeinsamkeiten. Beide wissenschaftliche Communities haben sich von einer eher stiefmütterlich behandelten Öffentlichkeitsarbeit hin zu einer aktiveren Wissenschaftskommunikation bewegt. Seit 2010 bzw. 2012 gibt es in Japan zwei Fachgesellschaften, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen: Die Japanese Association for Science Communication und die Science Communication Society of Japan. Es gibt in beiden Ländern natürlich auch ähnliche Probleme. Wissenschaftler*innen haben viel zu tun und gerade in der Ausbildung gibt es andere Dinge, die eine höhere Priorität haben, als die Kommunikation der eigenen Forschung. Viele Nachwuchswissenschaftler*innen sind noch unsicher, wie sie kommunizieren sollen oder ob sie überhaupt schon kommunizieren dürfen. In beiden Ländern haben jedoch Forschungsförderungsinstitutionen angefangen, Wissenschaftskommunikation als Bestandteil von Förderungsanträgen einzufordern. Man muss sich Gedanken machen, wie man wieder etwas an die Gesellschaft, die das bezahlt, zurückgibt und mit ihr in einen Austausch tritt.
Welche künftigen Kommunikationsaktivitäten haben Sie für das DIJ geplant? Gibt es Formate oder Kanäle, die Sie in Zukunft angehen möchten?
Das ist zunächst natürlich eine Frage der zur Verfügung stehenden Ressourcen, also der Zeit, des Geldes und des Personals. Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation sind ein Fass ohne Boden. Es gibt immer wieder neue Kommunikationsideen oder ein neues Medium, das man noch dazu nehmen könnte. Mit nur einer Stelle für Wissenschaftskommunikation müssen wir uns zunächst darüber im Klaren sein, was unsere Prioritäten sind und welche Zielgruppen wir erreichen wollen. Wir sind seit Anfang 2023 nun auch auf LinkedIn und beobachten den Markt genau. Für mich ist aber wichtiger, verstärkt in bereits etablierten Medien aktiv zu werden, als immer noch weitere Medien hinzuzunehmen. Zum Beispiel wäre es schön, wenn wir unseren YouTube-Kanal weiter auszubauen könnten. Der Kanal ist 2020 mit Videos zu Olympia und COVID sehr erfolgreich gestartet. Da inzwischen aber wieder viele Events vor Ort stattfinden und die Produktion einen hohen technischen Aufwand erfordert, sind unsere Videos etwas in den Hintergrund getreten. Mein Eindruck ist, dass die Messlatte für vorzeigbare Produktionen mittlerweile auch ziemlich hoch liegt.
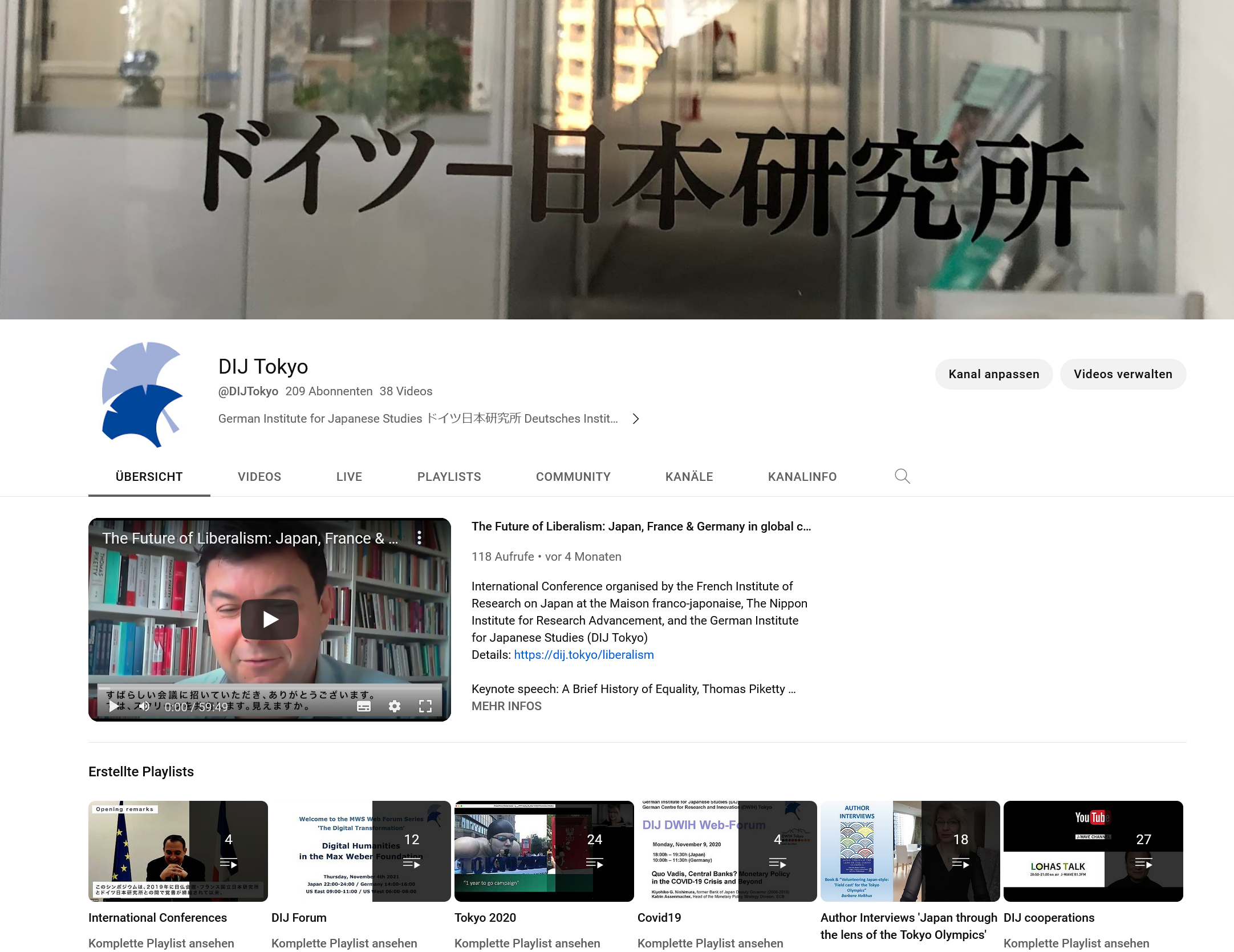
Ähnlich ist es bei Podcasts. Auch hier hat sich während der Pandemie viel getan: es gibt sehr viele Anbieter, und die Ansprüche an Qualität sind gestiegen. Wo es sich anbietet, wollen wir auch verstärkt Synergien mit der Öffentlichkeitsarbeit der Max Weber Stiftung nutzen, zu der wir seit 2002 gehören. Aus inhaltlichen, sprachlichen und zeitlichen Gründen gibt es hier aber auch Grenzen. Vieles können wir zielgerichtet und authentischer mit unserer Expertise aus Japan heraus selbst kommunizieren. In jedem Fall braucht es finanzielle und personelle Ressourcen, um vorzeigbare Ergebnisse zu produzieren. Damit spreche ich sicherlich für viele Institutionen, die ihre Forschung verstärkt kommunizieren wollen. Viele unserer Kollegen*innen arbeiten bereits am Limit, und nicht alle werden entsprechend ihrer wissenschaftlichen, redaktionellen und technischen Qualifikationen bezahlt. Wenn Geld für Wissenschaftskommunikation vorhanden ist, dann sollte man auch an das Personal denken, nicht nur an Material und Ausstattung.
Anmerkung der Redaktion: Michael Wingens war im Jahr 2014 als Praktikant am Deutschen Institut für Japanstudien tätig.









