Viele kennen sie als Influencerin in den sozialen Medien. Nun hat Amelie Reigl einen neuen Weg eingeschlagen. Im Interview erzählt sie, wie sie Unternehmensgründung, Wissenschaft und Social Media navigiert.
„Man muss darauf achten, nicht zu einem Werbeinstrument zu werden”
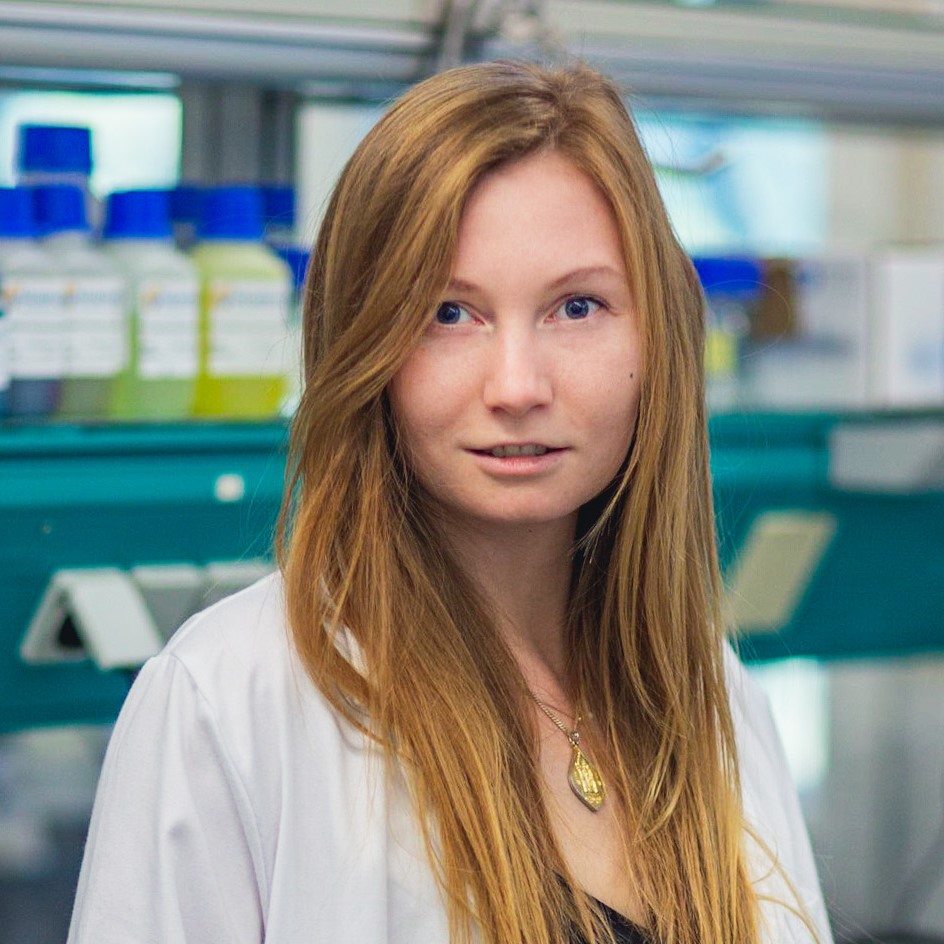
Frau Reigl, für Ihre Kommunikation als „@dieWissenschaftlerin“ auf TikTok und Instagram wurden Sie mehrfach ausgezeichnet und erhielten dafür viel Aufmerksamkeit in den Medien. Nun gründen Sie ein Start-up. Was hat Sie dazu bewogen, sich selbstständig zu machen?
Für mich war es sehr wichtig, mein Forschungsprojekt weiterführen zu können. Auch nach der Promotion. Dabei war es mir egal, ob das innerhalb der Universität oder in einem Unternehmen geschieht. Es hat sich herauskristallisiert, dass eine Ausgründung der beste Weg für mich ist. Gerade Fraunhofer bietet dafür das richtige Umfeld. Zusammen mit meinen Mitgründern Dieter Groneberg und Florian Groeber Becker plane ich das Start-up „TigerShark Science“. Wir züchten menschliche Haut, um Tierversuche zu reduzieren. Ziel ist es, Hautmodelle zu verkaufen, die der Kosmetik- und Pharmaindustrie eine bessere Forschung ermöglichen.
Das Fraunhofer AHEAD Programm unterstützt Sie und Ihre Kollegen bei der Gründung. Vor dieser Ausgründung hatten Sie aber bereits eine Firma für Wissenschaftskommunikation gegründet. Wie war dieser Prozess?
Das ist irgendwie ganz automatisch passiert. Meine Social Media Accounts sind immer weiter gewachsen, Unternehmen kamen auf mich zu und wollten mit mir kooperieren. Da habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich mich eben selbstständig. Ich habe eine Firma gegründet und habe jetzt auch ein Team, das mich unterstützt. Sonst hätte ich das neben der Promotion nicht geschafft.
War die erste Gründung eine Herausforderung?
Zum Glück hatte ich meinen besten Freund, der auch Tiktok macht (@BigBangBash) und Biologe ist. Er hat auch ein Unternehmen gegründet und ich bin dann hinterhergezogen. So konnte ich mich an ihn wenden, wenn ich Fragen hatte. Also wie man ein Kleinunternehmen anmeldet, wie man die Umsatzsteuer macht, wie man Steuerberater*innen findet und so weiter. Die Hemmschwelle war für mich ein bisschen niedriger, weil ich in meinem direkten Umfeld ein Vorbild hatte. Das habe ich gesehen und mich auch getraut.
Helfen Ihnen Ihre Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikation bei der Gründung des neuen Start-ups?
Ja, das hilft sehr. Zum einen weiß ich, wie ich für verschiedene Zielgruppen kommunizieren muss, zum Beispiel Investor*innen oder eben Wissenschaftler*innen. Das sind unsere Kund*innen, die unser Produkt kaufen. Zum anderen auch dadurch, dass ich bereits selbstständig bin und diesen ganzen Prozess von der Buchhaltung bis zur Teamzusammenstellung schon durchlaufen habe. Es ist also nicht komplett unbekannt für mich. Als Projektleiterin und zukünftige Geschäftsführerin kann ich das, was ich gelernt habe, anwenden.
Sie kommunizieren auf LinkedIn über Ihre Kooperationen mit Unternehmen wie Douglas, Biotherm, 3M und BRAND – welche Rolle spielen diese Partnerschaften mit Unternehmen für Ihre Arbeit?
Ich versuche Synergien von Kooperationen für die Wissenschaftskommunikation aber auch das geplante Startup zu entwickeln. Werbung mache ich nur für Unternehmen oder Produkte, hinter denen ich stehe, also die ich auch wirklich selber benutze – auch schon jahrelang unentgeltlich. Ich habe zum Beispiel eng mit der Universität Würzburg zusammengearbeitet, weil ich vom Bachelor bis zur Promotion hier war, und deshalb kann ich sagen, dass man hier sehr gut studieren kann. Das gilt auch für andere Marken.
Bei Kosmetik ist es mir wichtig, dass ich nicht einfach ein Produkt in die Kamera halte und sage, „Hier kauft es, ich benutze es auch“, sondern ich erkläre die Wirkstoffe. Auf einzelne Marken bin ich erst eingegangen, nachdem ich alle wissenschaftlichen Publikationen von ihnen erhalten habe. Wir haben über ihre Patente gesprochen, über die Herstellung der Wirkstoffe, die Nachhaltigkeit des Produkts. Und dann kann ich sagen, okay, nach der Recherche – das passt für mich. Das ist für mich persönlich sehr wichtig, mit wem ich zusammenarbeite. Ich habe viele Kooperationsanfragen abgelehnt, weil ich nicht hinter der Marke oder dem Produkt stehen kann.
Bei TikTok machen Sie unter anderem Videos über die richtige Hautpflege. Wann wird Wissenschaftskommunikation werblich und worauf muss man achten, um dies bei Kooperationen mit Unternehmen zu vermeiden?
Es ist ein Balanceakt zwischen wissenschaftlicher Integrität und werblichem Inhalt. Einerseits möchte man die Öffentlichkeit informieren und wissenschaftlich fundierte Informationen bereitstellen, andererseits muss man bei Kooperationen darauf achten, nicht einfach zu einem Werbeinstrument zu werden. Ich achte darauf Transparenz zu bewahren und offen zu kommunizieren, wenn es sich um eine bezahlte Partnerschaft handelt. Und dass ich nur Produkte oder Dienstleistungen vorstelle, hinter denen ich persönlich stehe und die ich für wertvoll halte. Und was mir besonders wichtig ist: Kritische Distanz zu wahren. Trotz Kooperationen eine unabhängige Sichtweise beizubehalten und wissenschaftliche Fakten objektiv darzustellen.
Hilft Ihre Präsenz in den sozialen Medien dabei, potenzielle Partner*innen oder Investor*innen für Ihr Start-up zu gewinnen?
Viele Investor*innen sagen, man muss 100% fokussiert sein und im Start-up arbeiten. Dass ich schon selbständig bin, wird tatsächlich auch kritisch gesehen. Obwohl es synergetisch ist! Man kann neue Kund*innen generieren, gerade über die große Sichtbarkeit. Aber ob die Präsenz in allen Bereichen sich positiv auswirken wird, kann ich noch nicht abschließend sagen – bis jetzt schon.
Sehen Sie sich denn in erster Linie als Wissenschaftlerin, Influencerin oder Unternehmerin?
Ich kann das gar nicht deutlich trennen. Ich merke, dass ich im Forschungsbereich auch unternehmerisch denke. Und bei Fachkonferenzen überlege ich auch genau, wie ich möglichst gut kommunizieren kann.
Gab es Situationen, in denen diese Rollen in Konflikt geraten sind?
Konflikt würde ich es nicht nennen. Ich bewege mich eher in drei verschiedenen Welten. In der Wissenschaft bin ich einfach eine Doktorandin. Wenn ich auf einer Konferenz bin, kennt mich ein Teil meines Netzwerks. Und dann gehe ich zu einer Veranstaltung, wo ich als Wissenschaftskommunikatorin eingeladen bin, und alle kennen mich. Das sind große Unterschiede, mit denen ich erst einmal klarkommen muss. Die Start-up-Szene ist wieder ganz anders. Das macht es spannend, es wird nicht langweilig.
Was können Ihrer Meinung nach Wissenschaft und Industrie voneinander lernen?
An der Uni finde ich die Strukturen teilweise veraltet und verstaubt. Doktorand*innen arbeiten mit 50 oder 65%-Stellen und müssen am Wochenende und an Feiertagen ins Labor. Das wird nicht bezahlt oder überhaupt wahrgenommen. Da wird es früher oder später Probleme für die Universitäten geben, gute Mitarbeitende zu bekommen und zu halten. Ich habe auch manchmal mit mir gerungen, ob ich jungen Leuten überhaupt empfehlen soll eine Promotion zu machen. Sie bekommen weniger Geld, sind die ganze Zeit im Labor. In der Industrie verdient man gefühlt das Doppelte und hat einen Nine-to-Five-Job.
Natürlich gibt es auch Nachteile in der Industrie. Es gibt nicht diese Freiheit. Man hat ein Projekt, das muss abgearbeitet werden. Die Auftraggeber*innen wollen vielleicht das eine, aber das andere wäre wissenschaftlich interessanter oder sinnvoller. Ich würde mir wünschen, dass die Industrie einen gewissen Prozentsatz ihres Umsatzes für Projekte ausgibt, die vielleicht nicht sofort verwertbar sind. So könnte ein Stück universitäre Freiheit in die Industrie getragen werden und andererseits die verstaubten Strukturen an den Universitäten mit Hilfe von „New Work“ verändert werden.
Wie könnte das aussehen?
Wir haben bei Fraunhofer so genannte „Working Spaces“, wo niemand einen festen Platz hat. Dadurch entstehen neue Kooperationen innerhalb unseres Instituts, weil die Studierenden miteinander reden. Und es gibt Doppelspitzen, das heißt, es gibt nicht nur eine Person, die eine Arbeitsgruppe oder eine Organisationseinheit leitet. Das funktioniert super und nimmt ein bisschen den Druck raus. Das würde ich mir auch für die Universität wünschen. 
Problematisch finde ich auch, dass es an Universitäten nur einen Weg gibt. Stichwort Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Entweder du wirst Professor*in oder du fliegst raus. Manche Forschende wollen aber nicht Professor*innen werden, sondern würden lieber weiter im Labor arbeiten. Aber auf diesem Niveau könne Forschende nur selten bleiben, weil es nur wenige unbefristete Stellen an den Universitäten gibt. Entweder man wird hochgepusht oder man fliegt raus. Das könnte man anpassen, analog zur Industrie.






