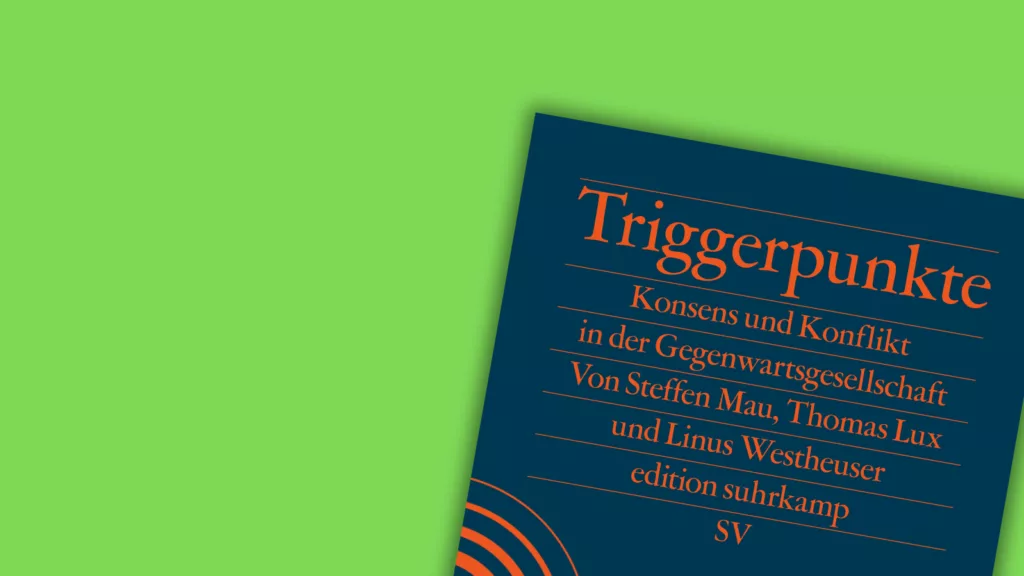Mit „Triggerpunkte“ veröffentlichten Steffen Mau und seine Kollegen einen Bestseller. Ob er damit den gewünschten gesellschaftlichen Impact erreicht hat und wie es aus seiner Sicht um die Wissenschaftsfreiheit steht, erklärt der Soziologe im Interview.
„Man muss aufpassen, nicht zum Orakel zu werden“
Freiheit und Verantwortung sind zentrale Konzepte, die den Kern wissenschaftlicher Arbeit und der Wissenschaftskommunikation berühren. In dieser Reihe beleuchten wir aktuelle Debatten um die Wissenschaftsfreiheit, das Erstarken populistischer Bewegungen und das Ringen um konstruktive Dialoge zwischen Interessengruppen.

Herr Mau, im Podcast „Jung und Naiv“ mit Thilo Jung sprechen Sie über das Privileg, sich aufgrund des Leibniz-Preises mit den Themen befassen zu können, die Ihre Neugier wecken. Was bedeutet für Sie persönlich Wissenschaftsfreiheit?
Wissenschaftsfreiheit sehe ich in der Autonomie bei der Themensetzung, bei der freien Wahl theoretischer Ansätze, Methoden und in der wissenschaftlichen Diskursform. Natürlich gibt es auch Aspekte, die nicht frei wählbar sind, wie die Orientierung an wissenschaftlichen Standards, die Notwendigkeit eines wissenschaftlichen Vokabulars oder die Tatsache, dass man wissenschaftliches Wissen – im Gegensatz zu Meinungsäußerungen – auch rechtfertigen muss.
Die verbindlichen Grenzen von Wissenschaftsfreiheit liegen also einerseits in unserer Rechtsordnung, andererseits, dass man jede These im Kontext einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung vertreten können muss. Es gibt keine Bedingtheit des wissenschaftlichen Wissens. Das gilt vor allem auch für die Soziologie, in der es keine Fallgesetze oder objektiven Untersuchungsgegenständen gibt, sondern die Gesellschaft selbst der Forschungsgegenstand ist. Die große Freiheit meiner persönlichen Situation ist, dass ich eine unbefristete Stelle habe und nicht so sehr durch Projektförderung eingeschränkt bin.
In Deutschland, so könnte man es der derzeitigen Debatte entnehmen, ist die Wissenschaftsfreiheit bedroht. Folgen Sie dieser Einschätzung, oder ist diese Debatte selbst geprägt von Triggerpunkten, während sich eigentlich alle einig sind?
Das kann man nicht eindeutig sagen. Die Wissenschaft selbst ist ja Teil von umkämpften Werten und Normendiskursen. Es gibt eine Politisierung von Teilen der Wissenschaft in zwei Richtungen. Einerseits gibt es ein aktivistisches Wissenschaftsverständnis, bei dem bestimmte politische Grundüberzeugungen und damit verbunden auch politische Ziele in die wissenschaftliche Praxis einfließen. Die Wissenschaft wird damit Mittel zum Zweck.
Andererseits gibt es natürlich auch den Diskurs um Wissenschaftsfreiheit, der von konservativen oder zum Teil auch rechten Gruppen geführt wird. In diesem Zuge gibt es eine Zurückweisung bestimmter Wissenschaftsbereiche, sei es Migrationsforschung oder Genderforschung. Entweder indem unterstellt wird, eine Disziplin sei nicht wissenschaftlich genug oder durch die grundsätzliche Ablehnung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Beides ist nicht unproblematisch, weil aus meiner Sicht in beiden Fällen die Politisierung der Wissenschaft sukzessive voranschreitet. In Deutschland sehe ich aber bislang keine grundlegende Infragestellung des wissenschaftlichen Systems und damit auch der Wissenschaftsfreiheit.
Was ist aus Ihrer Sicht die größere Gefahr?
Schwieriger finde ich die ganze Thematik rund um Fake News, Desinformationen und alternative Wahrheiten. Hier kann man sehen, dass es offensichtlich in der Bevölkerung Gruppen gibt, die sich einem völlig anderen Wissensverständnis oder Vorstellungen von Evidenz verschreiben.
Interessanterweise argumentieren auch diese Gruppen häufig mit wissenschaftlich anmutendem Vokabular – denken Sie an die Corona-Pandemie – sind jedoch völlig abgekapselt vom wissenschaftlichen Betrieb. Die Wissenschaft ist heute viel mehr als nur ein System, das Wissen generiert. Stattdessen hat sie in vielen Bereichen eine unmittelbare Wirkung in die Gesellschaft und sorgt für grundlegende Infragestellungen von Dingen. Zum Teil werden wissenschaftliche Diskurse eins zu eins in die Öffentlichkeit übertragen, sodass in dieser der Eindruck entsteht, man könne zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Thesen wählen, die zur eigenen Grundüberzeugung passen. Wissenschaftler*innen sollten transparent kommunizieren, ob man sich mit einer politischen Meinung zu Wort meldet, oder ob man wirklich im Sinne einer wissenschaftlichen Position argumentiert.
Auch Ihr Buch „Triggerpunkte“ wurde intensiv diskutiert und hat zahlreiche Debatten ausgelöst. Haben Sie damit den gesellschaftlichen Impact erreicht, den Sie sich erhofft haben?
Wir hatten zunächst keine explizite Zielvorstellung im Hinblick auf den gesellschaftlichen Impact des Buches. Wir wollten einfach ein interessantes Buch schreiben und waren stark von unserer wissenschaftlichen Neugierde geleitet. Gleichzeitig haben wir uns natürlich schon bewusst überlegt, das Buch einem Publikumsverlag anzubieten, durch den eine gewisse Sichtbarkeit erreicht werden kann. Die Zusammenarbeit mit einem Lektor gab uns zudem die Möglichkeit, das Buch zugänglicher, flüssiger und auch ansprechender zu gestalten.
Dass aber so viele Menschen etwas mit dem Buch anfangen können und unterschiedliche Inhalte gesellschaftlich diskutiert und weiterverarbeitet werden, finde ich nach wie vor überraschend und keine Selbstverständlichkeit. Das scheint daran zu liegen, dass das Buch eine wissenschaftlich fundierte Perspektive anbietet, die eher kontraintuitiv ist und sich gegen Alltagsmythen wendet, was in der Bevölkerung oder interessierten politischen Kreisen auf Interesse stößt. In Zeitungsartikeln und Podcasts wurde schnell auf die Publikation reagiert. In einer zweiten Welle folgt nun die wissenschaftliche Reaktion. Darin steckt für uns auch noch einmal eine Menge wichtiges Feedback.
Welche Rolle kann die Wissenschaft – insbesondere die Soziologie – in einer Zeit spielen, in der Emotionen oft die öffentliche Debatte dominieren?
Die Soziologie ist schon immer eine Art Krisenwissenschaft gewesen, indem sie sich mit den großen gesellschaftlichen Umbrüchen und Transformationsprozessen beschäftigt. In Zeiten, in denen grundlegende Gewissheiten aus den Angeln gehoben werden, steigt der Erklärungsbedarf exponentiell an. Man muss aber Acht geben, keine aktualistische Forschung zu betreiben, die den gesellschaftlichen Diskursen hinterherläuft oder sich hier anbiedert.
Was ist also die Funktion der Wissenschaft? Einerseits gebe ich als Wissenschaftler Deutungsangebote vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dabei kommuniziert man nicht nur die eigenen Forschungsergebnisse, sondern bettet sie in eine wissenschaftliche Auseinandersetzung ein. Zum anderen liegt die Funktion der Wissenschaft in der Sach- und Faktenbezogenheit. Es geht nicht nur um die Präsentation von Thesen, sondern auch um die Begründung und um die empirische Unterfütterung, um die Fragen der methodischen Qualität sowie um eine ernsthafte Reflexion über bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse.
Was sind die Grenzen der Wissenschaft in der Gestaltung der Gegenwart?
Mittelfristig muss man wahrscheinlich auch Erwartungen enttäuschen, da eine tendenzielle Überforderung bereits angelegt ist. Das merke ich insbesondere im Zusammenspiel mit der Politik. Von politischer Seite werden oft Rezepte für bestimmte Lösungen gewünscht; da muss man als Wissenschaftler*in bremsen. Man muss aufpassen, nicht zum Orakel zu werden. Die politische Verarbeitung unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse muss immer auch Teil eines öffentlichen Diskurses sein.
In Ihrem Buch sprechen Sie auch über den „Debattenzirkus“ und die radikalisierten Konflikte in den sozialen Medien. Wie können wir als Gesellschaft mit dieser Kompromisslosigkeit und Polarisierung umgehen?
Es ist wahnsinnig schwierig, das zu regulieren. Es gibt ja durchaus Versuche, über Bots oder andere technische Mittel Diskussionen in den sozialen Medien zu moderieren und Leute dazu aufzufordern, einen stärkeren Sachbezug herzustellen. Ob sich wirklich eine konstruktive Öffentlichkeit in den sozialen Medien herstellen lässt, ist die große Frage. Ich glaube, dass wir mehr Gesprächsforen und -formate brauchen, in denen sich Menschen mit unterschiedlichen Meinungen austauschen können, die wie Proberäume für den öffentlichen Diskurs funktionieren. 
Während viele Wissenschaftler*innen und Institutionen Plattformen wie X verlassen haben, sind Sie dort weiterhin aktiv. Betrachten Sie sich selbst als Beobachter des „Debattenzirkus“ oder als aktiven Teilnehmer?
Ich bin eher ein zurückhaltender Teilnehmer. Viele Social-Media-Aktivitäten habe ich deutlich reduziert. X nutze ich primär als Informationskanal. Ich retweete spannende Informationen oder mache auf meine eigene Forschung oder die Forschung von Kolleg*innen aufmerksam. Ich möchte mich nicht als Meinungsschleuder im Internet betätigen und auch kein politisierter Wissenschaftler sein, der versucht, zu allem und jedem seine Meinung kundzutun.
Dieser Beitrag wurde redaktionell unterstützt von Jana Fritsch.