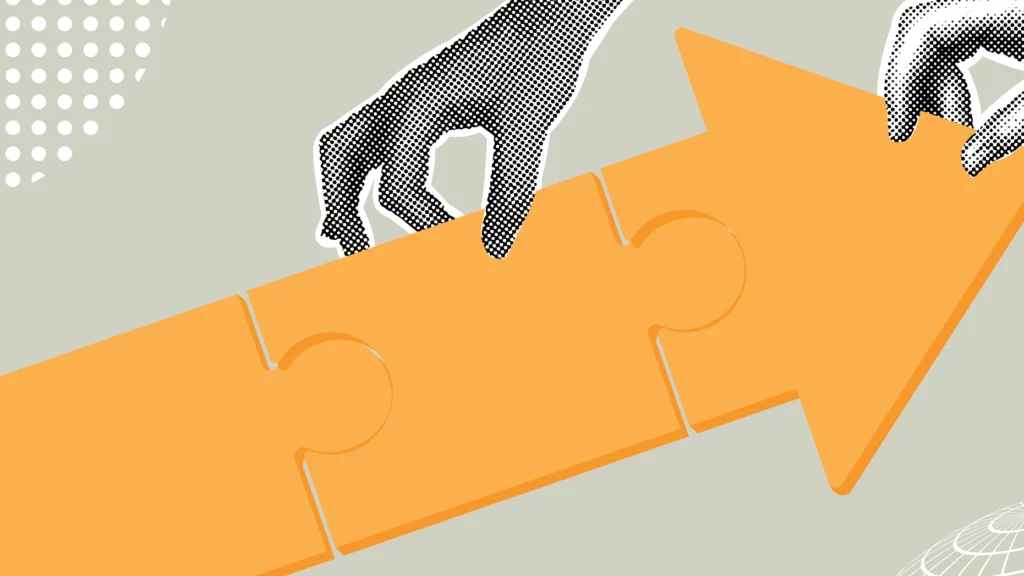Wie schlechte Tonqualität der Wissenschaftskommunikation schadet und warum persönliche Angriffe auf Forschende auch ihre wissenschaftliche Arbeit abwerten: Das sind die Themen im Forschungsrückblick.
Kurz vorgestellt: Neues aus der Forschung im März 2018
In dieser Rubrik besprechen wir regelmäßig neue Ergebnisse aus der Forschung zur Wissenschaftskommunikation. Sollten Sie etwas vermissen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder hinterlassen Sie einen Kommentar.
Unverständlich = unwichtig?
Ob in Videos von Vorträgen und Vorlesungen, in Podcasts oder Radio-Interviews: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kann man heute oft direkt zuhören, statt nur Texte über sie zu lesen. Die Psychologen Eryn Newman (Australian National University) und Norbert Schwarz (University of Southern California) wollten in einer neuen Studie herausfinden, ob sich bei solchen Aufnahmen die Tonqualität darauf auswirkt, wie die Zuhörer die Forschung bewerten.
Methodik: Für das erste Experiment bearbeiteten die Forscher zwei Mitschnitte von Vorträgen aus der Physik und der Ingenieurwissenschaft so, dass die Tonqualität entweder sehr schlecht war oder aber klar und deutlich. Die 97 Versuchspersonen sahen kurze Ausschnitte aus je einem Video mit gutem und einem mit schlechtem Sound. Anschließend sollten sie sowohl den Vortrag selbst als auch den Vortragenden einschätzen. Im zweiten Experiment wiederholten die Autoren dieses Vorgehen mit zwei Interviews mit Forschenden aus Physik und Genetik, die in einer renommierten US-Radiosendung über Wissenschaft (Science Friday) ausgestrahlt worden waren.
Ergebnisse: Sowohl für die Vortragspassagen als auch für die Radiointerviews galt: Probanden, die dem Wissenschaftler in besserer Tonqualität zuhörten, hielten seine Rede oder das Interview für ansprechender als jene Teilnehmer, die denselben Mitschnitt in schlechter Audioqualität hörten. Zudem bewerteten die Versuchspersonen Forscher, die akustisch gut verständlich waren, als intelligenter und sympathischer – und ihre Forschung als wichtiger. Das galt auch, wenn man nur jene Probanden betrachtete, die den Vortrag anschließend inhaltlich zusammenfassen konnten. Der Effekt ist also nicht etwa darauf zurückzuführen, dass die Vorträge durch die Tonqualität völlig unverständlich wurden.
Schlussfolgerungen: Die technische Qualität einer Aufnahme entscheidet in der audiovisuellen Wissenschaftskommunikation mit darüber, wie die Zuhörer einen Wissenschaftler und dessen Forschung einschätzen. Eine Vielzahl psychologischer Studien zeigte bereits, dass eine Botschaft auf die Empfänger umso weniger glaubwürdig wirkt, je schwerer sie zu verstehen ist. Die Rezipienten unterscheiden dabei generell nicht, ob die Verständnisprobleme inhaltlicher Natur sind oder ob sie bloß von formalen Faktoren herrühren wie einer schlecht lesbaren Schrift, einem schwachen Kontrast bei Texten oder eben der Tonqualität.
Einschränkungen: Die Schlussfolgerung basiert nur auf vier Ausschnitten von Vorträgen und Interviews aus drei wissenschaftlichen Disziplinen. Zudem berichten die Forscher zwar, mit welchem Programm und welchem Filter sie die Tonspuren bearbeitet haben, ein Hörbeispiel für ihr Versuchsmaterial bleiben sie aber schuldig. Daher lässt sich nicht persönlich beurteilen, wie unverständlich die Tonqualität war. Die Autoren spekulieren zudem – basierend auf früheren Studien –, dass sich die Effekte schlechten Sounds abmildern ließen, indem man die Hörer vorab auf den Mangel hinweist. Dann könnten die Rezipienten ihre Verständnisprobleme eher auf die Technik attribuieren und nicht auf den Inhalt. Die Wirkung eines solchen Disclaimers wäre durchaus interessant, wurde in der Studie jedoch nicht untersucht.
Angriff auf den Forscher, Angriff auf die Forschung?
Kritik an wissenschaftlichen Erkenntnissen kann auf sachlicher Ebene formuliert werden – oder durch Attacken „ad hominem“, also mit Argumenten, die auf die Person des Forschenden selbst abzielen, beispielsweise auf dessen moralische Integrität. Eine Gruppe von Psychologen um Ralph Barnes (Montana State University) untersuchte nun, ob solche persönlichen Angriffe auf eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler auch die Beurteilung ihrer Forschungsarbeit beeinflussen.
Methodik: 638 Versuchspersonen lasen jeweils eine Reihe von wissenschaftlichen Befunden, von denen manche mit Zusatzinformationen versehen waren. Einige dieser ergänzenden Texte stellten die wissenschaftliche Korrektheit der Studie infrage, etwa mit dem Hinweis, dass die Untersuchung methodische Schwächen aufweise oder vermutlich auf gefälschten Daten basiere. In anderen Erläuterungen wurde dagegen die Person der Forscherin oder des Forschers diskreditiert. So wurde zum Beispiel behauptet, dass er oder sie in früheren Experimenten bereits der Datenfälschung überführt worden sei, oder dass ein Beratervertrag mit einer Firma bestehe, die dank dieser Forschung nun besser dasteht.
Ergebnisse: Hinweise auf unsauberes wissenschaftliches Arbeiten führten erwartungsgemäß dazu, dass die Probanden eine Erkenntnis eher ablehnten. Dasselbe galt jedoch – und zwar in gleichem Maße –, wenn die Teilnehmer Informationen über einen möglichen Interessenkonflikt oder früheres Fehlverhalten der Forschenden erhielten. Lediglich wenn in den Zusatztexten erwähnt wurde, dass die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler von einer wenig angesehenen Universität kommt oder unter Kollegen nicht den besten Ruf genießt, hatte das keinen nennenswerten Effekt auf die Beurteilung der Forschungsarbeit.
Schlussfolgerungen: Die persönliche Integrität einer Forscherin oder eines Forschers infrage zu stellen, etwa durch den Hinweis auf Geschäftsbeziehungen zur Industrie, hat auf Rezipienten denselben Effekt wie eine Kritik der wissenschaftlichen Arbeit selbst. Dies könne beispielsweise erklären, weshalb der Verweis auf Interessenkonflikte von Ärzten unter Impfgegnern sehr populär und erfolgreich sei, meinen die Autoren.
Einschränkungen: Die erfolgreichen Angriffe „ad hominem“ bezogen sich auf ein bereits erfolgtes wissenschaftliches Fehlverhalten oder auf eine reale wirtschaftliche Beziehung zwischen Forscher und Untersuchungsobjekt. Es handelt sich damit um inhaltlich substanzielle und auch recht wissenschaftsnahe Attacken. Viel relevanter im täglichen Diskurs, zum Beispiel in den sozialen Medien, dürfte dagegen persönliche Angriffe sein, die sich auf eine ideologische Motivation (oder ideologische „Scheuklappen“) von Forschenden beziehen oder auf andere, eher persönliche Merkmale. Wie erfolgreich solche Unterstellungen sind, beantwortet die Studie nicht.