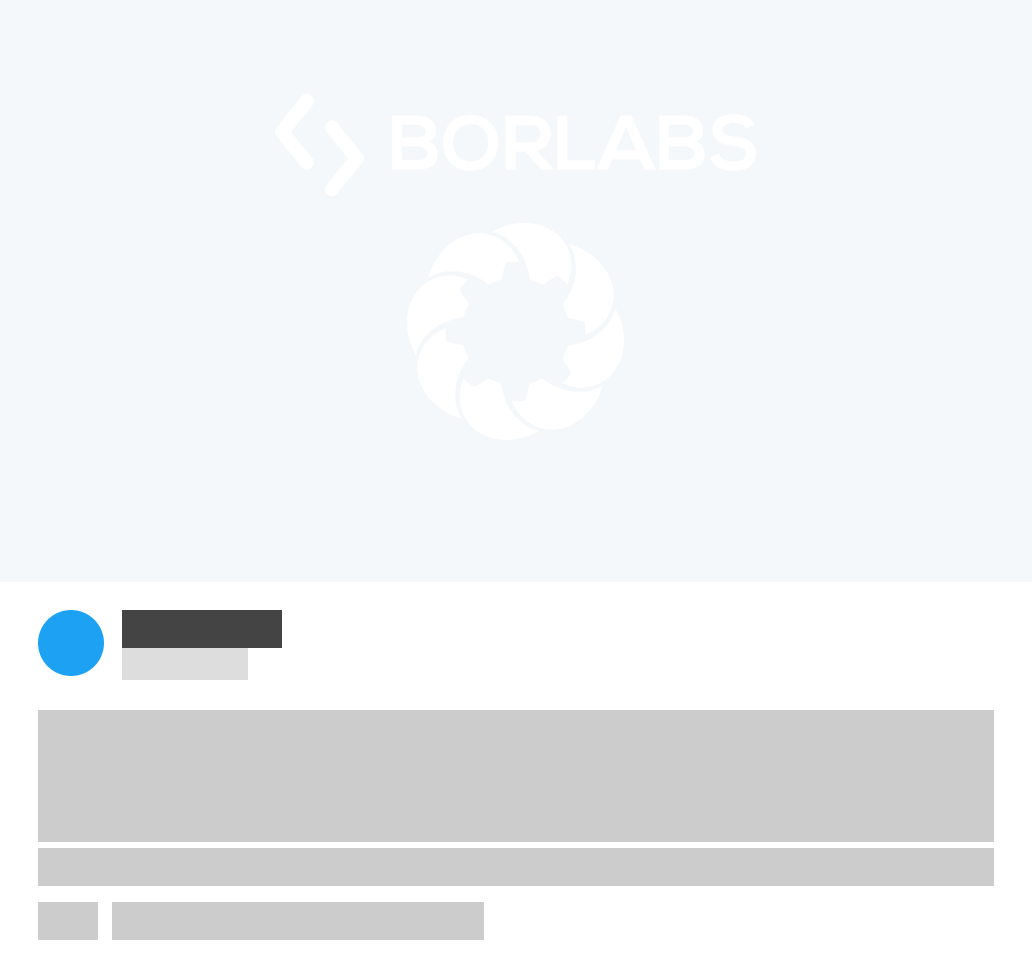Wodurch zeichnet sich Authentizität in der Wissenschaftskommunikation aus? Verfängt Trumps Medienbashing auf Twitter beim Publikum? Und wie professionell sind Wissenschaftsvideos auf Youtube? Damit beschäftigen sich die Studien im aktuellen Forschungsrückblick.
Kurz vorgestellt: Neues aus der Forschung im Januar 2020
In dieser Rubrik besprechen wir regelmäßig neue Forschungsergebnisse zum Thema Wissenschaftskommunikation. Sollten Sie etwas vermissen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder hinterlassen Sie einen Kommentar.
Wann wirken Forschende authentisch?
Wenn es darum geht, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst über ihre Forschung kommunizieren sollen, fällt schnell das Schlagwort Authentizität. Was dieser Begriff in der Wissenschaftskommunikation bedeutet und wie Forschende sich authentischer präsentieren können, wollte ein Team um Lise Saffran von der University of Missouri in einer kürzlich erschienenen Studie herausfinden.
Methodik: Die Wissenschaftlerinnen testeten verschiedene Strategien, authentisch zu erscheinen, und deren Wirkungen mit Hilfe einer zeitgleich entwickelten Skala zur Messung der wahrgenommenen Authentizität von Forschenden. 432 Versuchspersonen lasen einen kurzen Forschungsbericht, entweder in Form einer unpersönlich-sachlichen Mitteilung oder in Ich-Form durch eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler beschrieben. Für letztere wiederum gab es verschiedene Varianten: Eine war die bloße Umwandlung des Berichts aus der Botanik in die erste Person (also statt „Forschende möchten mehr darüber herausfinden“ etwa „Ich wollte mehr darüber herausfinden“). Eine weitere wurde durch eine Erklärung ergänzt, warum sich der oder die Forschende persönlich für diese Fragen interessierte. Und in den anderen beiden Fassungen nannte der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin noch Gründe für wissenschaftliche Unsicherheit: Dass er oder sie sich in früheren Befunden geirrt habe, oder dass weitere Pflanzenfunde die Ergebnisse revidieren könnten.
Ein Vergleich der verschiedenen Botschaften ergab, dass die Mitteilung aus der Ich-Perspektive den Absender oder die Absenderin authentischer wirken ließ, als wenn in dritter Person über die Forschung berichtet wurde. Am günstigsten war es, wenn dabei auch erwähnt wurde, aus welchen persönlichen Gründen er oder sie sich für diese Forschungsfrage interessierte. Wurde dagegen wissenschaftliche Unsicherheit in den Erzählungen aus erster Hand thematisiert, brachte das dem Absender oder der Absenderin keinen Authentizitäts-Bonus gegenüber einem neutralen Bericht aus Beobachterperspektive.
Schlussfolgerungen: Authentizität entstehe, so Saffran und Kolleginnen, wenn die kommunizierende Person als ein Mensch mit eigener Geschichte, eigenen Werten und einem eigenen Standpunkt rüberkomme, und wenn die Botschaft mit alldem im Einklang stehe. Vor allem die persönliche Geschichte dazu, warum man sein eigenes Forschungsfeld spannend findet, förderte dabei die wahrgenommene Authentizität von Forschenden.
Einschränkungen: Ich-Botschaften ließen den Sprecher nicht authentischer erscheinen, wenn er oder sie zugleich wissenschaftliche Unsicherheit thematisierte. Die Gründe dafür müssten in weiteren Studien erforscht werden, schreiben die Autorinnen. Es sei aber generell leichter, eine konkrete Geschichte darüber zu erzählen, warum man sich für sein Forschungsfeld interessiert, als komplexe und abstrakte Themen wie Unsicherheit anzusprechen. Aufgrund der Vielschichtigkeit von Narrationen müsse der Versuch noch mit weiteren Varianten, Authentizität zu vermitteln, wiederholt werden.
Gehen Trumps Angriffe auf die Medien nach hinten los?
Der Begriff „Fake News“ ist erst mit Donald Trump richtig populär geworden. Der 45. Präsident der USA bezichtigt mit Vorliebe solche Medien der Verbreitung von Unwahrheiten, die hierzulande als durchaus seriös gelten, wie die New York Times oder die Washington Post. Wie wirken sich solche Unterstellungen auf die öffentliche Meinung zu diesen Medien und ihren Artikeln aus? Dieser Frage sind Forschende um den Kommunikationswissenschaftler Daniel Tamul von der Virginia Tech University nachgegangen.
Methodik: Ein Teil der 1.588 Versuchspersonen bekam zunächst 30 Tweets angezeigt, in denen Trump seinem Ärger über angebliche Fake News in den ihm verhassten Medien Luft gemacht hatte. Anschließend sollten sie einen von drei Texten lesen: Ein Artikel beschrieb die verheerende Situation auf Puerto Rico (einem Außengebiet der USA) nach Hurrikan Maria – was zwischen den Zeilen als Kritik an Trumps Krisenmanagement gelesen werden konnte, auch wenn der Präsident mit keinem Wort erwähnt wurde. Der zweite Text war eine veränderte Version des Artikels, in dem ausschließlich Fakten über den Hurrikan referiert wurden, aber keine persönlichen oder emotionalen Geschichten vorkamen. Die Kontrollgruppe schließlich las einen Auszug aus einer Kurzgeschichte. Zuletzt beantworteten die Teilnehmenden Fragen unter anderem zur Glaubwürdigkeit der Geschichte und zu ihren Einstellungen gegenüber den Menschen, die vom Hurrikan betroffenen waren.
Ergebnisse: Wer durch die Trump’schen Tweets auf das Thema Fake News aufmerksam gemacht worden war, zeigte anschließend eine generell skeptischere Einstellung – gegenüber Medienberichten, aber auch gegenüber Verlautbarungen von Politikerinnen und Politikern. Bezogen auf den konkreten Beitrag über Hurrikan Maria aber zeigte sich, dass Personen, die die Tweets gelesen hatten, sowohl den Artikel selbst als auch die Autorin als glaubwürdiger einschätzten. Je mehr Fake-News-Tweets sie gelesen hatten, desto stärker waren sie der Meinung, die Regierung müsse mehr für die Opfer des Hurrikans tun, und desto eher wollten sie gern weitere Nachrichtenbeiträge dieser Art lesen.
Schlussfolgerungen: Diesen Ergebnissen zufolge hat das laute Beschweren über Fake News genau den gegenteiligen Effekt: Zwar hinterfragt das Publikum anschließend offenbar Medienbeiträge kritischer – gleiches gilt aber auch für Wortmeldungen aus der Politik. Je mehr Tweets von Donald Trump die Teilnehmenden lasen, desto mehr vertrauten sie jedoch anschließend einem journalistischen Beitrag. Möglicherweise, so die Forschenden, komme hier das Bedürfnis zum Tragen, sich nicht vorschreiben zu lassen (in diesem Fall: von Trump), was man über eine bestimmte Sache denken soll, weshalb man diese erst recht positiv bewertet.
Einschränkungen: Auch wenn die Ergebnisse eine deutliche Tendenz zeigen, so spielten die politischen Überzeugungen der Teilnehmenden doch eine Rolle – konservative Versuchspersonen waren generell weniger positiv gegenüber Hilfen für Puerto Rico gestimmt als Anhänger der demokratischen Partei. Es wurde zudem nicht kontrolliert, wie die Teilnehmenden speziell zu Donald Trump und seinen Fake-News-Vorwürfen gegenüber liberalen Medien stehen. Zudem geben die Forschenden um Tamul zu bedenken, dass Trumps Äußerungen zwar in dieser Untersuchung kontraproduktiv wirkten, sie deshalb aber trotzdem nicht unproblematisch seien: Sie könnten dennoch den politischen Diskurs vergiften und die Einstellungen der US-Bevölkerung zu Medien langfristig verschieben.
Wissenschaft auf Youtube: Stetige Professionalisierung
Fünfzehn Jahre sind vergangen, seit Youtube-Mitbegründer Jawed Karim im ersten Videobeitrag auf der Plattform, „Me at the zoo“, über den langen Rüssel von Elefanten im Zoo von San Diego sinnierte. Seitdem zeichnet das Portal eine stetige Professionalisierung und Kommerzialisierung aus. Doch gilt das auch für Webvideos über Wissenschaft? Das untersuchten Forschende um Jesús Muñoz Morcillo, derzeit am Getty Research Institute in Los Angeles, in einer aktuellen Studie.
Methodik: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten 95 Youtube-Kanäle, die zum Zeitpunkt der Datensammlung (2015) zu den beliebtesten in der Kategorie „Wissenschaft & Bildung“ gehörten, und die entweder auf Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Deutsch oder Italienisch sendeten. Davon wählten sie jeweils das älteste und das neueste verfügbare Video aus. Auf Grundlage dieser Clips analysierten sie in einer Inhaltsanalyse verschiedene Merkmale der Kanäle: ihre Professionalität – wozu unter anderem die Audio- und Videoqualität gehörten –, das Geschlecht der Präsentierenden und ihr ungefähres Alter sowie die Verwendung von Links.
Schlussfolgerungen: Die herkömmliche Unterscheidung zwischen UGC und PGC, also „user-generated content“ (von Nutzern produziertes Material) und professionell hergestellten Videos, verliert laut dem Team um Muñoz Morcillo bei Wissenschaftsvideos an Bedeutung. Manche großen und ressourcenstarken Institutionen könne man im Bereich Webvideo als „Amateure“ bezeichnen, weil etwa die Schnitt- und Erzählqualitäten in ihren Beiträgen unterdurchschnittlich seien. Andererseits zeige die Analyse, dass auch Produzentinnen und Produzenten, die nur unregelmäßig Videos auf mitunter niedrigem technischen Niveau posteten, mit dem Kanal offenbar Geld verdienen wollten. Bemerkenswert sei außerdem, wie stark Frauen in der Welt der Wissenschafts-Webvideos nach wie vor unterrepräsentiert seien.
Einschränkungen: Die Untersuchung liefert einen Schnappschuss der populärsten Wissenschafts-Youtubekanäle aus dem Jahr 2015 – der mittlerweile möglicherweise schon wieder veraltet ist. Die Forschenden legen leider auch nicht offen, wie genau sie die „weichen“ Kriterien für Professionalität, wie Montage und Erzählstruktur, analysiert haben. Da nur besonders populäre und einflussreiche Kanäle untersucht wurden, ist auch unklar, inwieweit die Ergebnisse auf Wissenschafts-Webvideos im Allgemeinen zutreffen.
Mehr Aktuelles aus der Forschung:
Welche Rolle spielen religiöse Überzeugungen von Forschenden, wenn es um ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit geht? Laut einer neuen Studie aus den USA halten atheistische Probandinnen und Probanden Forschende, die ebenfalls nicht religiös waren, für vertrauenswürdiger. Bürgerinnen und Bürger, die sich zum Christentum bekennen, beurteilten dagegen Forschende positiver, die einer Religion angehören – egal, ob Christentum, Judentum oder Islam.
Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sammeln eine Menge wertvoller Daten, wie Forschende der Michigan State University in einer aktuellen Untersuchung zeigen. Bei der Analyse einer großen Forschungsdatenbank (zur Wasserqualität von Seen in den USA) zeigte sich, dass mehr als die Hälfte aller Einträge aus Citizen-Science-Projekten stammte.
Kommen teuer produzierte Wissenschaftsvideos auf Youtube besser an? Dieser Frage widmete sich eine Studentin der University of Otago (Neuseeland) in ihrer Masterarbeit. Das Ergebnis: Clips, die wie „user generated content“ wirkten, machten den Zuschauerinnen und Zuschauern mehr Spaß und sie wollten diese eher teilen als professionell produzierte Videos. Letztere lagen aber vorne bei der Frage, ob man sie sich gern mehrfach ansehen würde.
Warum teilen Menschen Falschinformationen auf Social Media? Einem neuen Paper auf PsyArXiv zufolge steckt meist keine Absicht dahinter, sondern Unachtsamkeit: Die Fähigkeit zur rationalen Beurteilung einer Nachricht werde von anderen Motiven überlagert wie dem Wunsch, Interessantes zu teilen oder Gruppenzugehörigkeit auszudrücken. Der Unterschied sei wichtig, meinen die Forschenden, da sich das kritische Denken leicht durch kleine Interventionen in den Vordergrund aktivieren ließe.
Über 14 Jahre Erfahrungen mit Science-Cafés und der Bürgerbeteiligung in einem Wissenschaftsladen berichten Giovanna Pacini und Franco Bagnoli von „Caffé-Scienza“ in Florenz in einer aktuellen Publikation.
Nach dem Ende der Schul- oder Hochschulkarriere lernen Menschen noch ein Leben lang weiter über Wissenschaft dazu. Ein neues Positionspapier von zwei Lernforschenden der Oregon State University systematisiert dieses „lifelong free-choice learning“, das etwa in Museen, Zoos, beim Fernsehen oder in sozialen Netzwerken stattfindet.
Die Kurzmeldungen zur Wissenschaftskommunikationsforschung erscheinen alle 14 Tage im Panoptikum.