Das Wisskomm-Update gibt alle 14 Tage einen Überblick über aktuelle Themen, Debatten und Trends. Außerdem finden Sie hier aktuelle Termine und Forschungsergebnisse zur Wissenschaftskommunikation.
Koalitionsvertrag: Alte Idee, neuer Anlauf?
Was gibt’s Neues?
Wissenschaftskommunikation im Sondierungspapier
Ein Zwischenstand der AG Bildung, Forschung und Innovation aus den laufenden Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD ist geleakt worden. Darin heißt es, die Wissenschaftskommunikation solle durch eine unabhängige Stiftung gestärkt werden. Wie viel zusätzliches Geld dafür vorgesehen ist, bleibt unklar – ausgerechnet die entsprechenden Seiten fehlen im scheinbar abfotografierten Dokument. Jan-Martin Wiarda kommentiert auf seinem Blog: „Der Ampelkoalitionsvertrag mit dem fast identischen, nie umgesetzten Plan lässt grüßen.“ Auch Table.Research zeigt sich zurückhaltend: Es bleibe abzuwarten, welche Kriterien die künftige Koalition und das BMBF anlegen werden, um den Erfolg der Maßnahme zu überprüfen. Wörtlich heißt es: „Ob dort neben Quantität auch Qualität der Kommunikation eine Rolle spielen wird, bleibt offen.“ Forschung & Lehre berichtete ebenfalls und spekulierte, dass die Verhandlungen und die Schlussredaktion in den kommenden Tagen abgeschlossen sein könnten.
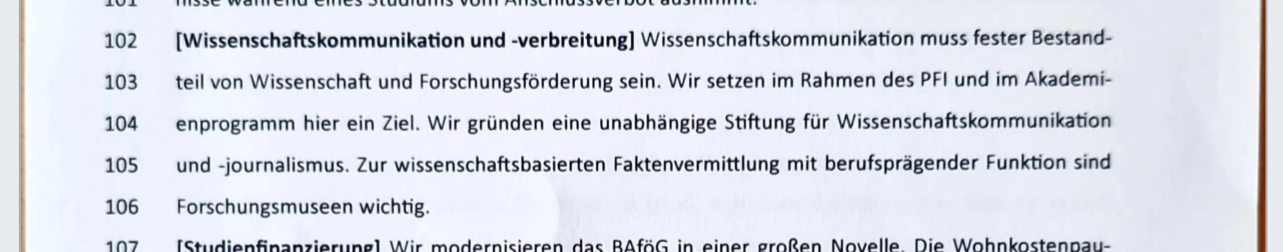
Ergänzung der Redaktion: Am Mittwoch Nachmittag wurde der Koalitionsvertrag veröffentlicht. Die Punkte aus dem vorläufigen Papier finden sich identisch im Vertrag wieder.
Wisskomm-Projekt zu verschenken
Das Medien-Startup Te.Ma, das gesellschaftliche Diskurse mit wissenschaftlicher Information verbinden wollte, gibt seine Plattform ab. Wie Gründer Martin Krohs auf LinkedIn schreibt, könnte das Projekt, das aktuell im Archivmodus läuft, noch bis Sommer 2025 reaktiviert werden. Über Themenkanäle und Formate wie „adversarial collaborations“ hatte Te.Ma etwa zu „KI und Nachhaltigkeit“ publiziert. Zuletzt blieb jedoch die Anschlussfinanzierung aus. Die Plattform hatte sich über Spenden und Förderungen finanziert. Die Wissenschaftskommunikation als Geschäftsmodell stecke „noch in den Kinderschuhen“, so Krohs – ein Thema, das auch Gastautor*innen auf unserer Plattform bereits diskutiert haben. Bis zum 18. April können sich Interessierte bei Martin Krohs melden. Übertragen würden unter anderem „Custom-Made Infrastruktur, Marke, Corporate Design, Tools, Followership, eine solide Backstory und anerkannte Gemeinnützigkeit“.
Handlungsperspektiven für den Umgang mit KI
Ein neues Diskussionspapier von Wissenschaft im Dialog* fordert, dass sich die Wissenschaftspolitik stärker mit den Risiken kommerzieller Informationsinfrastrukturen auseinandersetzt. Eine zentrale Frage sei, wie sich eine übermäßige Abhängigkeit von großen Technologiekonzernen vermeiden lasse. Das Papier basiert auf Ergebnissen des Wissenschaftsbarometers und einem daran anschließenden Multistakeholder-Dialog zu generativer KI. Die Autor*innen leiten daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab: So werde derzeit in mehreren Netzwerken an Leitlinien gearbeitet – diese sollten stärker koordiniert werden, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Zudem brauche es gezielte Förderung für Projekte, die KI nicht nur als Werkzeug, sondern als Gegenstand wissenschaftlicher Kommunikation thematisieren.
Kommunikations-Fail
Feldversuche zu kontroversen Technologien wie Geoengineering scheitern oft nicht an wissenschaftlichen oder sicherheitstechnischen Hürden, sondern an fehlender öffentlicher Einbindung. Das berichtet Science. Ohne Transparenz oder frühzeitigen Dialog werden Tests gestoppt oder gar nicht erst genehmigt. Dabei existieren aus der sozialwissenschaftlichen Forschung längst erprobte Ansätze partizipativer Kommunikation – von der Identifikation gesellschaftlicher Sorgen bis hin zu Co-Design-Prozessen. Einzelne Projekte zeigen, wie sich durch Beteiligung Vertrauen schaffen lässt. Doch solche Strategien werden laut Beitrag bislang kaum genutzt. Ein Forscher, der an einem australischen Geoengineering-Projekt beteiligt war, bringt es auf den Punkt: „Es nützt nichts, eine technische Lösung zu haben, wenn man nicht die soziale Lizenz hat, sie zu nutzen.“
Und die Forschung?
Kommunikation ist auch Beziehungsarbeit – und wird traditionell häufig Frauen zugeschrieben. Pam Papadelos und Chris Beasley von der University of Adelaide haben dazu in Fachgesellschaften in Australien Wissenschaftskommunikatorinnen befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen eher dazu neigen, sich freiwillig für Kommunikationstätigkeiten zu melden – insbesondere, wenn die Rolle weniger anerkannt ist. Das bedeute jedoch nicht, dass sie keinen Nutzen daraus ziehen, schreiben die Forscherinnen. Die Entscheidung, sich zu engagieren, obwohl sie sich der mangelnden beruflichen Vorteile bewusst sind, unterstreiche die Bedeutung, die Kommunikatorinnen ihrer Arbeit beimessen.
Partizipation ist ein häufig gehörtes Schlagwort in der Wissenschaftskommunikation. Wie sieht das aus Sicht der Öffentlichkeit aus? Ein Team von Forschenden um Ionica Smeets von der Universität Leiden hat in den Niederlanden eine Umfrage und Fokusgruppengespräche durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass immer mehr Interesse herrscht, an wissenschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen – obwohl auch Hindernisse wie Wissenslücken genannt werden. Vertrauensbildung, die Einbindung von Jugendlichen und die Integration der Wissenschaft in die Gesellschaft werden als Schlüsselfaktoren identifiziert.
Wie kann die Qualität journalistischer Berichterstattung bewahrt und gleichzeitig ein attraktives Programm für jüngere und vielfältige Zielgruppen geboten werden? Juan Manuel Prieto-Arosa von der Universität in Santiago de Compostela und Leen d’Haenens von der KU Leuven haben untersucht, wie der belgische Rundfunksender Radio-Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF) mit dieser Herausforderung umgeht. Mittels Beobachtung und Interviews haben sie Einblicke erhalten. Dabei zeigte sich, dass journalistische Prinzipien von Anfang an zentral bei der Gestaltung jugendorientierter Programme sind. Auf diese Weise werde die Glaubwürdigkeit beim jungen Publikum gestärkt und kritisches Denken gefördert, schreiben die Autoren.
Termine
📆 23. April | KI in der Wissenschaftskommunikation: Wie wichtig ist der Mensch noch bei der automatisierten Wissensvermittlung? (online) | Mehr
📆 29. April | Wissenschaftskommunikation auf Wikipedia (online) | Mehr
📆 6. Mai | Call for Proposals*: Algorithmen, Plattformen und KI: Wissenschaftskommunikation im digitalen Wandel | Mehr
Jobs
🔉 Persönliche:r Referent:in des Vorstands – Infrastruktur (m/w/d) | Forschungszentrum Jülich (kein Bewerbungsschluss)
Weitere Stellenangebote finden Sie in unserer Jobbörse – exklusiv für Stellen aus der Wissenschaftskommunikation. Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Stiftungen und Co können ihre Stellenangebote direkt an Besucher*innen unseres Portals richten.
Fundstück
An der US Naval Academy wurden auf Anordnung von Verteidigungsminister Pete Hegseth mehr als 300 Bücher aus der Bibliothek entfernt. Darunter befand sich auch die posthum veröffentlichte Autobiographie des Neurowissenschaftlers Ben Barres.
We’re disappointed to see Ben Barres’s powerful book „The Autobiography of a Transgender Scientist“ among the ~400 titles removed from the Naval Academy Library. Needless to say, we’re proud to have published his book and will keep it — and his memory — alive.
— MIT Press (@mitpress.bsky.social) 8. April 2025 um 22:24
* Wissenschaft im Dialog (WiD) ist einer der drei Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de.






