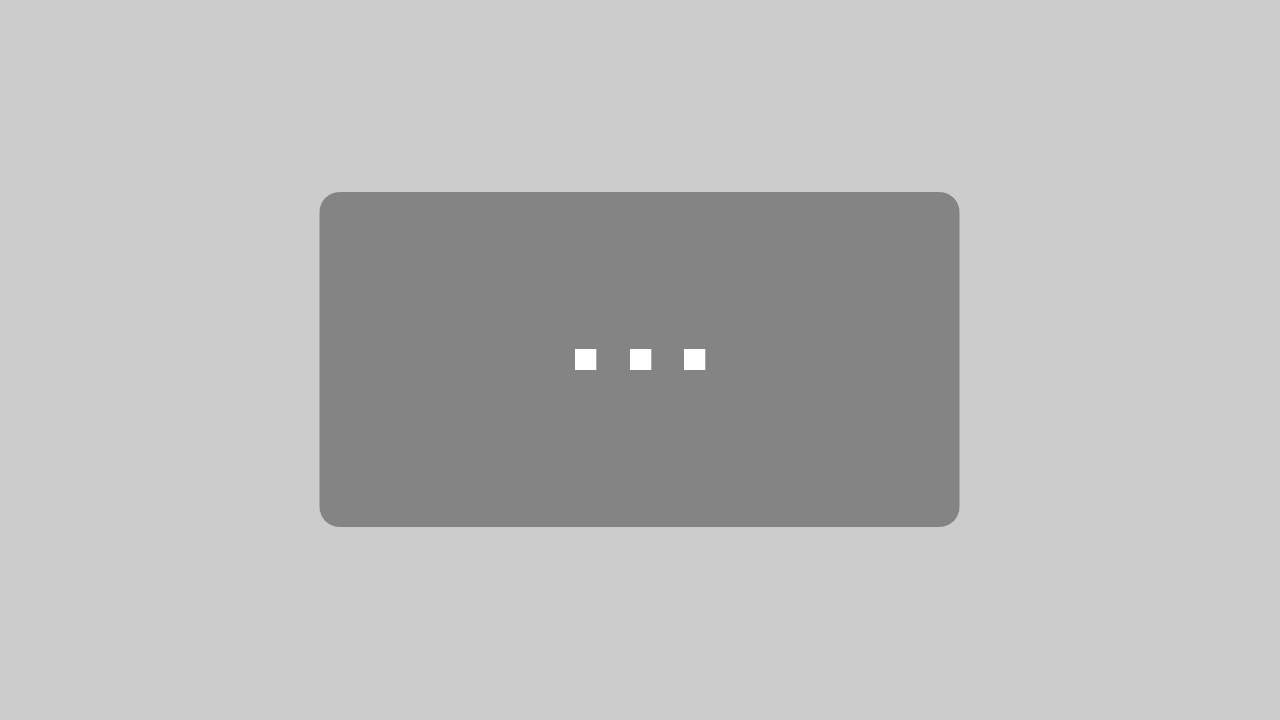Das coronarchiv sammelt private Quellen zur Pandemie – von Tagebuchaufzeichnungen über Fotos und Zeichnungen bis hin zu Social Media Posts. Über die Ziele des partizipativen Projekts, die Bedeutung diverser Quellen und Alltagsgeschichte spricht der Historiker und Mitinitiator Nils Steffen.
„Jede einzelne Stimme ist wichtig“
Das coronarchiv ist vor fast genau zwei Jahren, im ersten Lockdown, online gegangen. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, ein Online-Archiv für private Corona-Quellen zu starten?

Das Tagesgeschehen ist damals über uns hereingebrochen und wir dachten: Irgendetwas müssen wir als Historiker*innen tun. Es begann mit einem Twittergespräch – zuerst zwischen Christian Bunnenberg von der Universität in Bochum, Thorsten Logge aus Hamburg und Benjamin Roers aus Gießen. Es ging darum, dass viele immer sagen: Es ist „historisch“, was gerade passiert. Wir als Historiker*innen denken: Woher wollen wir heute wissen, was in der Zukunft als historisch angesehen wird? Und wenn es so sein sollte, müssen wir es erforschen können.
In der Geschichtswissenschaft braucht man immer Quellen als Grundlage von Forschung. Offizielle Überlieferungen zur Pandemie haben wir allerorten – in Medienberichten oder politischen Dokumentation. Aber was ist mit den Menschen, die das erleben? Wir dachten: Wir brauchen die Möglichkeit, dass Menschen ihre Erlebnisse und Erfahrungen in dieser Pandemie dokumentieren können. Deswegen hatten wir die Idee, ein frei zugängliches Archiv zu schaffen, in dem man selbst Fundstücke dokumentieren kann.
Welche Rolle spielen private Quellen für die Geschichtswissenschaft?
Private Quellen gibt es aus allen Zeiten. Aber das, was wir unter Alltagsgeschichte verstehen, ist, je weiter wir zurück gucken, immer schlechter dokumentiert. Es geht darum zu verstehen: Wie haben die Menschen in den jeweiligen Zeiten gelebt, wie haben sie gedacht, wie vielleicht auch gefühlt? Das hilft uns dabei, unsere Gegenwart besser zu verstehen und daraus abzuleiten, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen.
Heutzutage gibt es die Möglichkeiten und vielleicht auch das Bewusstsein dafür, dass man Dinge dokumentiert, archiviert und aufbewahrt. Wir alle wollen in unseren jeweiligen Wissenschaften diversere Quellen sichtbar machen. Wir brauchen Perspektivenvielfalt in der Geschichtswissenschaft. Aber die fallen nicht vom Himmel, wir müssen daran aktiv arbeiten.
Das coronarchiv
Das coronarchiv ist ein offenes Online-Archiv, in dem digitale, private Quellen mit Bezug zur Coronapandemie gesammelt werden. Das können beispielsweise Tagebücher, Briefe, E-Mails, Gedichte, Einkaufszettel, Aushänge, Warnhinweise, Zeichnungen, Bilder, Videos, Chats oder Social Media Posts sein. Das Archiv ist ein Kooperationsprojekt der Universitäten Hamburg, Bochum und Gießen und wird von den vier Historikern Christian Bunnenberg, Thorsten Logge, Benjamin Roers und Nils Steffen geleitet. Sie werden unterstützt durch ein Team aus Mitarbeiter*innen und studentischen Hilfskräften sowie einen wissenschaftlichen Beirat.
Gedacht haben wir: Wir bauen schnell eine schlanke Internetseite mit einem Einreichformular und Bürger*innen können dann eigene Texte, Tagebücher oder Fotos von Fundstücken, die sie in ihrem Umfeld entdecken, einreichen. Wir haben vermutet, dass vielleicht zehn bis 15 Leute am Tag mitmachen. Damals dachten wir ja auch, dass die Pandemie in ein paar Wochen vorbei wäre. Wir wollten ein paar Quellen sammeln und diese vielleicht auch auswerten.
Das ist dann in alle Richtungen eskaliert – in einem für das Projekt positiven Sinne. Die großen Tageszeitungen, teilweise auch Radio- und Fernsehsender haben darüber berichtet. Bis heute haben wir über 6.000 Beiträge gesammelt. Damit ist das coronarchiv eine der weltweit größten und lebendigsten Corona-Sammlungen. Wir sind natürlich nicht die einzigen auf diesem Globus, die auf diese Idee gekommen sind. Es gibt viele kleinere Projekte, in den USA mit dem „Journal of a Plague Year“ beispielsweise auch ein sehr viel größeres.
Welche Art von Beiträgen werden eingereicht?
Es gibt auch Dokumentation von Aktivitäten im Umgang mit der Pandemie. Ich erinnere mich an Lehrer*innen, die Homeschooling dokumentiert und hochgeladen haben. Im ersten Lockdown hatten wir eine Aktion mit der Körber-Stiftung, bei der über tausend Jugendliche ihren Alltag im ersten Lockdown in Texten, Bildern, Fotografien, Collagen, Podcasts und Videos dokumentiert haben. Quellen von Kindern sind in der Geschichtswissenschaft immer rar. Es ist also umso wertvoller, dass wir diesen Schatz haben.
Was passiert mit den ganzen Daten, die Sie sammeln? Wie systematisieren Sie die Quellen?
Gar nicht. Das ist die ehrliche Antwort, aber tatsächlich auch eine, die unsere Idee widerspiegelt. Wir wollen mit diesem Projekt zunächst einmal eine Art Container aufstellen, in dem die Leute ihre Dinge abladen können. Wir sind nicht die Geschichtswissenschaft von morgen. Soziolog*innen oder Politikwissenschaftler*innen können mit dem Material vielleicht schon heute arbeiten. Wir als Historiker*innen aber brauchen in der Regel einen gewissen zeitlichen Abstand. Das heißt nicht, dass damit gar nichts passiert. Das Material ist offen und es kann damit geforscht werden. Es sind schon ein paar universitäre Abschlussarbeiten zum coronarchiv entstanden. Wir beobachten mit sehr viel Freude, was da alles passiert. Aber wir verstehen unseren Job nicht so, dass wir auf Grundlage dieses Datenschatzes, den wir zusammengetragen haben, eine Bewertung der Pandemie in ihrer Bedeutung für die Menschen vornehmen können. Unser Ziel ist eine Langzeitarchivierung. Dazu sind wir in Gesprächen. Es sieht gut aus, dass das Archiv für die nächsten Jahrzehnte – und wenn die Technik mitspielt für die nächsten Jahrhunderte – offen zu Verfügung steht.
Bei partizipativen Projekten ist eine Herausforderung, Bürger*innen dafür zu begeistern. Bei Ihnen hat das geklappt – aber welche Zielgruppen erreichen Sie vielleicht trotzdem nicht?
Wir haben schnell gesehen: Wir erreichen zwar viele, aber wir erreichen nicht alle. Deshalb haben wir versucht, ganz bewusst nachzusteuern, indem wir unsere Sprachen ausgeweitet haben. Die Seite gibt es inzwischen auch auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Türkisch. Das hat sich auch bei den eingereichten Quellen bemerkbar gemacht. Aber es hat uns noch nicht an den Punkt gebracht, an dem wir sagen können: Wir haben unsere gesellschaftliche Diversität im Archiv abbilden können.
Deshalb versuchen wir Angebot zu schaffen, die Menschen interessieren könnten, die sich bislang nicht beteiligt haben. Wir haben eine Förderung von der Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg bekommen, um weitere digitale Ausstellungen – so, wie sie schon auf unserer Seite zu finden sind – zu machen. Dafür wollen wir Bürger-Kurator*innen finden, die aus ihren jeweiligen, ganz diversen Perspektiven auf das Material gucken.
Zum Jahreswechsel 2021/2022 haben wir mit der Magnus-Hirschfeld-Stiftung begonnen, queere Menschen anzusprechen, weil auch das eine Perspektive ist, die im Archiv bisher kaum sichtbar wird. In den LSBTIQ*-Communities gab es zum Teil massive Einschränkungen des Lebens. Diese Stimmen gilt es gezielt einzufangen, da sie in der medialen Berichterstattung allzu oft marginalisiert werden.
Wie gehen Sie mit den eingereichten Materialien um?
Jede*r kann etwas einreichen, aber es wird nicht alles sofort auf der Webseite veröffentlicht. Es hat auch Datenschutz- und Copyrightgründe, dass erst einmal von unserem studentischen Moderationsteam gecheckt wird: Hat diese Person wirklich die Rechte an dem, was da hochgeladen wird? Erst dann wird es freigeschaltet. Das klingt wie ein starker Filter, letztlich sind es aber ganz wenige Beiträge, die wir nicht freischalten können. Aber auch die bleiben im Archiv und können beforscht werden. Dafür kann ein spezieller Zugang für Forschende bereitgestellt werden.
Das coronarchiv ist ein Crowdsourcing-Projekt, bei dem wir mit Bürger*innen zusammen Quellen sammeln. Dabei sind wir auf viele für uns neue Fragen gestoßen: Wie gehen wir beispielsweise mit Bildrechten um? Müssen wir Gema-Gebühren zahlen, wenn im Hintergrund eines Videos ein Song von Britney Spears läuft? Durch Exzellenzmittel der Uni Hamburg haben wir dann das sogenannte CrowdsourcingLab an das Projekt andocken und über zehn Monate unseren wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Luca Jacobs beschäftigen können. Er hat in dieser Zeit ein Manual ausgearbeitet, das wir auch anderen an die Hand geben können, die solche Projekte in den Geisteswissenschaften planen.
Wie hat sich die Beteiligung der Bürger*innen entwickelt?
Wir hatten am Anfang einen ganz steilen Anstieg. Als dann im Sommer und Herbst 2020 die zweite Welle kam, ging das noch mal ziemlich hoch. Seit 2021 sinkt die Beteiligung mehr oder weniger kontinuierlich. Ich glaube, das hat mit der gegenwärtigen Stimmung zu tun. Das Thema hat man eigentlich über. Wir sind jetzt hoffentlich in einer Spätphase der Pandemie. Umso wichtiger ist, bevor diese Zeit in Vergessenheit gerät, sich zu beteiligen, das Handy durchzugucken und zu schauen: Was kann ich mit anderen teilen? Woran sollte man sich später einmal erinnern?
Welchen Stellenwert haben solche partizipativen Projekte in der Geschichtswissenschaft?
Solche Projekte sind in der Geschichtswissenschaft nach wie vor exotisch. Zum Teil haben wir von Kolleg*innen ganz begeisterte Rückmeldungen bekommen. Andere haben uns erstaunt gefragt, wöfür wir das eigentlich tun und welcher Mehrwert dadurch für die Forschung entstehe. Das liegt sicher auch daran, dass solche Projekte nicht in die tradierte Forschungs- und Reputationslogik des Fachs passen. Generell müssen wir für Citizen-Science-Projekte in unserem Fach noch werben. Aber ich sehe, da tut sich was.
Inwiefern ist das coronarchiv ein Projekt, das Wissen über Wissenschaft in die Gesellschaft bringt?
Das ist ein schöner Seiteneffekt eines solchen Projektes, aber natürlich nicht unser ursprüngliches Ziel. Die Public History als junge Disziplin innerhalb der Geschichtswissenschaft versucht den Eindruck zu vermeiden, dass wir die Marketingabteilung der Geschichtswissenschaft sind. Aber solche Projekte können schon zeigen: Wissenschaft ist nicht immer weit entfernt von der Lebenswirklichkeit der Menschen, wie viele glauben. Bürger*innen erleben uns als Forschende hier recht nah. Wir suchen den Austausch und möchten miteinander arbeiten. Weil wir davon überzeugt sind, dass unsere Arbeit einen gesellschaftlichen Mehrwert hat.

Welche partizipativen Projekte sind bei Ihnen in der Planung?
Partizipation ist für uns ein zentrales Thema geworden. Ein großes Projekt, das wir im letzten Jahr mit der Unterstützung des BMBF beginnen konnten, ist SocialMediaHistory. Dabei geht es darum, Geschichtsdarstellungen auf Instagram und TikTok zu untersuchen. Wir wollen gemeinsam Beispiele wie das Instagram-Projekt „Ich bin Sophie Scholl“ erforschen: Welche Aspekte davon können wir als historisch-politische Bildung wahrnehmen und was daran ist vielleicht Unterhaltungshistoriografie?
Im November haben wir ein Projekt mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg begonnen, das durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur finanziert wird: „Orte der (Un-)Sichtbarkeit“. Dabei geht es um persönliche Erinnerungsorte an DDR-Geschichte und SED-Unrecht in Hamburg. Grade wurde unser Zeitzeug*innen-Aufruf veröffentlicht: Wir suchen Menschen, die aus der DDR geflohen und nach Hamburg gekommen sind. Aus Interviews mit ihnen entsteht ein Audiowalk durch Hamburg, der sich insbesondere an Jugendliche richtet.
Ein anderes Projekt, das wieder in Richtung Crowdsourcing geht, ist „Street | Art | Democracy“. Auf dem Portal „StreetArt Explorers“ können Bürger*innen Streetart mit historisch-politischer Bedeutung dokumentieren. Wir werden ab Sommer in Workshops mit Jugendlichen arbeiten, um sie als StreetArt Explorer zu qualifizieren. Sie gehen dann raus in ihren Stadtteil, suchen Streetart, lernen diese zu dechiffrieren, zu dokumentieren und ihr Wissen weiterzugeben.