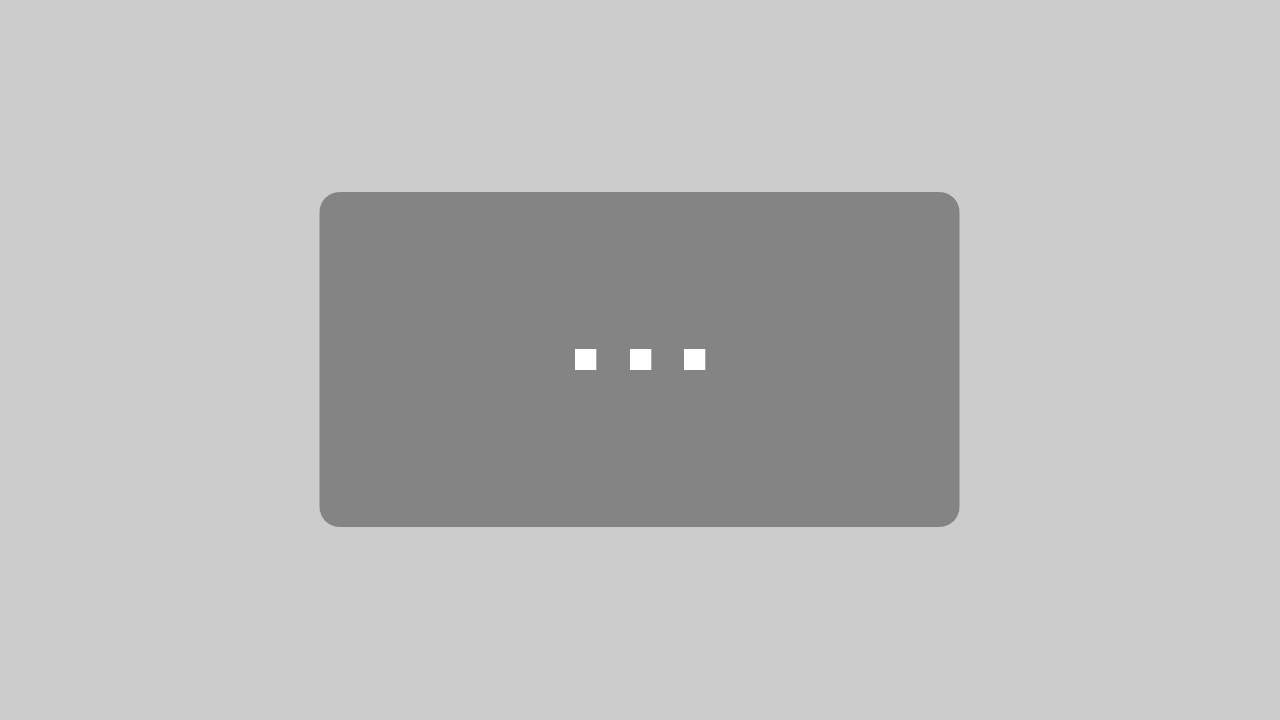Wissenschaftskommunikation ist für den Sonderforschungsbereich (SFB) 1182 ein wichtiges Thema. Leiter Thomas Bosch erzählt, warum das Team viel Zeit und Energie darauf verwendet. Am IPN Leibniz-Institut wurde dafür eigens ein Schülermagazin mit Zielgruppen-Review entwickelt, das dort gleichzeitig beforscht wird. Wie die Methode funktioniert, erklärt Didaktikerin Kerstin Kremer. Ein Doppelinterview.
„Ich bin Meta“ – Zielgruppen-Review als Outreach-Methode
Herr Bosch, warum ist die Kommunikation für den Sonderforschungsbereich (SFB) 1182 „Entstehen und Funktionieren von Metaorganismen“ so ein großes Thema?
Thomas Bosch: Wir arbeiten hier mit einer neuen wissenschaftlichen Arbeitshypothese, der die Idee zugrunde liegt, dass jedes Lebewesen ein Metaorganismus ist. Das heißt: Mensch und Tier sind im engeren Sinn eigentlich keine Individuen. Das Funktionieren und die Fitness der Organismen beruht auf dem Zusammenleben mit vielen Lebewesen einschließlich der Bakterien, Viren und anderer Mikroben. Unser Ansatz wird zurzeit durchaus kontrovers diskutiert. Wenn aber stimmt, was wir denken, dann ist Gesundheit multiorganismisch.
Das heißt, ein Blick auf ein einzelnes Organ reicht nicht mehr aus, wenn man sein Funktionieren oder eben auch Nicht-Funktionieren verstehen will. Und wenn alle Organismen Metaorganismen sind, dann beeinflusst auch die Art wie wir uns ernähren oder wie wir leben die ganze Vielzahl der Lebewesen, die einen Metaorganismus ausmachen. Damit betrifft diese neue Betrachtungsweise auch jedermann. Und genau darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, mit der Kommunikation möglichst viele Menschen zu erreichen.

Wie gehen Sie das an?
Bosch: Das Konzept von Organismen als Metaorganismen ist komplex und nicht leicht zu kommunizieren. Es geht um für das Auge unsichtbare Organismen und biologische Prozesse, abstrakte Begriffe und komplexe Zusammenhänge. Aus diesem Grund haben wir eine sehr aktive Kommunikationsstrategie gewählt, die wir zusammen mit der Presseabteilung der Universität umsetzen und vor allem mit Unterstützung durch Frau Kremer und das IPN, das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, an dem die Wissenschaftskommunikation ein explizites Schwerpunktthema der Forschungsagenda darstellt.
Welche Formate haben Sie für die Kommunikation gewählt?
Bosch: Wir haben uns für vier Säulen der on- und offline Kommunikation entschieden. Auf Youtube verfolgen wir einen Storytelling-Ansatz. Mit einem professionellen Videoteam setze ich ein Interviewformat um, in dem ich mit jüngeren wie auch etablierten Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland über ihre Forschung im Bereich Wirt-Mikroben-Interaktion spreche und wir sie in allgemeiner Sprache erklären. Die stellen wir dann auch auf unserer eigenen Homepage „Metaorganismus Research“ ein. Als Zweites gehen wir in die Öffentlichkeit, sprechen beispielsweise bei der Kieler Woche mit Bürgerinnen und Bürgern im Bierzelt über unsere Forschung, besuchen Schulen oder organisieren Seniorenvorlesungen. Als Drittes erstellen wir mit dem Science Communication Lab zusammen Animationen und Visualisierungen, die die komplexen Zusammenhänge in Bildern zusammenfassen. Die dürfen wir auf großen Bildschirmen in Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen präsentieren. Und die vierte Säule ist die Kooperation mit dem IPN – Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, wo das Schülermagazin „Ich bin Meta“ zu unserem Forschungsbereich entwickelt wurde.
Frau Kremer, am IPN wurde nicht nur das Konzept für das Schülermagazin zu dem SFB konzipiert. Sie forschen in dem Zuge auch über die Wissenschaftskommunikation im Schulkontext. Was ist Ihr Ansatz?
Kremer: Das dialogische Prinzip, das dem Outreach-Magazin „Ich bin Meta“ zugrunde liegt, ist für uns ein besonders schöner Forschungs-Prototyp. Wir verfolgen in der Forschung ein Schnittstellenmodell, bei dem die Kommunikatoren und die adressierte Zielgruppe in Interaktion treten. Dieser Interaktionsprozess interessiert uns, weil bisher darüber sehr wenig bekannt ist. Das dialogische Schreiben ermöglicht uns, mehr darüber zu erfahren, welche Kommunikationsziele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfolgen und wie sich diese verändern. Zugleich erforschen wir, auf welche Voraussetzungen aufseiten der Teilnehmenden diese Ziele treffen und was sie dort dann bewirken können. Zudem gibt es bisher noch kein derartiges Journal als Outreach-Instrument eines Sonderforschungsbereichs in Deutschland. Am Beispiel dieses Prototyps betreten wir also am IPN Neuland im Bereich der Wissenschaftskommunikation. So konnten wir also das Konzept dafür neu entwickeln und es bei der Umsetzung auch direkt beforschen.

Wie funktioniert der Zielgruppen-Review-Prozess zu „Ich bin Meta“?
Kremer: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des SFB schreiben Beiträge über ihre Forschung, die im Anschluss von der Zielgruppe selbst beurteilt, bewertet und kommentiert werden. Im Anschluss werden die Texte dann erneut überarbeitet und in der Schülerzeitung publiziert. Das Produkt wird dann nicht nur an die beteiligten Schülerinnen und Schüler, sondern auch andere Gruppen verteilt. Für uns Didaktiker ist besonders dieser Reviewprozess spannend, weil ein Dialog zwischen Forschenden und Schülerinnen und Schülern zustande kommt. Unser Ziel ist es herauszufinden, was diese Interaktion mit den beiden Kommunikationspartnern macht.
Welche Faktoren untersuchen Sie hier genau?
Kremer: Uns interessiert zum einen, ob die Kommunikationsziele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Zielgruppe ankommen. Also, ob die Botschaft, die Herr Bosch und der SFB senden möchten, verstanden wird. Gleichzeitig interessiert uns aber auch, welches Bild von Wissenschaft allgemein durch die Kommunikation initiiert wird, also beispielsweise Interesse für Wissenschaft allgemein oder auch das Vertrauen in Forschungsergebnisse.

Gibt es hier schon erste Ergebnisse?
Kremer: Wir wissen zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler mit einem sehr heterogenen Wissen über die Wissenschaft in den Prozess reingehen und auch, dass das Vertrauen in die Forschung sehr unterschiedlich bewertet wird. Im Prozess haben wir außerdem gemerkt, dass auf beiden Seiten mehr Informationen zur Interaktion benötigt werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen oft nicht, wie sie die Zielgruppe einschätzen sollen, beispielsweise in Bezug auf deren Wissensstand oder deren Interesse. Die Schüler hingegen brauchen mehr Hilfestellung dazu, wie man produktiv Feedback zu einem Text geben kann, damit der Wissenschaftler auch etwas damit anfangen kann. Wir lernen also, dass wir für die Interaktion einen Rahmen entwickeln müssen, um sie effektiv zu gestalten. Das Ziel ist hier: Einen Dialog zu ermöglichen, der bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein Bewusstsein für ihre Wirksamkeit schafft und zugleich in den Forschungsalltag integriert werden kann. Außerdem soll er das Verständnis bei den Schülerinnen und Schüler fördern.
Gab es Vorbilder für das Format?
Kremer: Ja, angelehnt haben wir die Idee an dem Angebot Frontiers For Young Minds der Frontiers Research Foundation, einer Organisation, die viele einschlägige Open-Access-Magazine herausgibt. Dieses Format für Kinder arbeitet mit einem ähnlichen Konzept.
Was bedeuten die Kommunikationsprojekte für die Forschung im SFB?
Bosch: Wir Wissenschaftler lernen auch selbst, Zusammenhänge klarer zu sehen, wenn wir die eigenen Befunde und Beobachtungen in einer Sprache kommunizieren, die über den wissenschaftlichen Jargon hinausgeht. Es gilt die Weisheit: Man hat nur richtig verstanden, was man auch selbst vermitteln kann. Insofern ist der Prozess auch für unsere Forschung wichtig. Gleichzeitig profitieren wir von den Erfahrungen der Menschen, die eben nicht so tief in dem Thema drin stecken, und erhalten neue Perspektiven.
Kremer: Das gilt auch für die Lehre an der Universität sowie die öffentliche Wissenschaftskommunikation. In beiden Bereichen gab es positives Feedback auf den Dialogansatz. So hat sich bei einem Vortrag, den ich im Uni-Zelt auf der Kieler Woche halten durfte, herausgestellt, dass auch Bürgerinnen und Bürger in Kiel Lust auf einen Dialog mit der Wissenschaft hätten. Eine Erweiterung auf andere Zielgruppen und Social Media denken wir nun an.

An dieser Stelle dürften sie gerne das angehängte Bild einbinden – Das Outreach-Magazin „Ich bin Meta“ stellt sich vor bei einem Bürger-Votrag im Uni-Zelt im Rahmen der Kieler Woche
Wie werden die Projekte finanziert?
Bosch: Bisher haben wir die Projekte aus den internen Mitteln des SFB und mithilfe der Universität Kiel finanziert. Wir sind aber gerade dabei, für den SFB die nächste Förderperiode bei der DFG zu beantragen und wollen in dem Zuge auch eigene Mittel für ein Teilprojekt Wissenschaftskommunikation beantragen. Es ist also eine Mischfinanzierung mit Mitteln der DFG, zudem haben wir Gelder von privaten Stiftungen eingeworben.
Kremer: Außerdem haben wir am IPN Mittel für einen eigenen Kieler Science Outreach Campus bei der Leibniz-Gemeinschaft eingeworben und konnten einen Teil des Schülermagazins auch aus diesem Budget finanzieren. Außerdem hilft die Förderung der Leibniz-Gemeinschaft besonders bei der Etablierung von Forschung über Wissenschaftskommunikation.
Was versprechen Sie sich langfristig von der engen Verbindung von Kommunikation und Wissenschaft?
Bosch: Ich denke, dass Kommunikationsskills nicht nur für die Wissenschaftskommunikation nach außen immer wichtiger werden, sondern auch für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Forschungsbereichen. Bisher hat man oft versucht, eine wissenschaftliche Fragestellung in ihrer Tiefe zu betrachten, aber losgelöst vom Gesamtzusammenhang. Gerade in Bereichen wie der Biomedizin wird ein ganzheitlicher, also ein multiperspektivischer Ansatz aber immer wichtiger. Ein Beispiel: Ich habe gerade mit einem Anthropologen und Psychologen ein Paper dazu veröffentlicht, was unser Ansatz des Metaorganismus eigentlich für das Selbstbild des Menschen bedeutet. Hier war schon der Versuch, uns untereinander zu verständigen sehr anstrengend, weil unsere Disziplinen sehr unterschiedliche Sprachen sprechen. Doch schon diese Kommunikation über Fachkreise hinaus kann ungeheuer gewinnbringend sein.