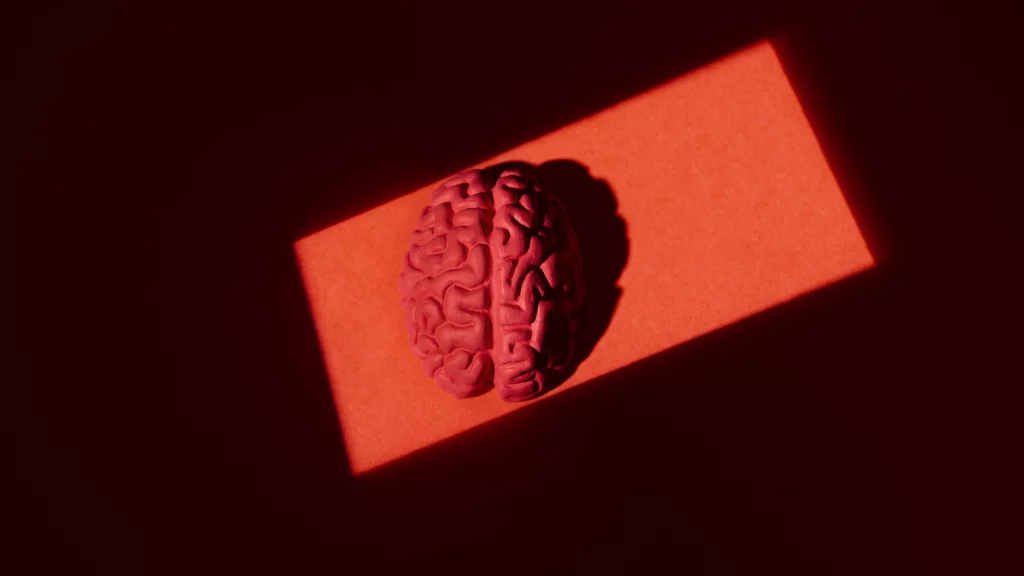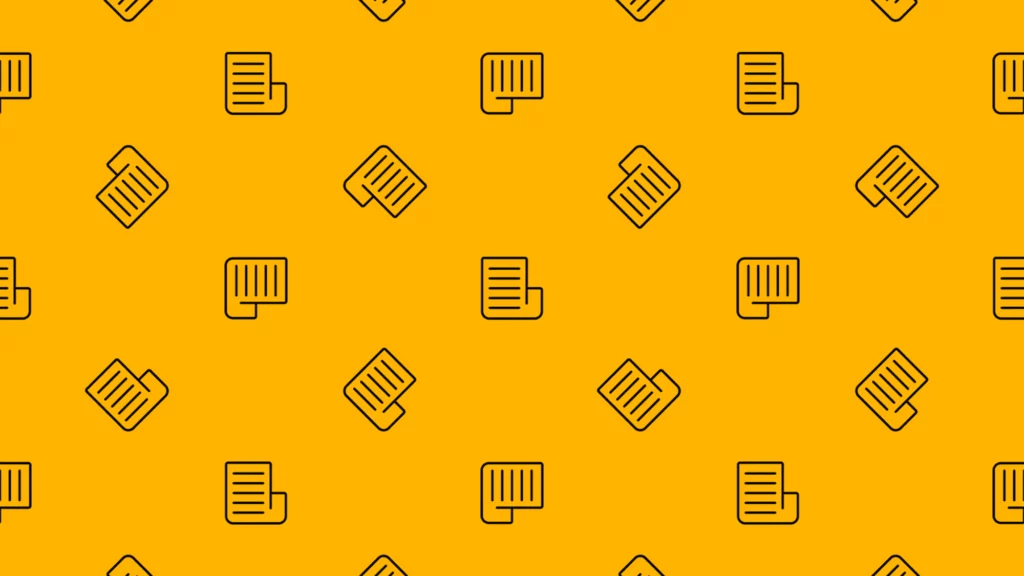Forschende reden kompliziert und Medienschaffende verfälschen Aussagen – das stimmt natürlich nicht immer. Dennoch kann die Zusammenarbeit schwierig sein. Wie die Stiftung Charité mit den „science x media Tandems“ gemeinsame Projekte in der Wissenschaftskommunikation fördert, erklärt Nina Schmidt im Interview.
„Häufig sind Forschende mit ihren ersten Medienerfahrungen unzufrieden“

Frau Schmidt, mit den science x media Tandems fördert die Stiftung Charité Wissenschaftler*innen und Medienschaffende bei gemeinsamen Projekten in der Wissenschaftskommunikation. Welche Ziele verfolgt das Programm?
Ziel ist es, wirklich hochwertige und innovative Vorhaben aus den Berliner Lebenswissenschaften zu ermöglichen.
Die Teilnehmenden sollen Freude daran haben, neue Formate auszuprobieren.
Dabei sollen Wissenschaftler*innen und Medienschaffende auf Augenhöhe arbeiten, gleichermaßen von der Zusammenarbeit profitieren und etwas lernen – genau wie die interessierte Öffentlichkeit, an die sie sich mit ihrer Arbeit richten.
Dafür ist es wichtig, sowohl den Wissenschaftler*innen als auch den Medienschaffenden den nötigen Freiraum zu geben. Also Zeit und Geld für ein Projekt, das ihnen vielleicht schon lange vorschwebt, das sie aber bisher nicht umsetzen konnten, weil es die Anforderungen ihres dichten Berufsalltags nicht zuließen.
Wissenschaftskommunikation, so hoffen wir, bekommt auf diese Weise neben Forschung, Lehre und administrativen Aufgaben einen neuen Stellenwert.
Wie genau wird den Antragsteller*innen Zeit für die Projekte verschafft?
Wenn die Antragsteller*innen es wünschen, können sie sich für ihr Projekt von einem Teil ihrer Arbeitszeit bezahlt freistellen lassen. Diese Zeit wird dann von der Stiftung Charité vergütet, das bedeutet in der Praxis: der Arbeitgeber kompensiert.
Dieses „Protected Time“-Modell ist in der Wissenschaftskommunikationsförderung ziemlich einzigartig. Nach bisher zwei Ausschreibungsrunden stelle ich fest: Die meisten Antragsteller*innen lassen sich etwa 10 bis 25 Prozent von ihrer Arbeitszeit freistellen. Wenn sie mit einem Bein in der Klinik stehen und mit dem anderen in der Forschung, werden sie zum Beispiel bei der Klinikzeit entlastet. Das bedeutet natürlich auch, dass die Vorgesetzten mit dem Vorhaben einverstanden sein müssen.
Durch die so geschaffene Zeit kommen die Wisskomm-Projekte hoffentlich raus aus dem Feierabend und dem Wochenende und rein in die normale Arbeitszeit. Die geschützte Zeit ist ein Aspekt des Programms, aber in der Bewerbung kann man natürlich auch andere personelle und materielle Ressourcen beantragen. Je nachdem, was für das Projekt benötigt wird.
Stiftung Charité
Die Stiftung Charité ist eine unabhängige, privatrechtliche und gemeinnützige Stiftung. Sie wurde 2005 von der Unternehmerin und Stifterin Johanna Quandt gegründet. Die Stiftung unterstützt die Charité – Universitätsmedizin Berlin und weitere lebenswissenschaftliche Einrichtungen über Förderprogramme in drei Bereichen: Innovationsförderung, Wissenschaftsförderung und Open Life Science, zu denen auch das Programm der science x media Tandems zählt.
Gerade diese Mediendynamik, die sich damals entwickelt hat – wir erinnern uns als Tiefpunkt an Bild-Schlagzeilen wie „Die Lockdown-Macher“ – hat uns gezeigt, wie dringend es ist, sowohl Forschende als auch Medienschaffende im Umgang miteinander besser zu schulen.
Viele Forschende haben in dieser Zeit sicher gedacht: „Da schließe ich lieber meine Labortür“. Lebenswissenschaftlich Forschende brauchen heute grundlegendes Handwerkszeug für die Medienarbeit, das ihnen aber weder Studium noch Beruf vermitteln. Und Medienschaffenden fehlt häufig die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen.
Häufig sind Wissenschaftler*innen mit ihren ersten Medienerfahrungen unzufrieden. Da wird vielleicht das Interview vor der Veröffentlichung nicht noch einmal vorgelegt, sie werden falsch zitiert oder ein Wort wird gestrichen und plötzlich ist der Inhalt faktisch falsch. Was Journalist*innen vielleicht gar nicht absichtlich machen, weil sie den Text nur lesbarer machen wollten. Die Gefahr dafür ist besonders groß, wenn sie nicht aus dem Feld des Wissenschaftsjournalismus kommen. Für Journalist*innen ist es manchmal überhaupt nicht nachvollziehbar, warum Wissenschaftler*innen so reagieren, wie sie reagieren. Warum sie sich manchmal zurückziehen oder sich so kompliziert ausdrücken.
Wie sind bisher die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen?
Das Feedback ist äußerst positiv. Die Geförderten sind begeistert, dass wir die Wissenschaftskommunikation in dieser Form so klar unterstützen. Ein Tandem-Team aus der ersten Runde, bestehend aus Frau Meryam Schouler-Ocak ,Professorin für interkulturelle Psychiatrie an der Charité und Frau Dilek Üşük, die Fernsehmoderatorin ist, möchten mit ihrem Projekt auf die oft schlechte mentale Gesundheit der türkeistämmigen Community in Deutschland aufmerksam machen. Dazu haben die beiden unter anderem Videos gedreht, die sie über soziale Plattformen verbreiten. Beide sagten, wie viele andere auch, dass sie schon in der Bewerbungsphase viel gelernt hätten, gerade weil sie sich gemeinsam bewerben mussten. Meiner Beobachtung nach schafft man eine erfolgreiche Bewerbung auf ein science x media Tandem tatsächlich nur, wenn man sie von Beginn an zu zweit konzipiert und sich überlegt, wo die Knackpunkte sind: Was muss kommunikativ wie angegangen werden, in welchem Format für welche Zielgruppe, damit die wissenschaftlichen Inhalte auch wirklich rüberkommen?
Oft sagen Wissenschaftler*innen rückblickend von sich selbst, dass sie naiv waren, was die Medienarbeit angeht. Den Aufwand, der in diese Art Arbeit geht, unterschätzen sie. Eine Anekdote aus einem Gespräch mit Frau Schouler-Ocak: Sie dachte, sie könne an den Drehtagen schnell mal ein Video machen und dann weiter arbeiten. Spannend fand sie auch, wie wichtig alle möglichen Details beim professionellen Dreh sind, zum Beispiel dass sie darauf achten musste, an verschiedenen Tagen das Gleiche anzuziehen, weil es zusammengeschnitten wird.
Wie finden sich die Teilnehmer*innen?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt sowohl Medienschaffende, die die Initiative ergreifen und sich Wissenschaftler*innen suchen, als auch Wissenschaftler*innen, die eine Idee für ein Projekt haben und sich gezielt Medienschaffende mit der passenden Expertise suchen. Bei Bedarf unterstütze ich Interessent*innen in der Ideenphase auch dabei.
In der letzten Runde hat sich zum Beispiel die Fotografin Patricia Kühfuss direkt an mich gewandt. Sie störte sich daran, wie stereotyp und eindimensional Fotos über Pflege oft sind, die in unserer Kultur – unseren Medien – zirkulieren. Das würde weder den in der Pflege Tätigen, noch denjenigen, die auf Pflege angewiesen sind, gerecht.
Ich konnte sie mit Jan Kottner, dem Direktor des Instituts für Klinische Pflegewissenschaft an der Charité, zusammenbringen. Das war am Ende eine sehr überzeugende Bewerbung, weil beide für die Sache brannten und das Image-Problem, das die Pflege im doppelten Sinne hat, unbedingt gemeinsam angehen wollten.
Gab es auch schon Probleme zwischen Tandempartner*innen, bei denen Sie vermitteln mussten?
Eigentlich nicht. Aber wenn es mal knirschen sollte, lösen die Tandems das sicherlich zum überwiegenden Teil im Team.
In der ersten Förderrunde gab es eine Wissenschaftlerin, die mich aufgeregt anrief, weil ihre Tandempartnerin aus dem laufenden Projekt aussteigen musste – aus durchaus nachvollziehbaren privaten Gründen. Aber die Wissenschaftlerin hatte natürlich Sorge, dass das Projekt gefährdet ist und sie vielleicht sogar die Förderung, die sie bereits erhalten hat, zurückzahlen muss. Das musste sie letztlich nicht. Aber es war für uns als Stiftung eine Situation, die wir formal rechtssicher lösen mussten – und von der wir wussten, dass sie so oder so ähnlich wieder passieren kann. Das Projekt sollte ohnehin nur wenige Monate laufen, der Zeitdruck war also groß. Wir haben der Wissenschaftlerin dann drei Wochen Zeit gegeben und sie bei der Suche nach einer beziehungsweise einem neuen Medienschaffenden unterstützt. Das versuchen wir eigentlich immer: im Sinne der Sache Flexibilität zu beweisen, wenn es irgend geht.
Aktuell laufen die science x media Tandems der zweiten Förderrunde an. Gibt es Kritik oder Erkenntnisse aus dem letzten Jahr?
Beides, ganz klar. Und das auch schon aus der Zeit der Hintergrundgespräche während der Konzeptionsphase des Programms. Wir wurden in der Vergangenheit beispielsweise kritisch darauf angesprochen, warum wir in der Ausschreibung allgemein von Medienschaffenden sprechen und nicht spezieller von Journalist*innen. Das Argument war, dass es der Journalismus derzeit schwer hat. Das stimmt natürlich. In vielen Redaktionen gibt es zu wenig Geld für Wissenschaftsjournalismus, wurden Strukturen abgebaut, etwa feste Redakteursstellen für den Wissenschaftsjournalismus. Da ist es kein Wunder, dass die Qualität nicht immer stimmt, wenn heute über Forschung berichtet wird.
Nur ist das meiner Ansicht nach kein Problem, das wir mit diesem einen Förderprogramm lösen können. Da braucht es andere Mittel und Strukturen.
Unsere Ausschreibung wollten wir möglichst offen anlegen. Wir wollen als Stiftung Charité unterschiedlichste, aber vor allem innovative Wisskomm-Vorhaben fördern, und da haben wir größere Chancen gesehen beeindruckt zu werden, wenn sich neben den klassischen Journalist*innen auch Fotograf*innen, Social Media-Profis oder eben Fernsehmoderator*innen bewerben können. Den Zuschlag bekommen haben schon Medienschaffende aus all diesen Bereichen, einschließlich des Journalismus.