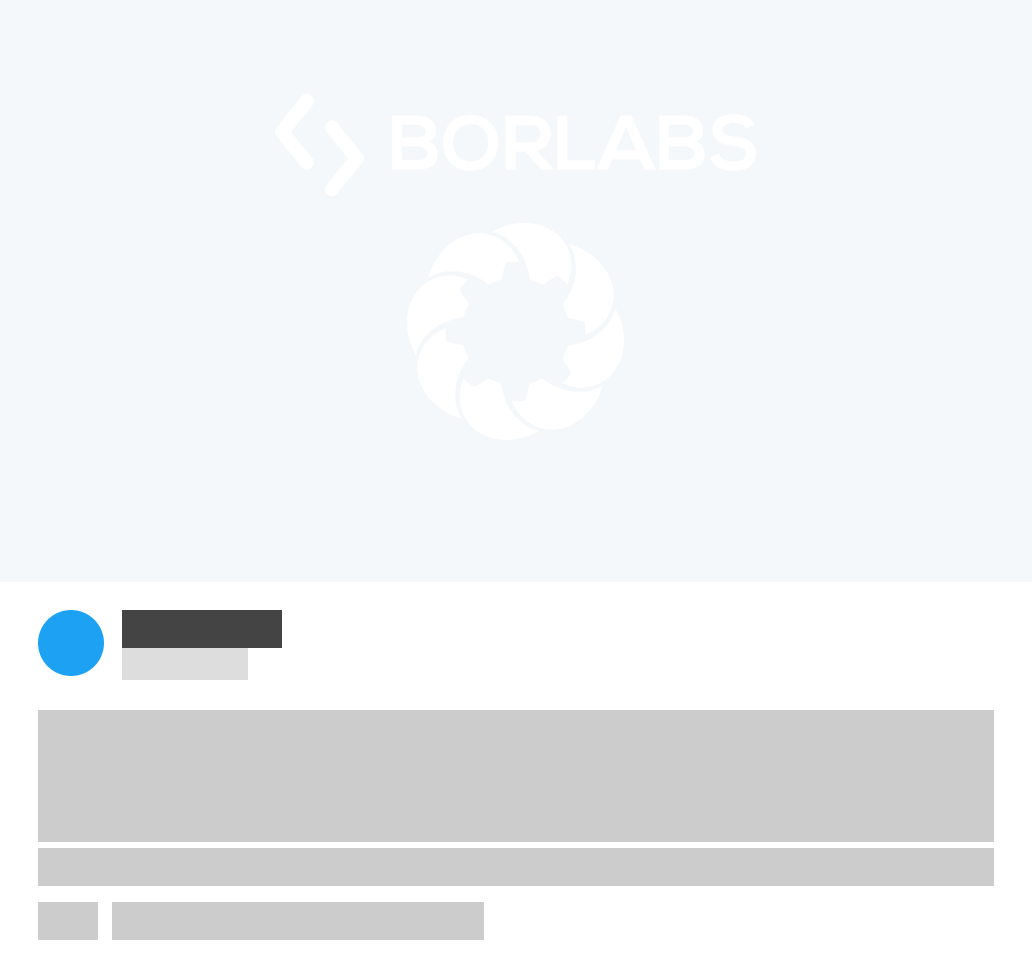Wie erreichen wir mehr gleichberechtigte Sichtbarkeit und Diversity in der Wissenschaftskommunikation? Die Antwort gleich vorweg: Nur gemeinsam! Zusammen geben Johanna Barnbeck und Philipp Schrögel daher einen Überblick über Ansätze und Strategien für mehr Gleichberechtigung auf Podien und in der Medienlandschaft.
Gleichberechtigt ist das neue Normal
Wäre es nicht schön, wenn der Fantasie keine Grenzen gesetzt wären und sich jeder Mensch – zumindest theoretisch – vorstellen könnte, mit Wissenschaftlern zu sprechen oder selbst einer zu sein? Und wäre es nicht noch schöner, wenn das genauso für Wissenschaftlerinnen gelten würde, sowohl in der sprachlichen und bildlichen Darstellung als auch in der gelebten Realität? Diese Vorstellung ist selbst im Jahr 2019 aber noch nicht für alle eine Selbstverständlichkeit. Dabei hat sich in den letzten Jahrzehnten schon einiges verbessert.
Ein Indikator dafür sind die Ergebnisse etlicher Studien seit den 1950er-Jahren, insbesondere in den USA. Dabei wurden Kinder aufgefordert, Forschende zu zeichnen. In der englischen Anweisung „Draw a scientist“ ist zwar keine genderspezifische Prägung enthalten. Trotzdem zeichneten die Kinder in den 50er- und 60er-Jahren in 99 Prozent der Fälle einen männlichen Wissenschaftler, oft in stereotyper Laborkleidung. Diese Zahlen haben sich mittlerweile verändert, und in verschiedenen Folgestudien wurden in heutiger Zeit in bis zu 44 Prozent der Fälle weibliche Wissenschaftlerinnen abgebildet – in unterschiedlichen Umgebungen und Kleidungen, wie Metaanalysen zeigen.1 2 Unabhängig von diesem positiven Trend3 zeigen die verschiedenen Studien beispielhaft, dass Menschen beispielsweise in ihrer Berufswahl stark von dem beeinflusst werden, was sie in ihrer Umgebung sehen. So ziehen Kinder und Jugendliche Rückschlüsse daraus, was als „männlich“ oder „weiblich“ gilt und orientieren sich häufig an dem Bild, das ihnen präsentiert oder vorgelebt wird.
Abb.1) So divers, wie dieses Beispiel für unseren Post, um das wir Marlene (8 Jahre) gebeten haben, sehen bisher leider nur ein kleiner Anteil von Kinderzeichnungen von Wissenschaftler*innen aus.4
Dieser Herausforderung muss sich Wissenschaftskommunikation – Wissenschaftsjournalismus genauso wie Kommunikation durch Forschungseinrichtungen oder andere Akteur*innen – aus unserer Sicht stellen: Sie vermittelt nicht nur fachliche Inhalte, sondern immer auch darüber hinausgehende Eindrücke und Werte – ob explizit oder implizit5. Auf den Punkt gebracht hat dies ganz aktuell die Journalistin Vanessa Spanbauer aus Wien in einer Reihe von Tweets in der sie einen mit dem Foto einer schwarzen Forscherin oder Studentin bebilderten Artikel von Zeit Online kommentiert: „Ich bin eine schwarze Geisteswissenschaftlerin. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand auch nur irgendwo Geisteswissenschaften mit einer Person bebildert, die mich repräsentieren kann“. Ebenso wie für andere gesellschaftliche Bereiche, gilt für das gesellschaftliche Bild von Wissenschaft und Wissenschaftler*innen: „You can’t be what you can’t see“6. Für uns ist daher eine zentrale Leitlinie für Wissenschaftskommunikation, dies zu berücksichtigen und die Sichtbarkeit von weiblichen und in vielen anderen Aspekten diversen Wissenschaftler*innen und Vorbildern zu erhöhen. Und zwar unabhängig davon, ob es darum geht, mehr Mädchen und Menschen mit vielfältigen Hintergründen zu inspirieren, eventuell selbst diesen Weg einzuschlagen oder aber darum, dass diese sich selbstverständlich als relevante Teilnehmende an gesellschaftlichen Diskussionen zu wissenschaftlichen Themen zählen und ihre Ansichten und Ideen einbringen.
Die Forderung gilt nicht nur für Wissenschaftskommunikation spezifisch für Kinder und Jugendliche, sondern genauso für andere (mediale) Darstellungen. Die Forscherin und Kommunikatorin Paige Brown Jarreau hat beispielsweise zusammen mit Kolleg*innen die Initiative #scientistswhoselfie ins Leben gerufen, die Wissenschaftler*innen dazu aufrief, Selfies aus Ihrer Arbeit in Social-Media-Kanälen zu teilen. In einer anschließenden Studie konnte sie zeigen, dass dies keineswegs dazu führt, dass diese Wissenschaftler*innen als weniger kompetent wahrgenommen werden (wie von manchen befürchtet). Vielmehr zeigte sich, dass sie als freundlicher und vertrauenswürdiger eingeschätzt wurden und zudem ein wesentlich vielfältigeres Bild von Wissenschaftler*innen und ihrer Arbeit vermittelten.7
Forderungen und normative Wunschvorstellungen sind das eine, aber was bedeutet dieses Anliegen ganz konkret für unsere eigene Arbeit als Wissenschaftskommunikator*innen? Wo besteht dringender Handlungsbedarf? Welche positiven Ansätze und Beispiele gibt es?
| Johanna:
Beim Sichten der Einreichungen für den Wettbewerb Fast Forward Science achte ich als Jurymitglied neben den fachlichen, filmischen und technischen Komponenten auch darauf, inwiefern z. B. Aspekte der Diversität berücksichtigt werden. Welche Beispiele, Bildkompositionen, welche Expert*innen und welches Bildmaterial wird herangezogen, um das jeweilige Thema zu beleuchten? Hierbei fällt mir auf, dass sich manche Filmemacher*innen scheinbar wenig Gedanken darüber machen, welches Männer- und Frauenbild in ihren Videos vermittelt wird und setzen stattdessen auf das Reproduzieren von Stereotypen. Letztendlich sollte Wissenschaftskommunikation den Anspruch haben, die sogenannten „Querschnittsaspekte“ aus der Forschung – wie Diversität oder Nachhaltigkeit – auch in der Kommunikation sichtbar zu machen. Ich würde mir daher wünschen, dass visuelle Kommunikationsvorhaben von ihren Produzent*innen und Auftraggeber*innen immer auch auf eine diverse Bildsprache geprüft werden.
|
| Philipp:
Als Organisator und Moderator von Science Slams stehe ich selbst ganz konkret vor der Herausforderung, jedes Mal ein möglichst diverses Line-up zusammenzustellen. Dabei bin ich leider nicht immer erfolgreich. Trotz zusätzlicher Aktivitäten wie der gezielten Recherche von Slammer*innen, Workshops, individuellen Beratungsangeboten und reinen Frauen-Science-Slams als sichtbarem Zeichen, sind Slammer*innen auf der Bühne oft noch in der Minderheit. Ich freue mich, dass zunehmend auch das Publikum Vielfalt auf der Bühne einfordert und so das Anliegen unterstützt. Ich würde mir allerdings manchmal etwas mehr konstruktive Rückmeldung und Unterstützung wünschen, als nur eine nächste Social-Media-Empörungswelle. Beispielsweise die motivierende Ansprache von Wissenschaftlerinnen im eigenen Umfeld oder die Bereitschaft, auch selbst einmal vorzutragen. |
Sprache und Bildsprache
Die konsequente Berücksichtigung von nicht-männlichen Personen in der geschriebenen Sprache ist noch längst nicht Konsens in der Gesellschaft, der Rat für deutsche Rechtschreibung konnte sich noch nicht zu einer einheitlichen Empfehlung hinreißen lassen. Auch unter Wissenschaftler*innen und Kommunikator*innen sind viele noch der Meinung, dass mit dem generischen Maskulinum „die anderen ja mitgemeint“ seien. Alles andere sei nur umständlich. Dabei sagt die Studienlage etwas anderes.8 9 10Es sei übrigens angemerkt, dass in Studien auch die vermeintliche Unverständlichkeit von geschlechterbewussten Texten nicht beobachtet wurde11 und auch der oft bildungsbürgerlich-philologisch vorgetragene Verweis auf die historische Kontinuität des sogenannten „Generischen Maskulinums“ so nicht haltbar ist.12
Da dieses Thema aber meistenorts zumindest präsent ist, soll das Augenmerk hier auf einen zweiten, ebenso wichtigen Aspekt gelenkt werden: Das Entwickeln einer gleichberechtigten und diversen visuellen Bildsprache. Diese steckt in der Wissenschaftskommunikation noch in den Kinderschuhen. Zu häufig wird sich einer Bildsprache bedient, die keine Vielfalt abbildet oder sogar im Gegenteil Klischees reproduziert. Dies kann (leichtfertig) bewusst beim Versuch einer vermeintlich witzigen Kommunikationsmaßnahme geschehen oder auch gänzlich unbewusst. Ein häufiges Beispiel in der Wissenschaftskommunikation sind Abbildungen, in denen Männer Frauen etwas erklären. Rein numerisch können dann sogar Frauen in der Mehrheit abgebildet sein, die Bildsprache kommuniziert aber eine deutliche Hierarchie. Dabei ist weder entscheidend, ob es sich um eine tatsächliche Situation handelt (etwa die Abbildung einer Veranstaltung), oder um eine künstlerische Darstellung – selbst, wenn sie eigentlich anders gemeint war: Jede bildliche Darstellung wirkt auch ohne den weiteren Kontext je für sich selbst.
Abb. 2) Zwar ein Bild, auf dem mehr Wissenschaftlerinnen als Wissenschaftler abgebildet sind – aber die Bildsprache drückt ein deutliches Hierarchiegefälle aus. Dabei ist es umgekehrt, der unpromovierte Autor Philipp Schrögel erklärt hier seinen Kolleginnen Frau Dr. Kohler und Frau Dr. Leidecker-Sandmann die Welt.
Einige Hochschulen haben dies bereits erkannt und entsprechende Hilfestellungen für eine reflektierte Bild- und Mediensprache verfasst. Gute, öffentlich zugängliche Beispiele sind die Leitfäden der Universität Frankfurt und der Hochschule Fulda. Auch der Leitfaden der Stadt Freiburg bietet eine gute Übersicht und gibt viele konkrete Vorschläge, um visuelle Kommunikationsvorhaben in Bezug auf Diversität zu planen und zu überprüfen.
Sichtbarkeit und Repräsentation in der Community
Vermutlich haben schon einige Leser*innen Veranstaltungen und Konferenzen mit „All-Male-Panels“ erdulden müssen. Oft ist es im Nachhinein kaum plausibel, dass die Organisator*innen nicht Frauen hätten finden können, die Substanzielleres und Kohärenteres als manche Männer auf dem Podium hätten sagen können. Aber dies ist nicht die alleinige Aufgabe der Organisator*innen. Auch Institute und Forschungseinrichtungen können darauf Einfluss nehmen, wie ein Panel besetzt wird. Sie können etwa Referent*innen nur zu Veranstaltungen schicken, auf denen die Podien und Formate ausdrücklich nur gemischt-geschlechtlich besetzt werden. Dies ist in unterschiedlichen Abstufungen denkbar. Entweder man fordert, dass das eigene Panel oder auch alle Panels gemischt besetzt werden müssen. Sicher, eine Quote ist eine umstrittene Maßnahme, doch sie funktioniert. Die Konferenz re:publica erregt immer noch jedes Jahr aufs Neue Aufsehen damit, dass dort alle Panels paritätisch besetzt sein müssen.
Dringender Handlungsbedarf besteht aus unserer Sicht bei der Stärkung der Moderator*innen-Position auf wissenschaftlichen Konferenzen oder Podiumsdiskussionen. Zu oft werden verbale Übergriffe, ein schamloses Überziehen der vereinbarten Redezeit und eine Dominierung von Diskussionen mit haltlosen Behauptungen – meist durch ältere Männer in höhergestellten Positionen – ignoriert und als Teil eines üblichen Machtspiels akzeptiert. Wir plädieren dafür, hier künftig konsequent durchzugreifen und eine respektvolle und inhaltsbezogene Vortrags- und Debattenkultur für alle zu schaffen.
Als praktische Hilfestellung sei auf die Speakerinnen–Liste verwiesen: Wir möchten Organisator*innen dazu ermutigen, diese bei der Suche nach Referent*innen zu nutzen; Wissenschaftler*innen dazu, sich in die Liste einzutragen. Über die Frage der Zusammensetzung von Podien hinausgehend haben beispielsweise der Hopper Fund in Neuseeland und die Organisation Women in High Performance Computing Leitfäden für die Gestaltung diverser und inklusiver Konferenzen zusammengestellt.
Das Hierarchie-durch-Alter-Gefälle
Ein weiteres Bühnenproblem stellt häufig das Alters- und das damit zumeist einhergehende Hierarchiegefälle der Podienteilnehmer*innen dar. Weibliche Expertinnen sind in etlichen Fällen jünger als männliche Experten – meistens, weil sie in bestimmten Bereichen noch nicht so lange stärker präsent sind und deshalb noch nicht in den Hierarchien aufgestiegen sind. Hierdurch kann der Anschein aufkommen, dass die weibliche Expertin weniger Expertise besitzt– obwohl hier wesentlich ein Generationenkonflikt vorliegt. Deshalb muss ein besonderes Augenmerk auf die Moderation gelegt und von den Podienteilnehmer*innen bewusst mit ihrer Bühnenpräsenz umgegangen werden. Denn auch hier gilt, dass gesellschaftliche Repräsentation prägend ist und die inhaltliche Debatte begleitet.
Aktives Einfordern, Vorschläge machen und nicht nur beschweren
Dieses Alters- und Hierarchieproblem bringt auch ein weiteres Problem mit sich. Angenommen, ein junger und reflektierter Wissenschaftler möchte den Organisator*innen signalisieren, dass er sich mehr Diversity wünscht, und tritt von seinem Platz auf dem Podium zurück. Selbst wenn die Veranstalter*innen eine passende Wissenschaftlerin als Ersatz finden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die anderen Teilnehmer, die nicht von ihrem Platz zurücktreten, eher unreflektiertere Männer sind. Die Aktion des jungen Wissenschaftlers wäre also nur beschränkt wirksam, denn die Repräsentation von Frauen wäre zwar verbessert, gleichzeitig jedoch jene von jungen, engagierten und reflektierten Männern verschlechtert.
Hier sind wieder die Organisator*innen gefragt, den Impuls aufzugreifen und von sich aus neu über die Zusammensetzung ihrer Veranstaltung zu reflektieren. Aber genauso sind auch die engagierten Wissenschaftler selbst gefragt: Sie müssen nicht nur demonstrativ auf ihren Panelplatz verzichten, sondern ihr Handeln auch klar und deutlich kommunizieren, um so ein Signal an die Öffentlichkeit und die Organisator*innen zu senden. Aus Sicht der Organisator*innen sei hinzugefügt, dass konkrete Vorschläge für weibliche Wissenschaftlerinnen aus der eigenen Community mit der eigenen Verzichtserklärung an dieser Stelle vermutlich auf offene Ohren stießen.
Veränderung durch disruptive Momente
Über unsere Sprache und Bilder schaffen wir Realitäten und prägen, wie ein Phänomen oder ein Umstand wahrgenommen wird. Je mehr wir die Realität als Vorbild nehmen, etwas als „normal“ zu bezeichnen, umso schwerer machen wir es uns selbst, etwas an diesem Umstand zu ändern. So auch bei der Gleichberechtigung und Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen und vielfältigen Menschen in der Öffentlichkeit. Um eine neue, gleichberechtigte Realität herzustellen, müssen wir aber Veränderung herbeiführen. Wir müssen aufhören, die Dinge einfach so hinzunehmen, wie sie sind.
Erst, wenn wir durch ein Gendersternchen aus dem Lesefluss kommen oder uns über ein generisches Femininum wundern, erst, wenn uns über eine quotierte Redezeit bewusst wird, wie viel oder wie wenig sich einzelne Menschen zu Wort melden, können wir von diesen disruptiven Momenten lernen. Diese lassen uns innehalten, sie lassen uns reflektieren und überprüfen, ob unsere Handlungen mit unseren Werten übereinstimmen.
Daher lohnt es sich für Kommunikator*innen und Veranstalter*innen, weitere Strategien auszuprobieren, sich neue Methoden zu überlegen und diese konstruktiv zu diskutieren oder anzupassen. Sicher wird das auch Kritik hervorrufen, aber gleichzeitig wird es positive Signale setzen und zu neuen Sichtweisen anregen.
Es geht nicht, nicht betroffen zu sein
Neben der aktiven Kritik von wenigen erklärten (weitestgehend männlichen) Gegnern von Initiativen für mehr Gleichberechtigung und Sichtbarkeit, fehlt bei einem größeren Teil der Bevölkerung eher das allgemeine Bewusstsein dafür. Dies zeigt sich beispielsweise, wenn Frauen oder Männer sagen, dass sie sich nicht mit Gleichberechtigung auseinanderzusetzen brauchen, da sie dies in ihrem Alltag nicht betreffen würde. Dies stimmt allerdings zumeist nicht, denn der Gender-Pay-Gap etwa betrifft alle. Wenn Gleichberechtigung das neue Normal sein soll, werden aus der Perspektive auch Männer ungleich behandelt, wenn sie mehr Geld verdienen als Frauen. Und so sind wir alle stets in verschiedenen Lebensbereichen von der noch nicht erreichten Gleichberechtigung betroffen. Wir können nicht nicht betroffen sein. Ein Ignorieren bringt also nichts.
Diversity betrifft mehr als nur das Geschlecht
Wie bereits erwähnt– wir möchten es aber nochmal explizit betonen – ist die Vielfalt mehr als nur die gleiche Einbeziehung von Männern und Frauen – auch wenn wir dies als ein wiederkehrendes Motiv unseres Beitrages gewählt haben. Andere Geschlechteridentitäten sind ebenso relevant wie beispielsweise die gleichberechtigte Einbeziehung und Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung oder anderen kulturellen Hintergründen. Es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die Ungleichheit erzeugen.
Dabei ist hervorzuheben, dass diese verschiedenen Dimensionen nicht nebeneinanderstehen, sondern sich überlappen und verstärken können. Dieses Phänomen wird als Intersektionalität bezeichnet: Während also etwa Frauen und People of Color für sich genommen in einem bestimmten Kontext nicht repräsentiert sind, so sind weibliche People of Color in überproportionalem Maß betroffen.13 14
Es gibt keine perfekte Lösung, nur ein kontinuierliches Reflektieren
Auch wenn das gesamte Themenfeld eine komplexe und vielschichtige Herausforderung darstellt, möchten wir doch alle Kommunikator*innen dazu ermutigen, sich hiervon nicht aufhalten zu lassen. Es geht nicht darum, auf Anhieb perfekte Lösungen zu finden oder am Ende jedes einzelne Wort in mehrstündigen Teamsitzungen zu reflektieren.
Der wichtige erste Schritt ist, sich des Problems bewusst zu werden und Räume zu schaffen, in denen Lösungen und Strategien entwickelt und Kommunikationsaktivitäten selbst kritisch hinterfragt sowie kontinuierlich weiterentwickelt werden können. Dazu gehört auch bei Widerständen und Kritik: Ruhe bewahren.
Als Zweites möchten wir betonen, dass viele der oben genannten Probleme in der sprachlichen und visuellen Kommunikation stark kontextbezogen sind. Eine durch ein Bild kommunizierte diskriminierende Botschaft muss nicht im Originalkontext der Aufnahmesituation diskriminierend gewesen sein, sie kann aber durch eine Rekontextualisierung dazu werden.
Und als Letztes: Kritik an einem problematischen oder diskriminierenden Verhalten meint nicht immer (zumindest im Idealfall), dass die Person oder Organisation an sich diskriminierend ist. Derartige Aussagen haben meist konkreten Bezug zu einer bestimmten Kommunikationspraxis oder Verhaltensweise.
Fazit
Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bis Gleichberechtigung wirklich zur Normalität geworden sein wird. Der anstehende Generationenwechsel wird diese Entwicklung in den Hochschulen und in Führungspositionen beschleunigen. Die neuen Generationen werden mit einem veränderten Bewusstsein und einer selbstverständlichen Haltung auf Diversität und Sichtbarkeit achten. Trotzdem ist es unumgänglich, sich weiter mit Hierarchien und Machtgefällen zu beschäftigen, um nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch wirkliche Gleichberechtigung zu kommunizieren und eine produktive Wissenschaftskultur zu erreichen.
Diese Veränderung kostet uns alle. Sie kostet Zeit, sie kostet Geld, sie kostet sicher einige Personen ihren Chefsessel und sie kostet vor allem Mut. Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen dazu bereit sind, diesen Preis zu zahlen und sich nicht mehr mit weniger zufriedengeben. So berücksichtigt Wissenschaftskommunikation ihren gesellschaftlichen Auftrag und ihre Vorbildfunktion auf vielfältige Art und Weise.
Wir sind uns dessen bewusst, dass wir nicht alle Aspekte aufgreifen und ihnen angemessenen Raum geben konnten. Unsere Entscheidung, uns für diesen Beitrag zu zweit zusammenzutun, bedeutet nicht, dass wir andere Genderidentitäten, People of Color und andere bisher weniger repräsentierte Menschen damit ausgrenzen möchten. Wir möchten andere Kommunikator*innen ermutigen, einen Schritt in eine gleichberechtigte Zukunft zu gehen. Wir freuen uns auf Kommentare und Ergänzungen aus allen Perspektiven unter diesem Artikel!

Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsweise die Meinung der Redaktion wider.
Für gewöhnlich wird auf dem Portal Wissenschaftskommunikation.de ohne Sternchen gegendert. Statt dessen werden etwa Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgeschrieben. Da es hier jedoch genau um das Thema geht, haben wir es in diesem Text der Autorin und dem Autor freigestellt, selbst eine Schreibweise zu wählen.