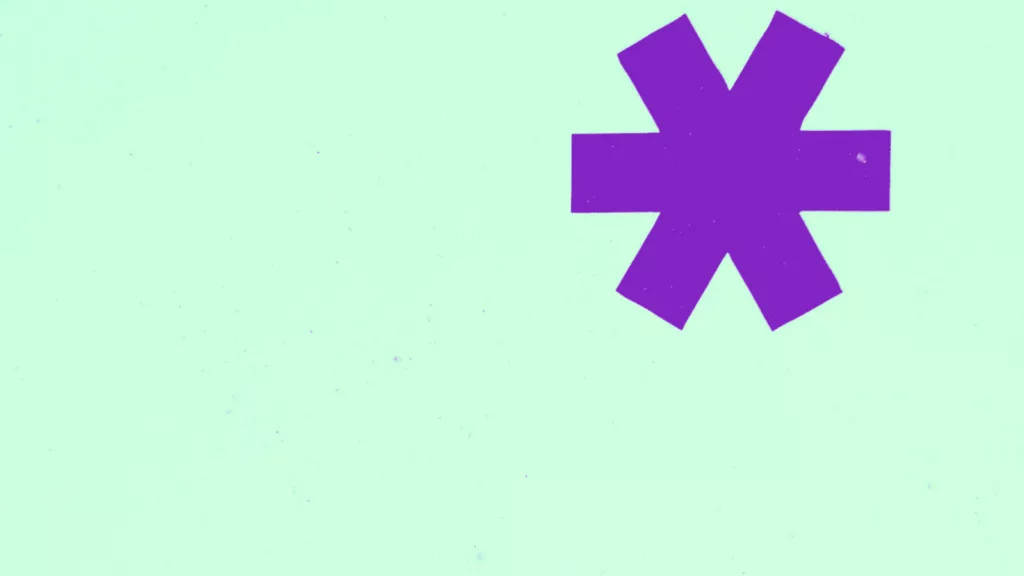Der Sprachphilosoph Philipp Hübl kritisiert das Gendern. Warum er Studien zur geschlechtergerechten Sprache für fragwürdig hält und welche Alternativen es zum Genderstern gibt – ein Gespräch über die differenzierte Betrachtung jenseits der Extrempositionen.
„Gendern ist das Latein der neuen Eliten“
Herr Hübl, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Sprachphilosophie. Häufig wird die Meinung vertreten, dass Sprache formt, wie wir die Welt wahrnehmen. Trägt eine männlich geprägte Sprache zu einem männlich geprägten Blick bei?

Das würde ich verneinen. Ich glaube weder, dass die deutsche Grammatik männlich geprägt ist, noch gibt es bisher gute Belege für diese starke These. Es ist häufig umgekehrt. Durch Bildung und Erziehung verändern sich unsere Normen und unser Weltbild. Das schlägt sich auch in der Sprache nieder. Weil wir heute sensibler sind für moralisches Unrecht, wollen wir das auch sprachlich ausdrücken. Aber es ist nicht so, dass sich zuerst die Sprache wandelt und die Menschen daraufhin ihre moralischen und politischen Auffassungen ändern. Es gibt Untersuchungen1, die zeigen, dass politische und moralische Ansichten über die Zeit relativ stabil sind. Es ist schwierig und langwierig, dies zu ändern.
Es gibt jedoch Studien, die zeigen, dass sich gendergerechte Sprache positiv auf die Sichtbarkeit von Frauen und nicht-binären Geschlechtsidentitäten auswirken kann. Im Rahmen einer Vorlesung an der Universität der Künste Berlin kritisierten Sie genau diese Studien. Worin besteht Ihre Kritik?
Die Forschung vertritt im Wesentlichen zwei Thesen. Die stärkere besagt, dass das generische Maskulinum wie in „Die Besucher waren begeistert“ dazu führe, dass Männer im Beruf und Alltag bevorzugt werden, weil die Sprache Frauen diskriminiert oder unsichtbar macht. Doch die meistzitierten Versuche, die das belegen sollen, sind sprachphilosophisch naiv oder sogar grammatisch falsch2. Sie verwenden zum Beispiel nicht-generische Formen wie „Ein Arzt kommt ins Zimmer“, machen dann aber Aussagen über das generische Maskulinum3.
Die schwächere These lautet, dass selbst wenn das generische Maskulinum keinen unmittelbaren Einfluss auf unser Denken habe, wir trotzdem gendern sollten, aus „Respekt“, „Solidarität“ oder „Höflichkeit“. Auch dahinter steckt eine kausale These, nämlich, dass die Welt besser wird oder es weniger Ungerechtigkeit gibt, wenn wir die Sprache ändern. Das ist aus meiner Sicht noch eine offene Frage. In einigen Studien5 haben Probanden nicht häufiger an Frauen gedacht, wenn sie zum Beispiel „Pilot*innen“ statt „Piloten“ gelesen haben. Und in vielen Studien sind diese Effekte sehr klein. Da muss man sich fragen: Lohnt es sich, mit hohem Aufwand die Sprache so stark zu verändern, dass ein paar Leute in ihren privaten Assoziationen zu Berufsbezeichnungen etwas egalitärer werden?
Können Sie die sprachphilosophischen Probleme dieser Studien näher erläutern?
Man muss genau hinschauen und unterscheiden: Verstehen die Leute die Sätze und was visualisieren sie vor ihrem inneren Auge, wenn sie den Satz hören? Das wird oft verwechselt. Das ist ein klassischer Denkfehler, der in der Bedeutungstheorie diskutiert wird. Um einen Satz zu verstehen, so dachte man früher, müsse man Vorstellungen, also Bilder im Kopf, zusammensetzen. Wenn ich zum Beispiel höre: „Der Hund bellt“, dann stelle ich mir den Hund vor und verstehe daher den Satz.
Allerdings visualisieren Menschen einen Satz häufig gar nicht oder denken an etwas anderes, also beim Hundebeispiel der eine an einen Dackel, der andere an einen Schäferhund. Einen Satz verstehen heißt nicht, Bilder im Kopf zu haben, sondern die Bedeutung zu verstehen, also wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. All die Experimente, die fragen: „An wen denkst du, wenn du ‚die Lehrer‘ oder ‚die Besucher‘ hörst? “, sagen vielleicht etwas über die teils stereotypen Vorstellungen und Assoziationen einer Person aus, haben aber so gut wie gar nichts mit Sprachverstehen zu tun.
In einem anderen Interview sagten Sie, dass viele Deutsche für Vielfalt sind, aber eher gegen Gendern. Wie erklären Sie sich diese Kluft?
Ziel und Mittel werden oft verwechselt. Die meisten Menschen wollen eine gerechte Gesellschaft, in der Männer, Frauen und andere Geschlechtsidentitäten fair und diskriminierungsfrei behandelt werden. Eine repräsentative Umfrage des Familienministeriums hat ergeben, dass 95 Prozent der Befragten Gleichstellungspolitik befürworten. Aber in zahlreichen großen Umfragen lehnen mindestens zwei Drittel das Gendern ab6.
Offenbar gibt es eine große Schnittmenge, die nicht will, dass gegendert wird, aber gleichzeitig will, dass Männer und Frauen gleichbehandelt werden. Daraus könnte man schließen, dass Gendern für sie nicht das Mittel ist, um Gleichberechtigung sicherzustellen. Aus einer progressiven Perspektive wird dies jedoch oft überblendet. Wer Gendern aus sprachwissenschaftlicher Kritik heraus ablehnt, wird zum Beispiel als jemand gesehen, der damit auch das Ziel ablehnt, nämlich Gleichberechtigung.
Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptargumente gegen das Gendern, insbesondere in wissenschaftlichen Kontexten?
Der generische Plural, der im Deutschen zufälligerweise maskulin ist, funktioniert und wird von allen verstanden7. Wäre das nicht so, müssten wir bei Sätzen wie „Die Zuschauer klatschten“ oder „Die Steuerzahler werden entlastet“ ständig nachfragen: Saßen da auch Frauen im Publikum? Zahlen auch Frauen Steuern?
Wer trotzdem die Sprache ändern will, müsste das sehr gut begründen. Auf den ersten Blick sieht die empirische Evidenz der vielzitierten Experimente auch gut aus. Doch diese Experimente sind nun gerade nicht sprachwissenschaftlich fundiert oder repräsentativ. Gerade, wenn die Mehrheit der Deutschen das Gendern ablehnt, benötigt man besonders starke Evidenz, die für das Gendern spricht.
Aber denken Sie nicht, dass die Wissenschaft, was geschlechtergerechte Sprache betrifft, mit gutem Beispiel vorangehen sollte?
Was ist kritisch an aktivistischer Wissenschaft?
Wissenschaft und Aktivismus haben zwei innere Logiken. Die Wissenschaft belohnt Leute, die kritisch sind und dem Mainstream mit guten Argumenten widersprechen. Sie können die Forschung verbessern, wenn sie Fehler oder Erkenntnislücken finden. Eine Forscherin wird mit Anerkennung belohnt, wenn sie etwas findet, das den Status quo in Frage stellt. Im Aktivismus ist das genau umgekehrt. Wenn man für eine Sache kämpft, müssen alle mitziehen. Wer da Kritik anmeldet, klingt illoyal. Beide Denkstile passen also nicht gut zusammen.
Einige argumentieren, dass Gendern dazu führen könnte, dass die Wissenschaft weniger zugänglich wird, was der Idee der verständlichen Wissenschaftskommunikation widersprechen könnte. Zum Beispiel könnten Probleme bei der Lesbarkeit oder beim Erlernen der deutschen Sprache auftreten. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das ist ein Problem vieler Progressiver: Sie wollen die richtigen Signale an ihre eigene Gruppe senden. Dabei vergessen sie, dass es in der digitalen Kommunikation mehrere Adressaten gibt. Viele Forscher fragen sich nicht so sehr: Was ist eigentlich mit den anderen Leuten, die ich erreichen will? In der Wissenschaftskommunikation muss man aber nicht nur die 20 Prozent Akademiker in Deutschland erreichen, sondern auch andere Gruppen und Interessierte. Tatsächlich ist Gendern ein Progressivitätsmarker, ein Erkennungszeichen der akademischen Eliten. Damit macht man die Welt nicht gerechter, aber man zeigt, dass man zur richtigen Gruppe gehört.
Was sind denn, im Gegensatz zum Gendern, wirkungsvolle Mittel für eine geschlechtergerechte Sprache?
Wenn man konkret mit einer Gruppe spricht, verlangt es schon die Höflichkeit und der Respekt, beide Geschlechter anzusprechen, daher sagen wir ja „Sehr geehrte Damen und Herren“. In den meisten Experimenten hat die Anrede mit beiden Geschlechtern einen stärkeren Effekt auf die Assoziationen als das Gendersternchen, auch wenn die beide Effekte, wenn überhaupt messbar, relativ gering ausfallen.
Aber es gibt natürlich ein Problem: Wenn man anfängt, ständig darüber nachzudenken, wie man Nomen vermeiden kann, dann wird der Sprachstil passiv und technisch. Häufig entstehen dann Notlösungen wie „es hat sich herausgestellt“ oder „die Coachenden“, „die Arztleute“ oder „die Linguistikkräfte“, die sprachästhetisch nicht schön oder teilweise semantisch falsch sind. Forschung wird von Menschen gemacht und es ist wichtig, diese Menschen auch im Detail zu benennen. War es ein kleines Team, war es nur eine Forscherin? Das sollte klar benannt werden.
Die Debatte um das Gendern wird teilweise sehr aggressiv geführt. Was kann man tun, um kontroverse Debatten wie diese konstruktiver zu führen? 
Die eigentlichen Fragen sind komplexe, wissenschaftstheoretische, sprachphilosophische, linguistische und moralische Fragen. Die Außenpositionen sind klar – total dafür oder total dagegen. Doch die differenzierte Mittelposition einzunehmen ist unglaublich schwer geworden. Darüber müsste mehr diskutiert werden. Es gibt inzwischen sehr viele Leitfäden, die einem erklären, wie man „richtig“ gendert. Aber nirgends lese ich, dass die Datenlage vollkommen unklar ist und dass Gendern nicht die Effekte hat, die die Aktivisten sich wünschen. Bei vielen Wohlmeinenden löst es eher eine Abwehrreaktion aus.
Anmerkung der Redaktion: Üblicherweise verwenden wir den Genderstern. In diesem Interview verzichten wir auf Wunsch des Gesprächspartners darauf.
Weitere Beiträge zum Thema
„Der Vorteil des Genderns ist Präzision“ – Die Debatte um das Gendern wird seit Jahren kontrovers geführt. Wir fragen die Journalistin Christine Olderdissen: Wie hält sie’s mit dem Gendern in der Wissenschaftskommunikation?