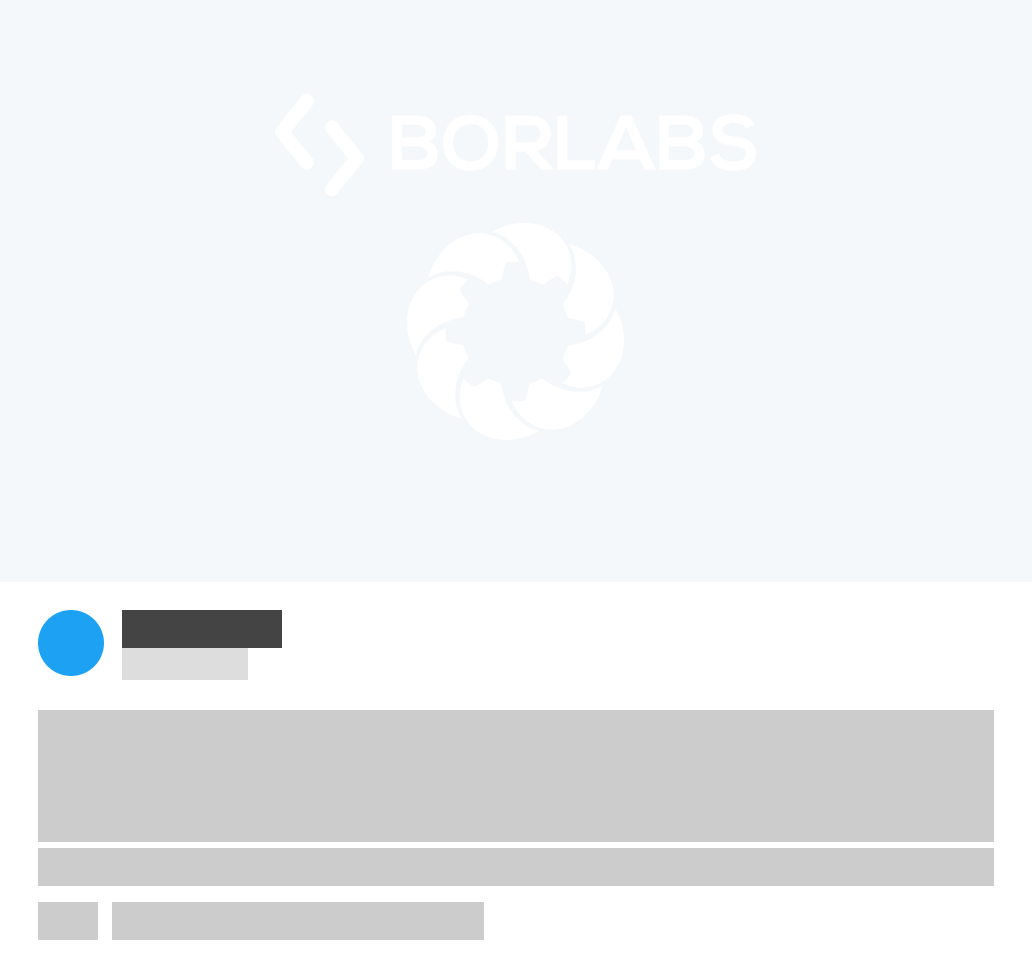Fördergelder, Karrierechancen, Publicity – Werden Forschungsthemen mehr und mehr nach Popularität gewählt? Diese Frage stellte Botaniker Norbert Holstein im Laufe der Debatte um Wissensvermittlung in der Hochschulkommunikation. Im Gastbeitrag beschreibt er, wie Wissenschaftler unter Druck geraten und überlegt, wie man ihn rausnehmen könnte.
Für wen forschen wir eigentlich? Theorie und Praxis
Die Fragen nach dem Was und Warum in der Forschung sind spannend und von allgemeiner Relevanz. Besonders zwei Aspekte sprechen dabei viele Menschen an: die Befriedigung der menschlichen Neugier und der Fortschritt. Während man der Neugier die unschuldig-kindliche Freude am Entdecken zugesteht, hat die zielgerichtete Forschung zum menschlichen Nutzen auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Gleichzeitig ist Forschung auch Lohnarbeit. Die Finanzierung der Projekte sichert damit oft auch den Lebensunterhalt des Forschenden und sie muss immer wieder erst durch Anträge gesichert werden. Die Einwerbung von Drittmitteln (gerne auch aus der Wirtschaft) ist heutzutage ein Kernaspekt des wissenschaftlichen Daseins. Mit der Finanzierung hat man aber dann auch einen Auftraggeber – sei es der Staat, eine Firma oder eine Stiftung. Fakt ist: Die Forschung ist zu großen Teilen von der Öffentlichkeit finanziert, vor allem durch die DFG oder Ministerien über die Steuern. Selbst Firmen bekommen ihr Geld letztendlich von ihren Kunden und Aktionären, die ebenfalls Teil der Öffentlichkeit sind. Wem legt man nun aber Rechenschaft ab? Nur dem direkten Geldgeber oder auch der Öffentlichkeit?
Solange es reale Widersprüche gibt, wird es auch Wissenschaftsskepsis geben
Skepsis kommt auf, wenn Bürgerinnen und Bürger vermuten, dass es verdeckte Ziele gibt. Und darin liegt das Problem. So vielfältig wie die Geldquellen sind die Ziele der Geldgeber – und auch die individuellen Ziele des Wissenschaftlers. Mit Dauerbefristungen baut er sich keine Zukunft auf. Deshalb möchte oder muss er eventuell eine eigene Firma gründen, mittelfristig in die industrielle Forschung oder zu einem anderen Arbeitgeber wechseln. Er wäre also recht naiv, potenzielle Geld- oder Arbeitgeber (Wirtschaft oder NGOs) offen zu kritisieren. Seine Unabhängigkeit ist damit in der öffentlichen Wahrnehmung damit unter Umständen aber passé. Der Verdacht der Befangenheit verstärkt sich, wenn es Berichte gibt, dass „unliebsame“ Studienergebnisse nicht veröffentlicht oder wegen Erfolgsdrucks geschönt werden. Dass die Folgen davon immens sein können, zeigt die Headline „Autismus durch Impfen“ oder diverse zweifelhafte Lebensmittelstudien, die sich beharrlich im Netz halten. Eine sachliche Diskussion über Gentechnik, Glyphosat, Homöopathie, Impfschäden oder Ernährung ist nur noch sehr schwer möglich. „Aufklärung“ allein hilft nicht, wenn es kein Vertrauen gibt. Es hat auch nichts mit der Bildung zu tun, wenn selbst Akademiker ihre Kinder nicht mehr impfen lassen12. Solange es also Gründe gibt, skeptisch zu sein, wird man immer wieder auf taube Ohren stoßen. Da nutzen einem die vielfältigsten und kreativsten Vermittlungsarten oder besten Zielgruppenanalysen nichts.
Kommunizieren – warum eigentlich?
Aber gehen wir vom Fall der unabhängigen und integren Wissenschaftler aus, von denen es ja mehr als genug gibt. Das Ablegen der Rechenschaft ist bei großen Geldgebern wie der DFG oder Stiftungen verpflichtend. Andernfalls gibt es Schwierigkeiten bei erneuten Anträgen. Warum sollte man als Wissenschaftler aber seine Forschung auch der Öffentlichkeit kommunizieren? Eine Verpflichtung gibt es dazu allenfalls aus moralischen Gründen. Für Wissenschaftler selbst hat es aber keinen positiven Einfluss auf die Karriere. Im Gegenteil: Der berufliche Alltag vieler Wissenschaftler besteht bereits mehr als genug aus unbezahlten Überstunden und Wochenendarbeit, meist bei befristeten Arbeitsverhältnissen. Zur Forschung kommen Anträge schreiben, Lehre, Betreuung der Nachwuchswissenschaftler, Gremienarbeit, Verwaltung und Peer-Review-Tätigkeiten hinzu.
Forschungskommunikation ist zusätzliche Arbeit, die man nirgends lernt und die nicht trivial ist, selbst wenn sie professionell unterstützt wird. Ja, sie kann bei Interesse sehr viel Spaß machen. Sie kostet aber auch eine sehr wertvolle Ressource: Zeit. Es ist mittlerweile eine Frage der Ökonomie, sich auf die Kernarbeit (Forschung, Drittmittel einwerben) zu konzentrieren. Selbst die Lehre wird teils eher stiefmütterlich behandelt. Und wer kann es den Wissenschaftlern verübeln? Weder die Qualität der Lehre noch die der Ausbildung der Nachwuchswissenschaftler, Review-Tätigkeiten und schon gar nicht Öffentlichkeitsarbeit sind irgendwann von größerer Relevanz. Ja, es gibt Lehrevaluation und es gibt Publons3 und Altmetrics. Wer aber eine feste Stelle hat, braucht sich nicht um Konsequenzen zu scheren, und wer eine möchte, wird oft nicht einmal danach gefragt. Es gibt mehr als genug Stellen, die – außer durch Vitamin B – vor allem nach Publikationszahl, deren Impactfaktor4 und eingeworbenen Geldern vergeben werden. Und selbst wenn man Öffentlichkeitsarbeit einbeziehen würde, wie gewichtet man sie? Entsprechen 1.000 Twitterfollower einem Artikel in der Zeitschrift Nature oder ein Sieg beim Science Slam in Frankfurt einem Drittmittelantrag über 10.000 €?
Popscience für Publicity
Man könnte nun Pressemitteilungen über Forschungspublikationen zur Pflicht machen und ein positives Feedback (Presseartikel, Berichte) ebenso zu quantifizieren und gewichten versuchen. Ansätze mit Altmetrics und Impactstory sind da. Doch das ist ein zweischneidiges Schwert. Es könnte eine Chance sein – aber auch bestimmte Forschungsbereiche noch weiter marginalisieren. Wissenschaftsjournalisten stehen ebenfalls unter Druck und müssen für eine gute Auflage oder Quote spannende Themen aufgreifen. Populäre Themen wie Astronomie oder Dinosaurier lassen sich gut verkaufen. Wissenschaftsgeschichte oder Kuriositäten hätten da, gut aufbereitet, auch gewisse Chancen, öffentlichkeitswirksam zu sein. Andere, sehr spezielle Themen – selbst wenn zur wissenschaftlichen Erkenntnis wichtig – hätten es aber noch schwerer. Wird Wissenschaftskommunikation also für Forscher zur Pflicht, könnten Forschungsziele stärker auf mediale Verkaufbarkeit getrimmt werden. Ähnlich wie bei der Stellenvergabe zunehmend auf Impactfaktoren und Drittmitteleinwerbung geschielt wird, wird auch hier ein Optimierungszwang herrschen, mit allen Anreizen, das System auch zu überlisten. Bereits jetzt haben wir mit Problemen zu kämpfen, die die Integrität der Wissenschaft unterminiert. Der Impactfaktor-Wahn brachte Fälschungen56 , Zitierkartelle7, und Quick-and-Dirty-Forschung8 hervor. Man sollte sich also zwingend überlegen, ob Popularität und schnelle Zitierbarkeit das Maß für die wissenschaftliche Qualität und den Langzeitwert sein kann und ob man weiter in diese Kerbe schlagen möchte.
Wissenschaft ist immer kompetitiv. Wenn es nur um den Ruhm geht, ist es eine Frage des Egos, ob man seine Integrität bewahren kann. Solange am Gelingen aber die Karriere oder schlicht und ergreifend Lohn und Brot hängen, wird es immer ein Risiko der Kompromittierung9 geben. Kompromittierung schadet nicht nur einem Wissenschaftler selbst früher oder später, sondern der gesamten Wissenschaft. Die Konsequenzen beginnen wir jetzt zu spüren. Ein weiter so wird das, teils nicht unberechtigte, Misstrauen nicht reduzieren. Die Psychologie zeigt, dass Druck nur initial zu mehr Leistung führt, und bei Überhöhung zu Beschränkung auf das Nötigste1011.
Entsprechend würde eine Reduktion Energie für das moralisch richtige Handeln wie die Forschungskommunikation frei werden lassen. Die Ursachen der hakenden Kommunikation und der Wissenschaftsskepsis liegen nicht (nur) am mangelnden Willen, sondern in realen Zwängen und Widersprüchen, die es zu lösen gilt.
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.