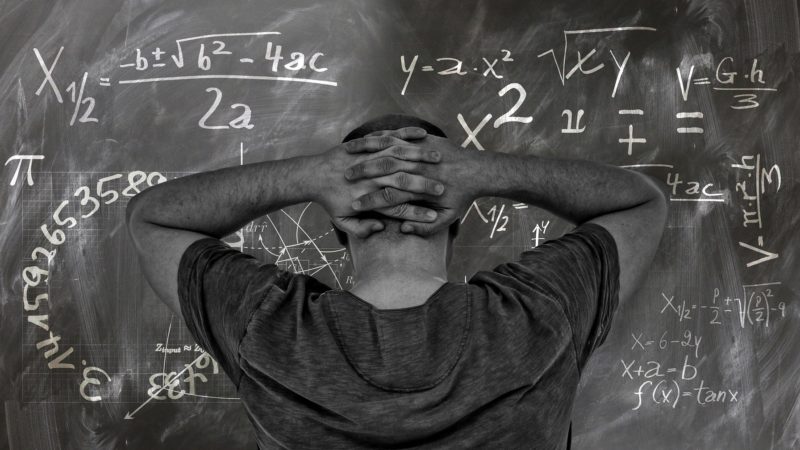Wissenschaft kann spannend erzählt werden, so die Devise der Wissenschaftsjournalistin Kristin Raabe. Warum die Heldenreise auch bei wissenschaftlichen Themen funktioniert, erklärt sie in ihrem Gastbeitrag.
Forscher auf der Heldenreise – Wissenschaft spannend erzählen
Die Schlüsselszene einer der erfolgreichsten Erzählungen des 20. Jahrhunderts spielt in einem nebligen Halbdunkel. Lediglich ein paar kahle Bäume beleben die Szenerie, als der Held gerade seinen Proviant auspackt, um eine Mahlzeit einzunehmen. Der Zuschauer ahnt Schlimmes: Jederzeit könnte ein Monster aus dem Sumpf hervorspringen und sich auf den Helden stürzen. Aber stattdessen taucht ein grünhäutiger Gnom mit riesigen Augen und noch größeren Ohren auf. Die erste Begegnung zwischen Luke Skywalker und Meister Yoda hat Kinogeschichte geschrieben. Star Wars hätte es wohl so nie gegeben, wäre ihr Erfinder, George Lucas, nicht auf die Schriften seines „persönlichen Meister Yoda“ gestoßen. So pflegte er den Literaturwissenschaftler Joseph Campbell zu nennen. Dessen Buch „Der Held mit den tausend Gesichtern“ lieferte Lucas die Vorlage für seine Drehbücher zu Star Wars. Campbell untersuchte darin eine Vielzahl von Mythen, Legenden und Märchen – von den Erzählungen Homers bis hin zu mündlich überlieferten Geschichten der Inuit Alaskas. In allen untersuchten Erzählungen erkannte der Mythenforscher ein und dasselbe Muster. Immer ging es um einen Helden, der sich auf eine Reise begab.
Wissenschaftsgeschichten erzählen!
Seither mehren sich die Forschungen zu Geschichten. Vor allem Psychologie und Hirnforschung haben klären können, dass Geschichten besser im Gedächtnis bleiben als bloße Informationen. Was also läge näher, als genau diese Erkenntnisse in der Wissenschaftskommunikation einzusetzen? Anstatt einfach nur über Forschungsergebnisse zu berichten, könnten Kommunikatoren und Kommunikatorinnen Wissenschaftsgeschichten erzählen!
Obwohl mittlerweile eine Vielzahl von Studien die Wirksamkeit von Geschichten belegt haben, sind die Ressentiments gegenüber erzählenden Ansätzen in der Wissenschaftskommunikation immer noch recht groß. „Ich bin Wissenschaftler, kein Geschichtenerzähler“, diesen Satz – gesprochen mit einem gewissen Maß an Entrüstung in der Stimme – stammt von einem Wissenschaftler in einem meiner Kommunikationsseminare am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik). Er beschreibt ziemlich deutlich die Grundhaltung, mit der Forschende und andere Wissenschaftskommunikatoren an das Thema „Wissenschaftsgeschichten“ herangehen.
Ich behaupte, dass eher das Gegenteil zutrifft: Glattgebügelte Forschungsergebnisse ergeben selten eine gute Geschichte. Wer eine wahre Forschungsgeschichte erzählen will, muss den Mut aufbringen, unangenehme Informationen offen auszusprechen und bereit sein, auch auf Details einzugehen. Eine Wissenschaftsgeschichte ist nämlich oft dann am spannendsten, wenn sie über jene Teile des Forscherlebens berichtet, die normalerweise keinen Eingang in wissenschaftliche Veröffentlichungen finden, den wissenschaftlichen Alltag aber stark prägen: Rückschläge, fehlerhafte Theorien, ergebnislose Experimente und Fehlfunktionen in Messinstrumenten beispielsweise.
Fehlschläge bewältigen, Rückschläge überwinden
Nichts ist langweiliger als der Satz mit dem zumindest in Deutschland gefühlt jede zweite Pressemitteilung beginnt: Forscher XY hat herausgefunden, dass… Spannung entsteht erst dann, wenn die Lösung für das zu erforschende Problem nicht so einfach errungen werden kann. Auch für die Wissenschaft gilt: Erst die vielen Fehlschläge, die ohne Zweifel alle Forschenden bewältigen müssen, machen sie zu Helden und Heldinnen. Damit eröffnet ein Geschichten-Ansatz in der Wissenschaftskommunikation erhebliche Chancen. Sprechen Forschende in der Öffentlichkeit über all die Hindernisse und Rückschläge, die sie erleben, verlassen sie damit automatisch den sprichwörtlichen Elfenbeinturm und werden für ihr Publikum berührbar. Ein echtes Verständnis für die Prozesshaftigkeit des wissenschaftlichen Arbeitens kann so entstehen. Damit könnten Wissenschaftsgeschichten viele Probleme lösen, mit denen Wissenschaftskommunikatoren und Wissenschaftskommunikatorinnen in postfaktischen Zeiten konfrontiert sind! Noch mehr Sachlichkeit, noch mehr Fakten schaffen nicht unbedingt mehr Glaubwürdigkeit. Nahbare Forschende, die bereit sind, auch von ihren Fehlschlägen zu erzählen, könnten dagegen die ein oder andere Brücke schlagen.
Die Vorteile des Geschichtenerzählens in der Wissenschaftskommunikation liegen also auf der Hand. Für die Umsetzung könnten Kommunikatoren die gleichen Hilfen nutzen, die auch George Lucas bei den Drehbüchern für seine Star-Wars-Filme anwandte.
Die 17 Stadien der Heldenreise
Die von Joseph Campbell entwickelte Heldenreise besteht im Original aus 17 Stadien. Eine verkürzte Fassung hat Christopher Vogler 1998 in seinem Buch „The Writers Journey“ veröffentlicht. Sie umfasst 12 Abschnitte:
- Ausgangspunkt ist die gewohnte, langweilige oder unzureichende Welt des Helden.
- Der Held wird von einem Herold zum Abenteuer gerufen.
- Diesem Ruf verweigert er sich zunächst.
- Ein Mentor überredet ihn daraufhin, die Reise anzutreten, und das Abenteuer beginnt.
- Der Held überschreitet die erste Schwelle, nach der es kein Zurück mehr gibt.
- Der Held wird vor erste Bewährungsproben gestellt und trifft dabei auf Verbündete und Feinde.
- Nun dringt er bis zur tiefsten Höhle, zum gefährlichsten Punkt, vor und trifft dabei auf den Gegner.
- Hier findet die entscheidende Prüfung statt: Konfrontation und Überwindung des Gegners.
- Der Held kann nun den „Schatz“ oder „das Elixier“ (konkret: ein Gegenstand, oder abstrakt: besonderes, neues Wissen) an sich bringen.
- Er tritt den Rückweg an, während dessen es zu seinem Entrinnen aus der Todesnähe kommt.
- Der Feind ist besiegt, das Elixier befindet sich in der Hand des Helden. Er ist durch das Abenteuer zu einer neuen Persönlichkeit gereift.
- Das Ende der Reise: Der Rückkehrer wird zu Hause mit Anerkennung belohnt.
Es fällt gar nicht so schwer, dieses Muster auch auf eine typische Wissenschaftsgeschichte anzuwenden. Forschende betreten ständig fremde Welten (mikroskopisch kleine Welten, das Weltall, die Welt des Körperinneren etc.), um dort Antworten auf ihre Fragen zu finden. Fast immer haben sie einen Mentor, der sie und ihre Ideen fördert. Um wissenschaftliche Fragestellungen zu beantworten, müssen sie Rätsel lösen, Tests bestehen, mit Kolleginnen kooperieren und die Argumente von wissenschaftlichen Gegnerinnen entkräften. Wenn ihnen das gelungen ist, haben sie vielleicht den entscheidenden Geistesblitz, der sie zu ihrem wichtigsten Experiment inspiriert. Mit diesem Experiment entscheidet sich, ob sie ihre wissenschaftliche Frage beantworten, sie neues Wissen erlangen und damit vielleicht ein Problem in der gewöhnlichen Welt bewältigen können. Die Elemente einer Heldenreise sind bei vielen Wissenschaftsthemen vorhanden. In der eigentlichen Erzählung kommt es dann darauf an, diese Elemente auch deutlich herauszuarbeiten.
Geschichten mithilfe einer Hauptfigur erzählen
Eine andere etwas einfachere Vorgehensweise orientiert sich an der Hauptfigur. Jede Geschichte benötigt eine Hauptfigur. Diese muss allerdings kein Mensch sein, es kann genauso gut ein Tier, eine Pflanze, eine Mikrobe, ein Gegenstand, eine Institution, eine Gruppe oder sogar eine Theorie sein. Je nach Wahl der Hauptfigur ergeben sich unterschiedliche Herausforderungen, andere Motive und gelegentlich auch interessante Perspektiven. Die Geschichte wird immer aus der Perspektive der Hauptfigur erzählt und folgt in der Regel einem einfachen Schema:
Im ersten Schritt wird die Bühne bereitet, das heißt die Hauptfigur wird eingeführt und das Problem geschildert. Welche Hauptfigur bei einem Thema gewählt wird, ist auch abhängig von der Zielgruppe. Es folgt die Herausforderung, die bewältigt werden muss, bis zum Höhepunkt, der das Ergebnis oder die Entdeckung beschreibt. Daraus wird die Lösung des Problems und zu guter Letzt das Fazit beziehungsweise die Botschaft abgeleitet.

Ihr komplettes Potenzial können wahre Wissenschaftsgeschichten vor allem in einigen anderen Kommunikationsformen zeigen, die heutzutage von Hochschulen und Forschungsinstituten genutzt werden. Sie bespielen eigene Youtube-Kanäle, verfügen über aufwendig produzierte Magazine und liefern auf Ihren Websites Einblicke in ihre Arbeit. Hinzu kommen Ausstellungen, Tage der offenen Tür und ähnliche Veranstaltungen, bei denen die ein oder andere Forschungsgeschichte auch ihren Platz finden könnte. Denn eine gute Geschichte funktioniert in jedem Medium. Sie braucht nicht unbedingt eine gigantische Kinoleinwand oder aufwendig produzierte Animationen. Fragen Sie Ihre Forschenden nach Ihren Fehlschlägen, ermuntern Sie sie, über ihre Inspiration, ihre Mentoren zu sprechen und ihre Begeisterung für ihr Thema zu zeigen. Die Geschichten sind da, sie wollen nur entdeckt werden.
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.