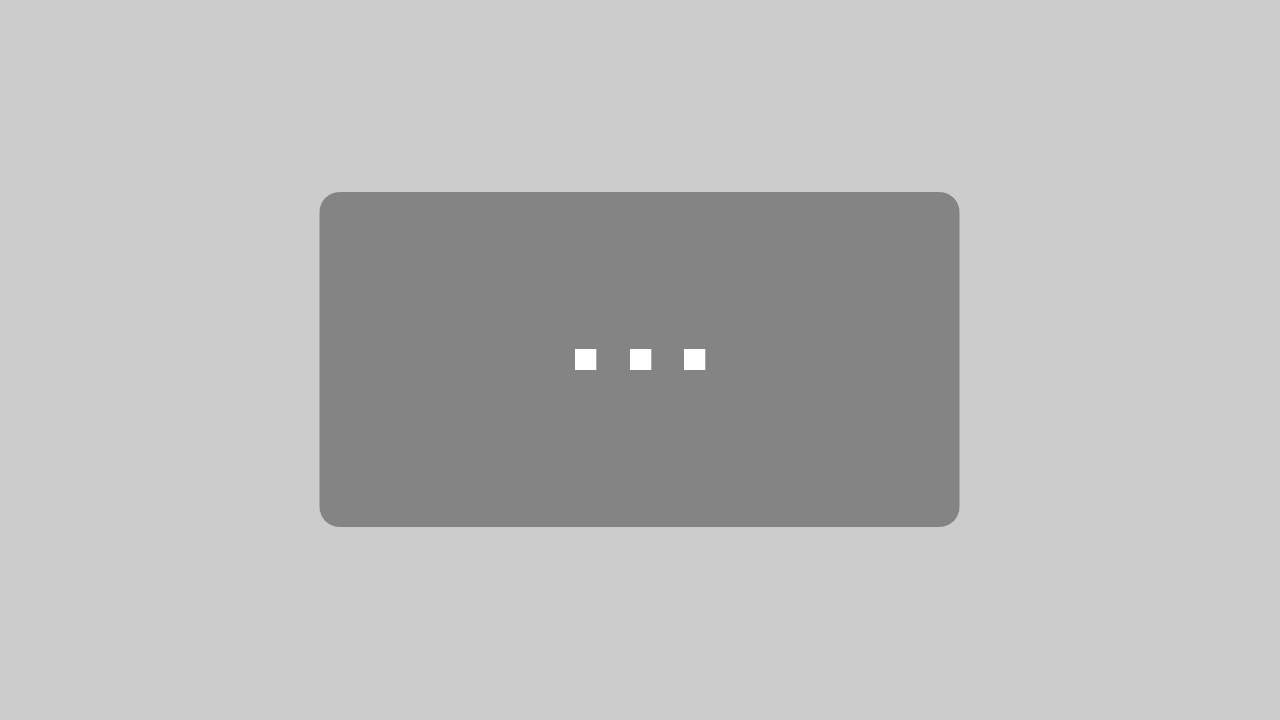Welche Form der Präsentation eignet sich, um die eigene Forschung zu kommunizieren? Was gibt es bei unterschiedlichen Formaten zu beachten? Philipp Niemann und Virginia Albert berichten, wie und warum das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik)* zu diesen Fragen einen Leitfaden für Forschende entwickelt hat.
Evidenzbasierte Tipps für die Präsentation der eigenen Forschung
Frau Albert, Herr Niemann, warum braucht es einen solchen Leitfaden zum Thema Präsentieren?

Philipp Niemann: Es gibt zwar bereits eine Reihe von Büchern, die Hinweise zum Thema Präsentieren geben. Für unsere Zielgruppe gibt es so etwas in der inhaltlichen Breite aber noch nicht. Uns geht es um kommunizierende Wissenschaftler*innen, die sich an eine fachfremde Öffentlichkeit richten, also nicht an ihre Peers innerhalb der wissenschaftlichen Community. Der Leitfaden wurde im Zuge des Forschungsprojekts „Science In Presentations“ (SIP), das in den vergangenen fünf Jahren vom NaWik gemeinsam mit dem Department für Wissenschaftskommunikation am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)* realisiert wurde, explizit mitgedacht. Normalerweise hat man in der Forschung ja ganz klassisch die Idee, dass dabei wissenschaftliche Publikationen herauskommen. Das ist bei uns natürlich auch so. Aber von Anfang an war geplant, dass wir auch etwas Konkretes für die Praxis liefern wollen. Dementsprechend ist der Leitfaden kostenlos als Download verfügbar, aber auch in begrenzter Stückzahl als Druckversion.
Virginia Albert: Was den Leitfaden natürlich auch ausmacht, ist, dass wir – dort, wo es möglich war – evidenzbasiert Tipps geben. Wir haben festgestellt, dass es nur sehr wenige Leitfäden für Wissenschaftskommunikation gibt, die sich auf Forschung berufen. Es gibt tatsächlich auch einige Forschungslücken, die man sukzessive zu füllen versucht – so wie wir es mit diesem Projekt gemacht haben.
Wie findet man denn heraus, welche Formen von Wissenschaftskommunikation gut funktionieren?

Niemann: Das kann man nicht so global beantworten. Man muss das relativ konkret, bezogen auf einzelne Formen, machen. Wir haben uns zum Beispiel Science Slams oder Präsentationen im Video genauer untersucht und u. a. Befragungen durchgeführt. Das haben wir auch bei Ringvorlesungen gemacht, die ja noch sehr nah am wissenschaftlichen Betrieb sind. Auch dort hatten wir bei mehreren Veranstaltungen die Möglichkeit, Teilnehmer*innen mit Fragebögen und klassischen Interviews zu bestimmten Aspekten, wie den Motiven für ihren Besuch, zu befragen. Bei Präsentationen im Bereich der Wissenschaftskommunikation ist besonders der Aspekt des Wissens interessant. Wenn Wissenschaftler*innen etwas präsentieren, kann man davon ausgehen, dass es eine Rolle spielt, ob Menschen irgendetwas von dem mitnehmen, was dort erzählt wird. Das muss nicht immer ein Detailergebnis aus einer Studie sein, sondern kann auch ein Einblick in wissenschaftliches Vorgehen an sich sein. Auch das haben wir in Laborstudien untersucht.
Sie haben unter anderem auch mit Eye-Tracking-Methoden gearbeitet. Was wollten Sie dabei herausfinden?
Niemann: Wenn man mit Blickaufzeichnungs-Verfahren in diesem Kontext arbeitet, geht es im Kern um die Frage: Wie verteilen wir beim Umgang mit wissenschaftlichen Präsentationen unsere Aufmerksamkeit? Dazu zeichnet man den Blickverlauf von Teilnehmer*innen auf und hat auf diese Weise hinterher ein sehr genaues Abbild davon, was zu welchem Zeitpunkt der Präsentation wie lange und in welcher Reihenfolge betrachtet wurde und was überhaupt keine visuelle Beachtung bekommen hat. Auf Basis dieser Daten kann man eine ganze Reihe von Fragen angehen. Bei einem Science Slam ist zum Beispiel interessant zu untersuchen: Wie viel Aufmerksamkeit bekommen Elemente der Präsentation, die bei einem klassischen wissenschaftlichen Vortrag auch verwendet werden – also beispielsweise Diagramme? Und was ist mit Elementen, die man vielleicht eher in der Unterhaltungswelt ansiedelt – beispielsweise comicartige Darstellungen? So hat man einen Indikator dafür, ob Elemente aus dem Bereich der Wissenschaft eine hohe Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder eher solche, die man dem Bereich der Unterhaltung zuordnen würde.
Wenn man mit der gleichen Methode etwa Präsentationsvideos von Wissenschaftler*innen analysiert, lässt sich feststellen: Wie relevant ist die Person, die da zu sehen ist? Wie viel Aufmerksamkeit bekommt sie im Vergleich zu anderen Teilen des Videos? Daraus kann man letztlich auch ganz praktisch ableiten, was in bestimmten Kontexten Aufmerksamkeit auf sich zieht und was man als Wissenschaftler*in daher vielleicht verwenden sollte – oder – je nach Präsentationssituation und -ziel – eben auch gerade nicht.

Was haben Sie dabei herausgefunden? Können Sie ein Beispiel nennen?
Niemann: Bei unseren Untersuchungen zu Science Slams haben wir gesehen, dass die wissenschaftlichen Elemente länger fixiert wurden als rein unterhaltende Bestandteile. Das ist ein Indikator dafür, dass Informationsvermittlung für die Besucher*innen einer solchen Veranstaltung eine wichtige Rolle spielt – zumindest neben der Unterhaltungskomponente. Natürlich haben wir solche Detailanalysen nicht bei Hunderten, sondern nur bei einer kleinen Zahl von Science Slams (sechs) durchführen können. Allerdings konnten wir gerade dieses Ergebnis auch durch Daten aus mehreren hundert Fragebögen stützen.
Ihr Forschungsprojekt lief fünf Jahre. Was haben Sie sich in dieser Zeit noch angeguckt?
Niemann: Es ist ein recht umfangreiches Forschungsprojekt gewesen, bei dem wir uns ganz grundlegend verschiedene Präsentationsformen der externen Wissenschaftskommunikation anschauen wollten und über die Jahre eine ganze Reihe von Detailbetrachtungen gemacht haben. Wir haben uns Klassiker wie Ringvorlesungen angesehen, aber auch interaktive Poster, also große Touchscreens, an denen präsentiert wird, Science Notes oder Ted Talks, und hatten einen Schwerpunkt im Bereich Video. Dabei hatten wir eine besondere Situation: Wir hatten die seltene Möglichkeit, Videos für den Forschungszweck selbst produzieren zu lassen und konnten dadurch eine ideale Vergleichssituation schaffen. Häufig nimmt man in der Forschung etwas, das man beispielsweise bei Youtube findet. Dabei hat man aber immer das Problem, dass der Vergleich schwierig wird, weil es so viele Variablen gibt, die mit reinspielen und fast nie konstant gehalten werden können. Um das in den Griff zu bekommen, haben wir möglichst vergleichbare Videoreihen im selben Setting zum selben Thema mit demselben Protagonisten und einem nahezu identischen Sprechertext produziert. Thematisch ging es da z.B. um das Katrin-Experiment am KIT, bei dem die Masse von Neutrinos bestimmt werden soll.
Wie setzt man solche Forschungsergebnisse in einen Leitfaden um?
Albert: Die Herausforderung ist, alles so zu strukturieren, dass man die Forschungsergebnisse nicht verfälscht. Häufig kann man keine Aussage treffen, die für alle Präsentationsformen gilt. Deshalb muss man abwägen: Für welches Szenario gilt die Aussage, die man untersucht hat? Deshalb hat der Leitfaden Unterkategorien – beispielsweise: Ich präsentiere mit einem Modell oder mit Folien oder mit einer Animation. Das haben wir so aufgedröselt, damit man die jeweiligen Forschungsergebnisse heranziehen konnte.
Wie ist der Leitfaden ansonsten aufgebaut?
Albert: Grundsätzlich haben wir versucht, aus der Perspektive eines Forschenden zu denken: Ich möchte eine Präsentation halten, welche Information brauche ich dafür? Davon ausgehend wollten wir erst einmal Grundlagen schaffen, die bei jedweder Kommunikation gelten. Ich sollte die Zielgruppe im Auge behalten, aber auch überlegen: Welchen roten Faden will ich wählen? Darauf aufbauend folgen die drei Elemente einer Präsentation: die Visualisierung, der mündliche Vortrag und die Aufmerksamkeit des Publikums, die ich wecken und halten möchte. Darüber hinaus geht es um die Gestaltung der Präsentation: Auf welche Aspekte kann ich achten? Dabei haben wir uns entschieden, zwischen Online und Präsenz zu unterscheiden.
Als weiteren Punkt haben wir uns ausgewählte Präsentationsformen angeschaut. Für jede Form geben wir einen kleinen Merkzettel an die Hand, der Präsentierenden Inspirationen geben soll, wenn sie noch nicht genau wissen, welche Form sie wählen möchten. Wenn man den Fokus auf Unterhaltung legen will, dann sind Formen wie Science Slam, Ted Talks oder Ähnliches angebracht. Wenn ich in den direkten Dialog gehen will, sind vielleicht andere Formen wie ein Science Café passender.
Welche Formate haben Sie in der Forschung und im Leitfaden noch nicht bedacht?
Niemann: Interessant für weitere Forschungen gerade im Onlinebereich ist sicher die performative Ebene des Verweises und des Herstellens von Bezügen. Normalerweise kann man bei Präsentationen mit einem Laserpointer oder mit der Hand Bezüge herstellen. Natürlich kann man das grundsätzlich auch online realisieren, aber meiner Erfahrung nach ist das eine Ebene, die online, beispielsweise in Zoom-Meetings, sehr viel reduzierter eingesetzt wird.
* Das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation und das Karlsruher Institut für Technologie sind zwei der drei Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de.