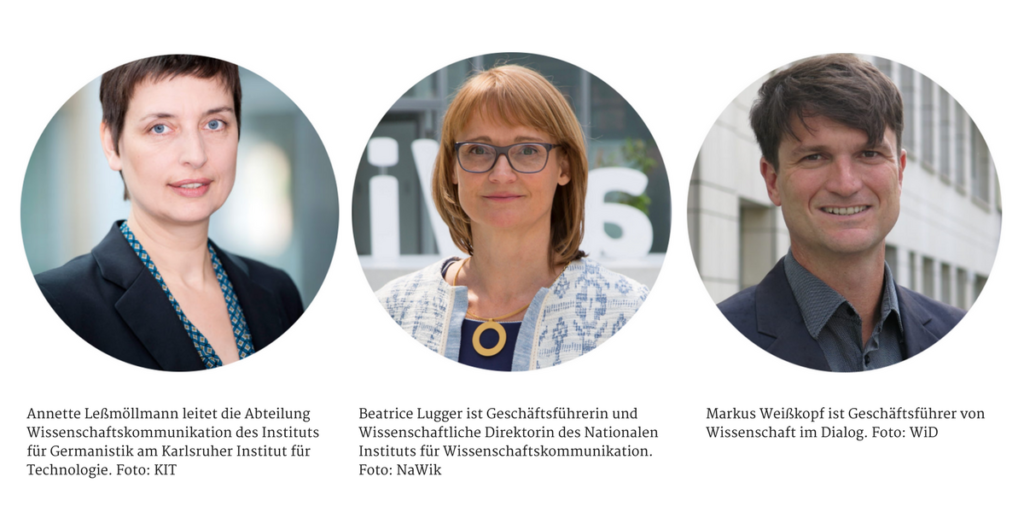Für die Zukunft der Wissenschaftskommunikation braucht es vielfältige Formate, aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eine starke Forschung, die diese Projekte evaluiert. Annette Leßmöllmann, Beatrice Lugger und Markus Weißkopf leiten drei unterschiedliche Einrichtungen in diesem Bereich. Ein Gespräch mit unseren Chefs über ihre Ideen für die Branche.
Drei Perspektiven auf die Zukunft der #Wisskomm
Annette, Beatrice, Markus, welche Ziele hat die Wissenschaftskommunikation in zehn Jahren erreicht?
Beatrice Lugger: Ich wünsche mir, dass wir dann im Wissenschaftssystem eine neue Kultur haben, in der Engagement von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Kommunikation vollkommen normal ist. Schließlich sind sie diejenigen, die Wissenschaft authentisch erklären, vermitteln und damit Brücken in die Gesellschaft schlagen können. Insgesamt hoffe ich, dass wir durch neue Dialoge und stärkere Interaktionen ein besseres Verständnis für die Wissenschaft und vor allem auch wissenschaftliche Prozesse haben.
Annette Leßmöllmann: Ich hoffe, dass bis dahin mehr Ergebnisse aus der Forschung über Wissenschaftskommunikation in die einzelnen Projekte einfließen. Außerdem hoffe ich natürlich, dass Wissenschaftskommunikation als Forschungsthema etabliert ist und wir eine gute und produktive Diskussion mit der Praxis darüber haben, was unsere Erkenntnisse für die Kommunikation bedeuten.
Markus, teilst du die Ansicht der Kolleginnen oder wo siehst du uns in der Zukunft?
Markus Weißkopf: Ich finde vor allem den Forschungs- und den Qualitätsaspekt weiterhin wichtig. Ich hoffe, dass es künftig Standard ist, den Impact der Projekte in der Wissenschaftskommunikation zu messen und bereits bei der Planung eines Projekts mit an die entsprechenden Evaluationen zu denken. Auch den Punkt von Beatrice zur Kommunikation wissenschaftlicher Prozesse teile ich, denn nur so kann langfristig Verständnis und auch Vertrauen für Wissenschaft entstehen. Darüber hinaus wünsche ich mir vor allem, dass wir bis 2030 eine gemeinsame Strategie haben. Wir sind sehr viele geworden in der Wissenschaftskommunikation, aber momentan arbeiten wir alle recht unabhängig voneinander. Da hoffe ich, dass es in die Richtung stärkerer strategischer Zusammenarbeit geht.
Aber sind die Institutionen nicht doch irgendwo auch Konkurrenten. Können wir überhaupt so strategisch zusammenarbeiten im Wissenschaftssystem?
AL: Es gibt Fraktionen, die sich aneinander reiben müssen. Der Wissenschaftsjournalismus beispielsweise muss sich aus dem System eher raushalten und den Blick von außen haben. Es ist eine meiner größten Sorgen, dass der Wissenschaftsjournalismus weiter geschwächt wird und diese Rolle nicht mehr ausführen kann. In diesem Bereich fände ich beispielsweise zu viel Kooperation falsch; außer natürlich von Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten untereinander.
MW: Mir geht es vor allem darum, klare gemeinsame Ziele für die Wissenschaftskommunikation zu definieren. Wo wollen wir denn hin? Aus meiner Sicht haben wir derzeit häufig noch zu viele kurzfristige Marketingziele und denken zu wenig langfristig und zu wenig an die gesellschaftsbezogenen Zielsetzungen. Und dann geht es darum, verschiedene Rollen zu diskutieren. Der Journalismus ist natürlich ein wichtiger Akteur. Aber ich denke auch, dass sich mit ihm gemeinsame Zielsetzungen diskutieren lassen, ohne dass dabei die Unabhängigkeit verloren geht.
Gibt es jemanden, der sich aus eurer Sicht noch zu wenig beteiligt?
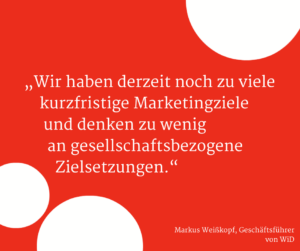 MW: Es geht dabei nicht um einzelne Akteure. Aus meiner Sicht braucht es vor allem neue Anreizsysteme innerhalb der Wissenschaft – und das ist ein dickes Brett. Hier sehe ich die Förderer von Wissenschaft in der Verantwortung und ich denke, da gibt es erste gute Beispiele, wie etwa in der Förderung von Citizen Science. Hier zeigt sich, dass eine stärkere Förderung wirkt. Es braucht ein Umdenken im System.
MW: Es geht dabei nicht um einzelne Akteure. Aus meiner Sicht braucht es vor allem neue Anreizsysteme innerhalb der Wissenschaft – und das ist ein dickes Brett. Hier sehe ich die Förderer von Wissenschaft in der Verantwortung und ich denke, da gibt es erste gute Beispiele, wie etwa in der Förderung von Citizen Science. Hier zeigt sich, dass eine stärkere Förderung wirkt. Es braucht ein Umdenken im System.
AL: Ich befürchte auch, dass das Problem im System liegt. Wie zäh das System Universität ist, finde ich immer wieder erschreckend. In meinem Bereich muss man ganz ehrlich sagen: Es sollte einen Wandel und eine neue Haltung dem Nachwuchs und neuen Entwicklungen gegenüber geben. Sonst bewegt sich das System kein Stück weiter. Ohne eine solche Veränderung, verknüpft mit neuen Anreizsystemen, wird sich langfristig auch die Situation der Wissenschaftskommunikation nicht verbessern.
BL: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das akademische System ist natürlich auch von starken Hierarchien geprägt. Deshalb bekommen einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchaus auch Probleme, wenn sie kommunizieren wollen. Es gibt noch ganz schön viele Vorurteile gegen die Kommunikation nach außen und die müssen wir mithilfe produktiver Debatten abbauen. Aus meiner Sicht muss Wissenschaftskommunikation auch ein Kriterium für wissenschaftlichen Erfolg werden.
Die Diskussion um Impact und neue Anreizsysteme ist ja noch relativ neu, gibt es auch Diskussionen, die ihr nicht mehr hören könnt?
AL: Wenn jemand die Medien sagt, werde ich auf jeden Fall hellhörig. Was genau damit gemeint ist, kann einem kaum jemand sagen. Ein Dauerbrenner ist auch die Debatte um “die Sozialen Medien“. Da haben die Leute natürlich nicht komplett unrecht, dass es schlechte Entwicklungen gibt, wenn man sich beispielsweise Trump anguckt. Aber es gibt auch ganz viele sehr gute Dinge, die die Sozialen Medien uns ermöglichen, gerade im Bereich Wissenschaftskommunikation – da gibt es zum Beispiel auf Twitter hochqualifizierte Debatten. Was mich aber wirklich auf die Palme bringt, ist, wenn gestandene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in ihrem Feld Herausragendes leisten, sich mit einem Brustton der Überzeugung über Medien- und Kommunikationsfragen äußern, ohne sich vorher Kompetenzen in diesem Bereich anzueignen. Da sehe ich eine große Gefahr und da würde ich mir eine eher fragende Haltung wünschen.
 BL: Ich kann die Frage nicht mehr hören, ob sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Institutionen in den Sozialen Medien bewegen sollten. Es ist ja nicht so, dass die Sozialen Medien wieder weggehen. Ich sehe hier die Gefahr, dass wir das Feld zu vorsichtig bespielen und dann den Gegnern unserer Branche Selbiges überlassen.
BL: Ich kann die Frage nicht mehr hören, ob sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Institutionen in den Sozialen Medien bewegen sollten. Es ist ja nicht so, dass die Sozialen Medien wieder weggehen. Ich sehe hier die Gefahr, dass wir das Feld zu vorsichtig bespielen und dann den Gegnern unserer Branche Selbiges überlassen.
MW: Eine sehr anstrengende Diskussion ist auch die über die Vermittlung digitaler Kompetenzen an Kinder und Jugendliche. Viele scheinen zu glauben, dass die Einrichtung von I-Pad-Klassen sowohl bewirkt, dass aus allen Kindern künftig digitale Innovatoren werden, als auch, dass sie immun gegen Fake News werden. Die Forschung in diesem Bereich zeigt uns, dass das so einfach nicht ist. Die Vermittlung von Methodenkompetenz und von logischem Denken beispielsweise hat einen weit höheren Impact, ist aber natürlich schwerer umzusetzen und wird auch nicht von der Industrie unterstützt.
Ist aktuell die spannendste Zeit um Wissenschaftskommunikation zu betreiben oder gibt es Sehnsuchtsmomente nach der guten alten Zeit?
MW: Klar ist die aktuelle Entwicklung spannend. Sowohl die Wissenschaft als auch die Kommunikation sind derzeit sehr dynamische Felder und beide verändern sich extrem. Da ist es total interessant, sich dem zu stellen und die bestmöglichen Strategien zu entwickeln, um unsere Ziele zu erreichen.
BL: Das kann ich so unterschreiben. Ich finde es unglaublich spannend, wie viele Projekte gerade an allen möglichen Stellen entstehen. Diese unglaubliche Dynamik im System empfinde ich als sehr wohltuend, zumal wir ja auch aktiv mitwirken können. Ich hab nur dann Sehnsuchtsmomente, wenn ich die Bedingungen sehe, die meine ehemaligen Kollegen im Journalismus heute haben. Da wünsche ich mir manchmal die alten Zeiten der Tiefe zurück.
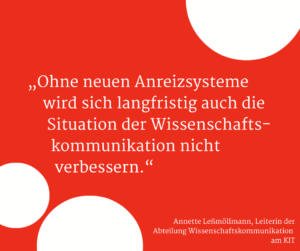 AL: Ich finde diese Zeit vor allem so spannend, weil es teilweise um die Grundwerte und Grundsätze in der Wissenschaft und in der Wissenschaftskommunikation geht, und zwar nicht nur theoretisch-akademisch. Jede und jeder ist im Zweifel gefordert, darüber zu diskutieren, was gute Wissenschaft oder eine gute Methode ist, was für ihn oder sie „Freiheit der Wissenschaft“ bedeutet, und so fort. Diese Herausforderung finde ich interessant und deshalb gehört für mich Wissenschaftskommunikation auch in die Curricula der unterschiedlichsten Fächer.
AL: Ich finde diese Zeit vor allem so spannend, weil es teilweise um die Grundwerte und Grundsätze in der Wissenschaft und in der Wissenschaftskommunikation geht, und zwar nicht nur theoretisch-akademisch. Jede und jeder ist im Zweifel gefordert, darüber zu diskutieren, was gute Wissenschaft oder eine gute Methode ist, was für ihn oder sie „Freiheit der Wissenschaft“ bedeutet, und so fort. Diese Herausforderung finde ich interessant und deshalb gehört für mich Wissenschaftskommunikation auch in die Curricula der unterschiedlichsten Fächer.
Was bedeutet dieser Angriff auf die Grundwerte denn? Müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt politisch werden?
BL: Ich glaube nicht, dass sie eine politische Haltung oder Agenda vertreten müssen oder sollten. Es geht eher darum, die Wissenschaft und ihre Werte nach außen zu vertreten. Man muss für die Erkenntnisse öffentlich eintreten, die im eigenen Bereich gewonnen werden und darüber in den Dialog treten. Vor allem auch dann, wenn jemand anderes die Erkenntnisse anficht. An diesen Stellen sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktiv in den Dialog treten und erklären, wie sie zu ihren Erkenntnissen gekommen sind und warum diese aktueller wissenschaftlicher Konsens sind. Es geht darum, das wissenschaftliche System und seine Werte auch nach außen zu vertreten und dafür einzustehen, auch im Konfliktfall. Das halte ich für sehr wichtig in der heutigen Zeit und vieles davon beginnt schon im privaten Bereich.
MW: Ganz genau. Es geht eher darum, gesellschaftlich aktiv zu sein. Damit das gelingt, brauchen wir Führungspersönlichkeiten in der Wissenschaft, die dieses Engagement auch fördern und aktiv fordern. Wir in der Wissenschaftskommunikation können dafür die Plattformen bauen, dabei helfen dieses Engagement effektiv zu verbreiten und den direkten Kontakt zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Bürgern herstellen. Wissenschaft erfahrbar und erlebbar zu machen ist eine der wichtigsten Aufgaben der heutigen Zeit und dabei helfen wir bei Wissenschaft im Dialog (WiD) mit unseren Projekten.
Seid ihr deshalb die Wichtigsten in der Branche und könnte man auf die Bereiche von Annette und Beatrice verzichten?
MW: Nein, auf keinen Fall. Ich bin natürlich mit Herzblut dabei und finde unsere Projektarbeit sehr wichtig. Dafür brauchen wir aber die Forschung zur Wissenschaftskommunikation, wie sie beispielsweise das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) betreibt, um zu überprüfen, ob unsere Arbeit funktioniert. Und wir brauchen Wissenschaftler die kommunizieren wollen und können und dafür sorgt ja unter anderem das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik).
Markus will euch also weiter dabei haben. Wie sieht es bei euch aus?

AL: Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Wissenschaftskommunikation, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angeregt werden, auch über ihre eigene Arbeit zu reflektieren. Da sehe ich alle Forschungsorganisationen in der Verantwortung. Wissenschaft ist keine Problemlösemaschine, kein Faktengenerator und kein Allheilmittel. Das muss man auch vermitteln, nach innen und außen.
BL: Auf jeden Fall. Da müssen wir dringend ansetzten und das versuchen wir in unseren Seminaren auch zu vermitteln beziehungsweise zu etablieren.
Wer im System Wissenschaft macht denn in Kommunikationsdingen aktuell am meisten falsch?
MW: Hier kann man auch wieder nicht auf einzelne Akteure, sondern zum Beispiel auf die fehlenden Anreizsysteme in der Wissenschaft verweisen. Darüber hinaus könnten wir auch etwas mehr Geld für Kommunikation ausgeben, und zwar nicht für irgendwelche Kommunikation, sondern für eine, die unsere gemeinsamen Ziele strategisch verfolgt.
BL: Ich glaube auch, dass die Topentscheider im System gefragt sind, Einfluss zu nehmen und Dinge in die Wege zu leiten. Auch durch finanzielle Mittel.
AL: Auch ich sehe im System selbst weiterhin den größten Verbesserungsbedarf. Es ist ja beispielsweise auch schon ein kommunikatives Statement, wenn die Entscheider alle männlich sind. Ich glaube, wir brauchen da wirklich einen Wandel.