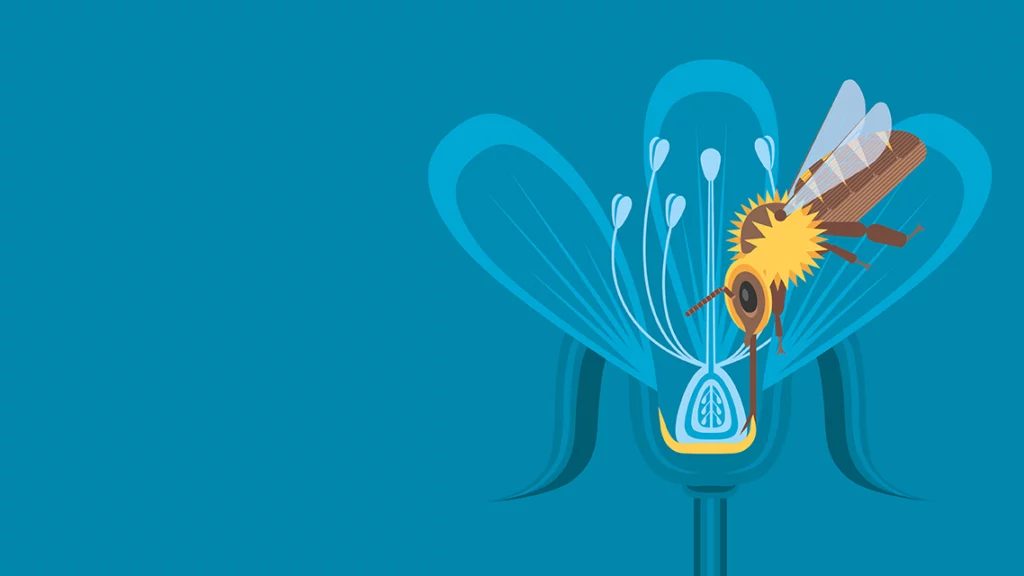Die Wissenschaft öffnet sich immer mehr der Partizipation. In anderen gesellschaftlichen Bereichen wie der Stadtentwicklung ist Bürger*innenbeteiligung seit vielen Jahren etabliert. Was sich daraus für die Wissenschaftskommunikation lernen lässt, erläutert Hannes Schlender.
Die Realität besser erfassen
November 2017. In der Berliner Johannes-Tews-Grundschule brennt abends noch Licht. Etwa hundert Menschen haben sich in der Aula versammelt. Lehrer*innen, Schüler*innen oder Eltern sind es nicht. Was sich hier trifft, ist ein bunter Querschnitt durch die Bevölkerung des südwestlichen Berliner Bezirks: Junge und Alte, Menschen im Business-Look und solche, die eher dem alternativen Spektrum zuzugehören scheinen. Sie alle eint das Interesse an einem wissenschaftlichen Forschungsgerät, das in den nächsten Jahren stillgelegt und abgebaut werden soll: dem Berliner Experimentierreaktor BER II des Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) in Wannsee. Partizipation heißt das Zauberwort, das auch in der Wissenschaft angekommen ist. Kurz vor der anstehenden Stilllegung und dem Abbau des Forschungsreaktors will das HZB einen Bürger*innendialog zu diesem Prozess ins Leben rufen. Ob das gelingen kann? Die Antwort kennt im November 2017 niemand – weder die Forschenden des HZB, noch die interessierten Bürger*innen. In anderen gesellschaftlichen Bereichen ist Bürger*innenbeteiligung schon seit vielen Jahren etabliert und teilweise sogar gesetzlich vorgeschrieben. Etwa in der Stadtplanung. Dort ist die Beteiligung der Zivilgesellschaft im Planungsrecht verankert und festgesetzt, dass die Öffentlichkeit einbezogen werden soll. Stadtplaner*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen und Politiker*innen haben jahrzehntelang Erfahrungen mit dem Instrument der Bürger*innenbeteiligung sammeln können.
Erfahrung ist nötig, denn Bürger*innenbeteiligung ist einfacher gesagt als getan. Es gibt viele Problemfelder, wenn Lai*innen in fachlich fundierte Prozesse einbezogen werden: Welche Menschen sollen mitwirken? Welche beteiligen sich tatsächlich? Wie können sie Einfluss nehmen? Indem sie besser über die Vorgänge in ihrer Stadt informiert werden? Indem sie Vorschläge einbringen, welche Verwaltung und Politik dann aufnehmen und idealerweise umsetzen? Oder indem sie selbst Aufgaben und Verantwortung übernehmen? Auf viele dieser Fragen hat die Stadtentwicklung Antworten gefunden – andere sind nach wie vor unbeantwortet.
Der Anfang: Widerstand gegen die Kahlschlagsanierung
Ihren Anfang nahm die Entwicklung in den 1970er-Jahren. Bis Mitte jenes Jahrzehnts bestand Stadtumgestaltung vor allem aus Abriss und Neubau, der Kahlschlagsanierung. Ganze Stadtviertel verschwanden und mit ihnen auch die sozialen Gefüge: die Lebensbeziehungen, die die Menschen in ihrer Stadt hatten. Dagegen bildete sich in den 70ern öffentlicher Widerstand. Das Ergebnis war ein erstes Umdenken. 1976 wurde die „vorgezogene Bürgerbeteiligung“ in das allgemeine Städtebaurecht integriert. Sie ermöglichte es interessierten Bürger*innen, in Planungsverfahren zumindest Einwendungen geltend zu machen.
Von der vertikalen zur horizontalen Perspektive
Gerade letzteres war in den 1990er-Jahren en vogue. Das Konzept des New Public Management2 strebte den Umbau der Stadt in eine Dienstleistungskommune an. Dabei wurde Partizipation weniger als Beteiligung der Bürger*innen an Entscheidungen gedacht. Vielmehr stand die Übertragung von Aufgaben im Mittelpunkt, die vorher die öffentliche Hand wahrgenommen hatte. Als Ehrenamtliche wurden die Bewohner*innen in die Pflicht genommen, sich um ihr Umfeld selbst zu kümmern – beispielsweise bei der Pflege von Sportstätten im Rahmen der Vereinsarbeit.
Doch Partizipation im Sinne von Einflussnahme ist dies natürlich nicht. Und viele positive Effekte einer echten Einbeziehung der Bürger*innen kommen bei dieser Form der Beteiligung gar nicht zum Tragen: Der Austausch und die Weiterentwicklung von Argumenten. Inhaltliche Diskussionen über mögliche alternative Entwicklungspfade. Das Kennenlernen der bürgerlichen Lebensrealitäten durch Planer*innen und Menschen in der Verwaltung. Oder die Steigerung von Akzeptanz verwaltungstechnischer Entscheidungen durch die Stadtbewohner*innen, weil diese mitentschieden haben.
Arbeit für die Schublade?
Entscheidend bei Bürger*innenbeteiligungsverfahren ist von Anfang an, was mit den Erwartungen, dem Wissen, den Vorstellungen und Vorschlägen der Beteiligten geschehen soll. Nichts ist schlimmer, als wenn Menschen sich einbringen, Zeit investieren und Vorschläge machen – und später feststellen, dass sie nur für die Schublade oder gar den Papierkorb gearbeitet haben. Dabei muss gar nicht immer der ganz große Anspruch – die aktive Mitgestaltung – verwirklicht werden. Es kann schon einen positiven Effekt haben, wenn Menschen gut informiert werden. Gut heißt, dass sie von Plänen und Entscheidungen nicht passiv aus den Medien erfahren, sondern vor Ort im Gespräch mit den Entscheidungsträger*innen. Werden solche Gespräche professionell moderiert, kann es zu einem Austausch von Argumenten und Sichtweisen kommen. Das verbessert das gegenseitige Verständnis und sorgt für Akzeptanz.
Die partnerschaftliche Kooperation schafft eine größere Verbindlichkeit der Interessensberücksichtigung. Sie nimmt die Wahrnehmung der Beteiligten zu einer Fragestellung auf und führt idealerweise dazu, dass sich alternative Entwicklungsmöglichkeiten formulieren lassen – also Perspektiven auf ein Problem entstehen, die ansonsten verborgen geblieben wären. Bei der weitestgehenden Form der Partizipation, der oberen Sprosse auf der Beteiligungsleiter, geben die verantwortlichen Stellen sogar Macht an die beteiligten Bürger*innen ab, sodass diese verantwortlich an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Wenn im Vorfeld geklärt ist, auf welcher dieser Stufen das Verfahren läuft, haben alle Beteiligten klare Zielvorstellungen. Die Gefahr, dass es zu Enttäuschungen kommt, ist deutlich reduziert.
Welche Formate sind geeignet?
Die Frage, die sich anschließt, ist, wie sich Partizipation auf den unterschiedlichen Stufen der Beteiligungsleiter am besten realisieren lässt. Formate gibt es viele, von Bürger*innenkonferenzen bis Planungswerkstätten. Die Bundeszentrale für politische Bildung listet in ihrem „Handbuch Bürgerbeteiligung“ 17 Verfahren auf und unterzieht sie neben einer ausführlichen Darstellung auch einem systematischen Vergleich.
Von großer Bedeutung bei der Auswahl der Methode sind klare Zielvorstellungen. Es ergibt einen Unterschied, ob zunächst einmal Themen nur in der Bürgerschaft eingebracht und diskutiert werden sollen, mit dem Ziel, Projektideen zu entwickeln. Oder ob die Projektidee bereits besteht und sich die Bürger*innen nun an der Entwicklung konkreter Pläne beteiligen sollen.
Und wer macht mit?
Idealerweise sollen die Menschen, die sich in Beteiligungsverfahren einbringen, einen repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft darstellen. „Davon sind wir meilenweit entfernt“, sagt Prof. Vanessa Carlow. Carlow leitet an der Technischen Universität Braunschweig das Institute für Sustainable Urbanism und interessiert sich aus wissenschaftlicher Sicht für die Frage, welche Menschen aus der Bürgerschaft an Stadtplanungsprozessen teilnehmen: „In den wenigsten Beteiligungsverfahren gibt es einen Einladungsprozess, mit dem es gelingt, Repräsentativität sicherzustellen. Dementsprechend sieht man an den Veranstaltungen häufig dasselbe Publikum, oft ältere Männer, meist die Betroffenen, nie Kinder, selten Jugendliche.“ Wie es gelingen kann, dies zu ändern und wirklich breite Schichten repräsentativ einzubeziehen, will Carlow mit ihrem Team erforschen.
Jede*r spricht eine andere Sprache
Auch wenn die Teilnehmenden in Partizipationsverfahren nicht repräsentativ für die Bevölkerung sind – heterogen sind die Gruppen trotzdem. Auch das ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf den Prozess. Nicht nur, dass die Einzelne ihre persönliche Sichtweise einbringt; jeder hat auch sein spezifisches Vorwissen, und die Unterschiede in der Informiertheit können enorm sein. Hinzukommt, dass es in der Regel ein deutliches Informationsgefälle zwischen Fachmenschen – also Planer*innen, Verwaltungsmitarbeitenden und Fachpolitiker*innen – einerseits und Lai*innen in der Bürgerschaft andererseits gibt. Information ist also in jedem Fall vonnöten, um Beteiligungsprozesse zielführend zu gestalten.
Und was kann die Wissenschaftskommunikation lernen?
Der 2017 gestartete Dialogprozess des Helmholtz-Zentrum Berlin kam dann tatsächlich in Gang. Die Teilnehmenden rangen eine Weile miteinander, gaben sich selbst Regeln für den Umgang miteinander. Ein Vertrauensverhältnis konnte entstehen. Ein Vertrauensverhältnis, an dem immer weiter gearbeitet werden muss, damit es Bestand hat. Trotz solcher Einzelfälle: Noch ist die Wissenschaft weit davon entfernt, Bürger*innenbeteiligung systematisch in ihre Planungsprozesse einzubeziehen. Und die Wissenschaftsfreiheit setzt dem auch Grenzen. Trotzdem stellt sich die Frage, ob die Wissenschaftskommunikation, Bürger*innenbeteiligung nicht schon früher als erst bei der Abwicklung ausgedienter Forschungsreaktoren einsetzen kann.
Einen Ratschlag gibt Vanessa Carlow dabei mit auf den Weg: „Die Wissenschaftskommunikation sollte darauf achten, nicht nur die an Wissenschaft Interessierten einzubinden. Andernfalls gehen ihr von Anfang an wichtige Perspektiven verloren, die es außerhalb dieses kleinen Kreises gibt.“
Hannes Schlender berichtet in unserem Auftrag zu diesem Thema.