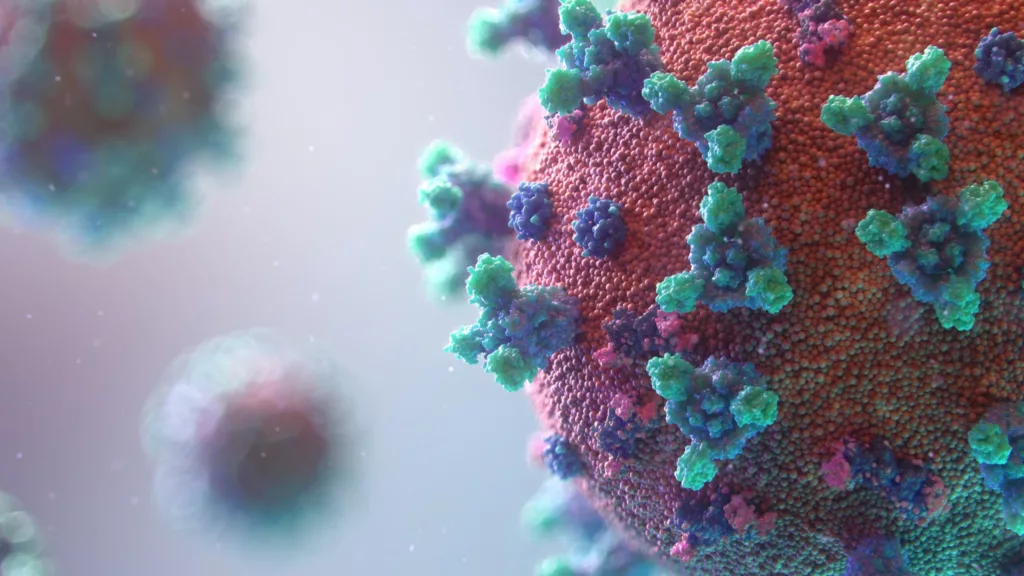Ein neuer Sammelband bündelt Denkanstöße aus der Wissenschaft für wirksame Kommunikations- und Beteiligungsformen. Welche Ergebnisse die Publikation für die Gestaltung des technologischen Wandels bereithält, erklären der Soziologe Ortwin Renn und die Linguistin Nina Janich im Interview.
„Die Ambivalenz der Technik muss aktiv kommuniziert werden“
Mit dem Sammelband „Technischer Wandel – wirksam kommunizieren und beteiligen“ wurden zwölf Denkanstöße aus der Wissenschaft zusammengetragen. Zugleich ist die Publikation Teil eines übergeordneten acatech-Projekts. Wie kam es dazu?

Ortwin Renn: In dem Projekt haben sich drei Arbeitsgruppen mit zwei übergeordneten Fragen beschäftigt: Wie können wir technologische Veränderungen besser kommunizieren und darüber informieren? Und wie können Menschen stärker in die Gestaltung dieser Veränderungen einbezogen werden? Eine Arbeitsgruppe behandelte das Thema Digitalisierung der Verwaltung, die zweite AG beschäftigte sich am Beispiel der elektronischen Patientenakte mit der Anwendung von digitaler Technik im Alltag. Schlussendlich unterstützte eine dritte Arbeitsgruppe die beiden anderen mit kommunikationswissenschaftlichen Erkenntnissen und erarbeitete den vorliegenden Sammelband. Mit der Publikation wollen wir die Frage, wie technische Veränderungen und Innovationen von der Gesellschaft wahrgenommen, aufgenommen und bewertet werden, beantworten. Wir haben führende Expertise aus der Wissenschafts- und Technikkommunikation, den Sozial- und Kommunikationswissenschaften und der Psychologie zusammengetragen, um evidenzbasierte Denkanstöße zu geben.
Nina Janich: Dabei war der Aufbau der dritten Arbeitsgruppe spannend, da ein solcher interdisziplinärer Austausch in meinem Forschungsfeld, der Linguistik, häufig zu wenig stattfindet. Deshalb finde ich es immer unglaublich befriedigend, wenn unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht werden, um komplementär Antworten auf Fragen zu finden, die alle Fächer interessieren. Dadurch, dass die einzelnen Beiträge des Sammelbands von konkreten Praxisfragen ausgehen, ist es gelungen, eine optimale Mischung aus Hintergrundinformationen, Kontextwissen und wissenschaftlicher Reflexion zu schaffen. So wurde ein Kompendium zusammengetragen, das extrem vielseitige Perspektiven auf Kommunikation, ergänzt durch weitere Leseempfehlungen bietet. Es ermöglicht einen ersten, aber schon ziemlich umfassenden Überblick, und man kann selbst entscheiden, ob man wissenschaftlich tiefer einsteigen will oder ob man damit direkt in die Praxis geht.

Häufig hört man vonseiten der Politik oder Wirtschaft den Aufruf, die Bevölkerung beim technologischen Wandel „mitzunehmen“. Was ist damit gemeint und inwiefern unterscheiden sich Ihre Ergebnisse von diesem Ziel?
Renn: „Mitnehmen” setzt voraus, dass wir wissen, wohin der Zug fährt, und dass wir Leute nur überreden müssen, in diesen Zug einzusteigen und mitzufahren. Das ist jedoch keine Beteiligung. Beteiligung heißt, dass Menschen bereits an der Formulierung der Ziele mitwirken und nicht nur mitgenommen werden. Mitnehmen bedeutet passive Überzeugungsarbeit, Mitwirkung heißt aktives Engagement, was man auch gut mit dem englischen Ausdruck „Empowerment“ beschreiben kann. Es geht darum, Menschen die Gelegenheit zu geben, ihre Lebenswelt mitzugestalten. Natürlich gibt es immer Themen, bei denen wir nur kommunizieren können. Doch da, wo es möglich ist, Menschen aktiv an der Gestaltung ihrer Umwelt einzubinden, sollten wir das auch tun. Deshalb ist „Mitnehmen” das falsche Wort.
Sowohl Austausch als auch Beteiligung setzen ein Grundinteresse für Wissenschaft voraus. Laut dem „TechnikRadar“ ist jedoch ein Viertel der Befragten dem Nutzen technologischen Wandels gegenüber skeptisch eingestellt. Warum gibt es diese Skepsis und wie erreicht man diese Bevölkerungsteile?
Janich: Die Ambivalenz der Technik muss deshalb aktiv kommuniziert werden. Populistische und postfaktische Kommunikation hat oft keine eigene Position, sondern interveniert und stört nur das, was eigentlich eine breite Zustimmung findet, aber als Manipulation oder Meinung des ‚Establishments‘ bloßgestellt wird. Das heißt, unsere einzige Chance, Menschen zu erreichen, besteht darin, dass man von vornherein Sicherheiten und Unsicherheiten, Chancen und Risiken von technologischen Entwicklungen gleichermaßen kommuniziert und zu Diskussion und Beteiligung aufruft. Beim Versuch, Anknüpfungspunkte zu Selbstwirksamkeit oder gesellschaftlichem Nutzen zu finden, dürfen Herausforderungen und mögliche Probleme keinesfalls verschwiegen werden.
Skepsis ist das eine, Verschwörungsmythen gehen vor allem im technologischen Bereich noch einige Schritte weiter. Egal ob Chemtrails oder die Angst vor 5G-Masten – kann die Wissenschafts- und Technikkommunikation dem etwas entgegensetzen?
Janich: Der Beitrag zu Verschwörungstheorien im Sammelband führt aus, dass es zwar einige, aber immerhin nicht allzu viele Menschen gibt, die einer Verschwörungstheorie uneingeschränkt anhängen. Dennoch gibt es einen nennenswerten Teil der Bevölkerung, der zumindest einzelnen Aspekten, die in einer Verschwörungstheorie zusammenkommen, zustimmt. Wir sind uns alle einig, dass die „echten“ Verschwörungstheoretiker*innen unbelehrbar sind, da kommt man nicht ran. Aber die anderen können wir noch erreichen. Und zwar nicht, indem man ihnen mit der Aussage begegnet: „Wir wissen, was die objektive Wahrheit ist, wir haben also Recht und ihr müsst uns einfach glauben.“ Sondern indem man versucht, klarer zu kommunizieren, wie wissenschaftliche Erkenntnis eigentlich entsteht und warum wissenschaftliches Wissen ein besonders verlässliches, weil zum Beispiel durch Wenn-Dann-Beziehungen begründetes Wissen ist. Wissenschaftler*innen sehen meist das Aufklären als ihre Aufgabe an, aber aus meiner Sicht ist das Einordnen viel wichtiger: Welche Art von Wissen gewinnen wir in welchen Fächern und durch welche Methoden? Welche Einsichten und welche Unsicherheiten gibt es? Gibt es Alternativen? Dafür müssen die Wissenschaft oder auch die Technikentwicklung bereit sein, praxisorientiert und transparent zu kommunizieren.
Janich: Ja, es ist wichtig zu betonen, dass Unsicherheit kein Problem der Wissenschaft ist, sondern ihre genuine Bedingtheit. Wissenschaft basiert auf Wissenslücken, die wir versuchen, durch Forschung zu füllen. Dadurch generieren wir immer mehr Wissen, das sich entwickeln muss. Das ist also kein Problem, mit dem die Wissenschaft zu kämpfen hat, sondern ihr grundlegendes Wesen.
Wie ist aus Ihrer Sicht Widerstand in der Bevölkerung gegen technologischen Fortschritt einzuschätzen?
Renn: Für den Diskurs ist es wichtig, zwischen vermuteten oder auch gemessenen Konsequenzen einer Handlung und deren Bewertung nach Wünschbarkeit zu unterscheiden. Wenn es um die Prognose von Konsequenzen geht, kann die Wissenschaft uns viele Anhaltspunkte geben, was wahrscheinlich passieren wird, wenn wir Option A oder B verfolgen. Ob wir dann diese Konsequenzen als gut oder schlecht einstufen, liegt an uns selbst bzw. bei kollektiven Entscheidungen an den dazu legitimierten politischen Gremien. Wer wissen will, wie die Faktenlage aussieht, ist also bei der Wissenschaft gut aufgehoben. Wenn der Diskurs aber auf Fake News oder Verschwörungstheorien aufbaut, haben wir meines Erachtens als Wissenschaft die Aufgabe allen deutlich zu machen, dass bei aller Unsicherheit uns diese falschen Aussagen in die Irre führen und wir sie nicht als Grundlage unserer Bewertung nehmen dürfen. Es gibt absurde Behauptungen und die bleiben falsch, egal von welcher Seite oder von welcher Perspektive aus wir sie betrachten. In dem Fall muss die Wissenschaft standhaft bleiben und darf nicht behaupten, jede Form von Wissen sei gleich legitim und müsse anerkannt werden. Gleichzeitig stimmt aber auch: Die Bewertung der Wünschbarkeit von Optionen auf der Basis einer möglichst objektiven Nutzen-Risiko-Abschätzung ist keine wissenschaftliche Aufgabe, sondern eine Abwägungsleistung, die jedes Individuum für sich bzw. die Gesellschaft in einem politischen Diskurs angehen muss.
Janich: Technikskepsis wird immer ein legitimer Teil der Gesellschaft sein. In der Diskussion ist es wichtig, immer wieder einen Schritt zurückzutreten und – wie zum Beispiel beim Thema Impfpflicht – zu überlegen, ob wir über ein Wissensproblem, wie etwa über Schutz- versus Nebenwirkungen, oder über Wertefragen reden. In der Coronakrise war eine zentrale Frage, welche Werte dominant zu setzen sind, Sicherheit oder Freiheit – das war einer der Hauptkonflikte in der Beurteilung der Maßnahmen. Demzufolge sind manchmal Entscheidungen, die in einer Gesellschaft getroffen werden, politisch und nicht wissenschaftlich. Nicht jede Frage kann nur über wissenschaftliche Evidenz-Argumente beantwortet werden, sondern muss als politischer Kompromiss ausgehandelt werden.