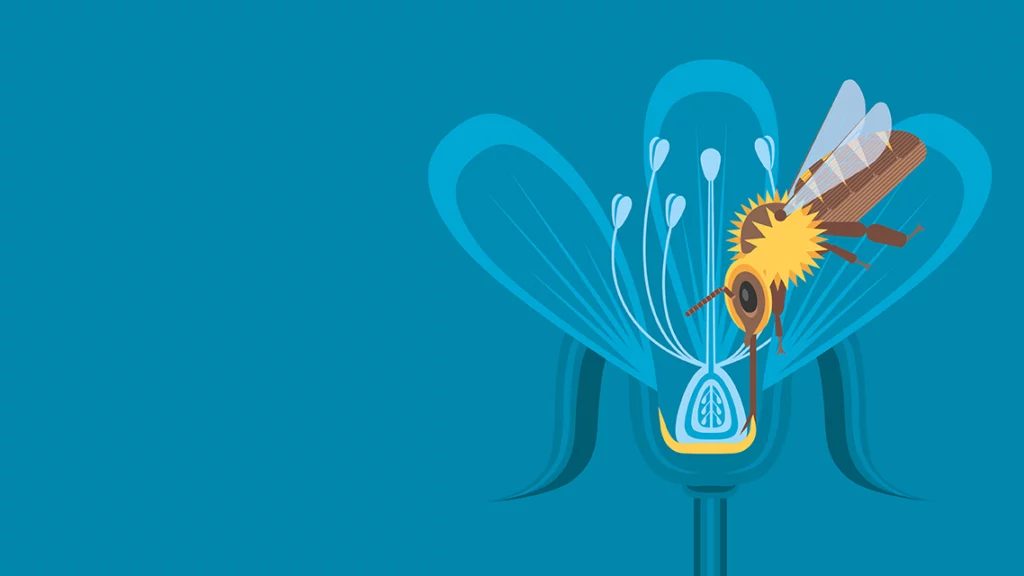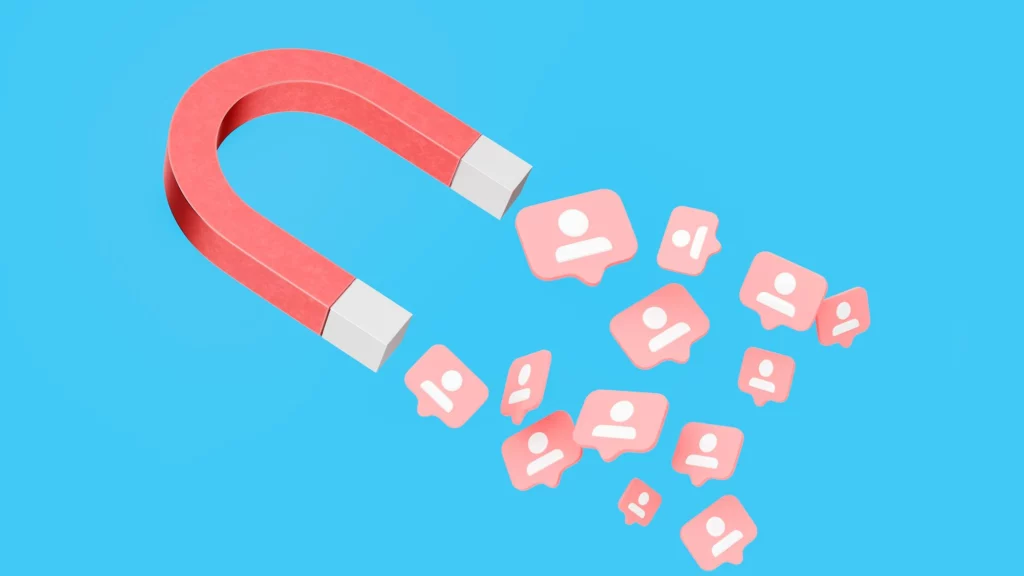„Lass das mal die Profis machen“ – so klang es kürzlich in einem Beitrag über digitale Wissenschaftskommunikation in Forschung & Lehre. Open Science-Experte Lambert Heller hinterfragte diesen Ansatz auf Twitter und begründet das im Debattenbeitrag.
Das nächste Level geht nur gemeinsam
Die Werkzeuge und Methoden externer Wissenschaftskommunikation zu beherrschen, passt zum Anspruch einer Forschung, die besser wird, indem sie ihre Stakeholder partizipieren lässt. Das macht die Kommunikationsprofis in der Wissenschaft jedoch keineswegs überflüssig – sie müssen ihre Rollen und Aufgaben jetzt im Zusammenspiel mit den Forschenden, und insbesondere dem Nachwuchs, weiterentwickeln.
Was meinen wir, wenn wir von Wissenschaftskommunikation reden? Natürlich lesen und hören wir immer noch häufig (oder sogar meistens?) von einer möglichst unabhängigen, ja ungestörten, ausschließlich auf ihre exzellenten Ergebnisse achtenden Forschung. So werde nun mal geforscht, und danach, in einem separaten Schritt, die fertigen Ergebnisse kommuniziert, disseminiert und transferiert, was das Zeug hält.
In den letzten Jahrzehnten sehen wir jedoch zunehmend ganz neue Konzepte: Action Research, Co-Creation, Citizen Science oder Design Thinking halten Einzug in den Wissenschaftsbetrieb. Ein roter Faden dieser Ansätze ist die frühzeitige Einbeziehung von Stakeholdern in die Forschung, die Einbeziehung jener Menschen also, die von der Forschung – im weitesten Sinne – betroffen sind.
Stakeholder-Partizipation soll Forschung besser machen – zum Beispiel können so blinde Flecken und Voreingenommenheiten (Biases) vermieden, oder eine Identifikation mit der Forschung ermöglicht werden. Letzteres spielt insbesondere eine Rolle, wenn das öffentliche Verständnis einer missionsorientierten Wissenschaft für die Gesellschaft angestrebt wird.
Wenn wir über die Perspektive der umfassenden Einbeziehung von Stakeholdern in die Forschung sprechen – die sicherlich für die Epidemiologie bedeutungsvoller sein wird als für die Astrophysik –, dann müssen wir auch über die immer zahlreicheren, immer relevanteren, aber auch immer komplexer werdenden Optionen der digitalen Kommunikation mit den Stakeholdern reden. Stakeholder-Partizipation umzusetzen, ist zunehmend eine Herausforderung für die Forschenden, allein schon auf rein „handwerklicher“ Ebene. Sie muss praxisnah kennengelernt und unter Berücksichtigung greifbarer Vorbilder erprobt werden, um realistisch und produktiv als Komponente in die eigene Forschung einbezogen werden zu können.
Wie in anderen Bereichen, in denen Digitalität das „Wie“ der Forschung stark prägt, ist auch im Bereich der Stakeholder-Partizipation bzw. der digitalen Kommunikation zu beobachten, dass die institutionalisierte Ausbildung des Forschungsnachwuchses kaum hinterherkommt. Eine Reaktion darauf im Bereich der Forschungsdaten und -software sind „The Carpentries“, eine gemeinnützige Organisation, die Forschenden in Lehrworkshops Software-Engineering- und Data-Science-Fähigkeiten vermittelt.
Im Bereich der Wissenschaftskommunikation erscheinen die Herausforderungen der Digitalisierung manchmal wie eine Zumutung: Jede Social-Media-Plattform hat ihre eigenen Gesetze, alles ist erbarmungslos personalisiert, live und direkt. Nun gibt es im Feld der Wissenschaftskommunikation oft bereits „Zuständige“, u.a. die Wisskomm-Professionals in den Pressestellen der Forschungseinrichtungen, die ja tatsächlich das Instrumentarium dieser neuen Medienwelt aus dem Effeff beherrschen. Das legt dann den Schluss nahe: Lass’ das mal die Profis machen!
Doch das greift zu kurz. Denn genau so, wie Forschende sich mit Forschungsdaten oder Forschungssoftware beschäftigen (nicht zuletzt dank Initiativen wie den Carpentries), obwohl es weiterhin professionelle Programmierer*innen und IT-Administrator*innen gibt, können und werden sie es auch mit dem Handwerk der Kommunikation halten. Hier wie dort werden traditionelle Rollenverständnisse legitim weiterexistieren (z. B. Forschende, die sich auf „reine“ Forschung fokussieren), aber daneben werden eben auch neue Spezialisierungen und Vermischungen entstehen und wachsen.
Und aus Sicht der Wissenschaftskommunikation betrachtet: Mit der Verteidigungshaltung sollten wir uns nicht begnügen. Institutionalisierte Wissenschaftskommunikation kann und muss angesichts der oben skizzierten Situation mehr leisten. Im Idealfall setzt sie den Rahmen für ein Zusammenspiel von Forschenden und Kommunikationsprofis in den digitalen Medien, bei dem die Forschenden einen Nutzen aus den Erfahrungen und Skills der Profis ziehen, und umgekehrt die Institutionen die Authentizität und den Schwung ihrer (Nachwuchs-)Forschenden mitnehmen und verstärken. Dabei lernen und wachsen beide Seiten mit- und voneinander.
Der Kommunikationsalltag, wie ich ihn in meinem eigenen Umfeld an der TIB beobachte, überzeugt mich davon, dass das funktioniert. Ansätze wie die Carpentries zeigen, wie es damit auch im Kommunikationsbereich noch schneller vorangehen kann: Wir brauchen ergebnisorientierte „kleine“ Ansätze wie Hackathons, Barcamps und Sprints, um uns die digitale Komplexität unseres gemeinsamen Arbeitsumfeldes kreativ zu „erspielen“ und dabei immer wieder neue Herangehensweisen zu entwickeln.
Weitere Beiträge zum Thema
Berichterstattung auf Wissenschaftskommunikation.de
- Hannah Schmid-Petri, Mara Schwind: Für die Vermittlung von Evidenz ist eine Aggregation des Forschungsstandes wichtig
- Tabea Steinhauer, Matthias Fejes und Julia Wandt: Twittern für die Wissenschaft!
Hintergrund
- Hannah Schmid-Petri, Mara Schwind in Forschung & Lehre, Ausgabe 8/21: Twittern für die Wissenschaft?
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wider.