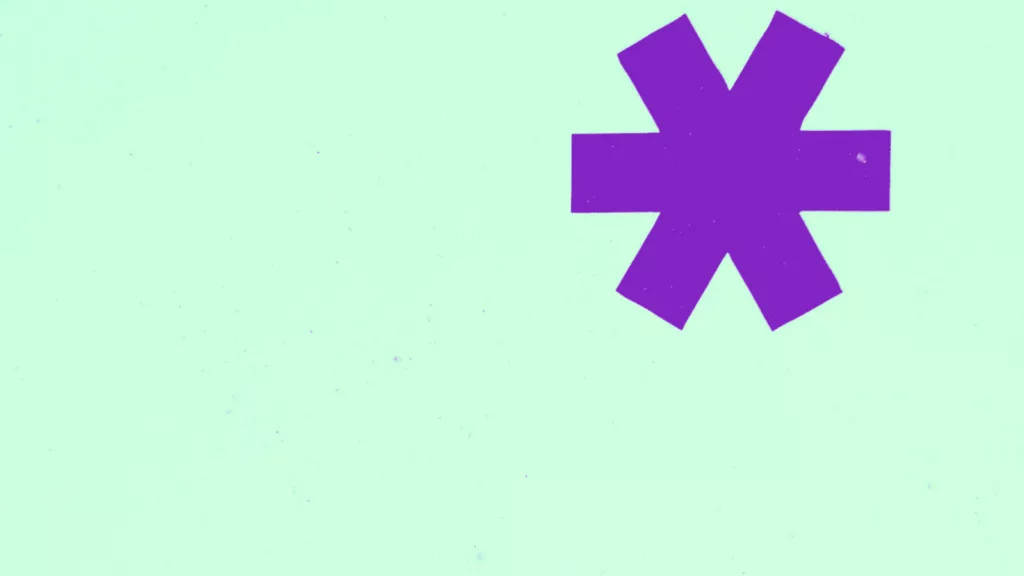„Das Gendern regt die Leute enorm auf“
Der Rechtschreibrat hat gerade eine Neuauflage seines amtlichen Regelwerks veröffentlicht. Sonderzeichen wie das Gendersternchen sollen „weiter beobachtet“ werden. Herr Lobin, Sie sind Mitglied im Rat für deutsche Rechtschreibung. Was für Reaktionen auf diese Entscheidung beobachten Sie bisher?

Henning Lobin: Dieser Beschluss wurde im letzten Sommer gefasst und ist nun gültig, da er von allen staatlichen Stellen der sieben deutschsprachigen Länder und Regionen angenommen wurde. Leider wird der Beschluss immer wieder missverstanden: Der Genderstern wurde nicht verboten. Er wurde lediglich als nicht zum Kernbestand der deutschen Rechtschreibung gehörig eingestuft, wie viele andere Sonderzeichen des täglichen Gebrauchs auch.
Das Spektrum der Reaktionen ist sehr groß. Wir erhalten viel Zustimmung, aber auch Morddrohungen, die wir natürlich zur Anzeige bringen. Die Drohungen basieren auf der Annahme, dass wir die Gesellschaft einer „Gehirnwäsche“ unterziehen wollen. Diese Reaktionen treffen den Kern unseres Projekts zur Polarisierung, in dem wir untersuchen, wie Wissen in polarisierten Debatten geteilt oder bewusst zerstört wird. In diesem Fall ist die vermeintliche Liberalität ein Triggerpunkt, den viele nicht ertragen können.
Angesichts solcher heftigen Reaktionen: Warum ist es wichtig, das Thema Gendern in der Wissenschaftskommunikation näher zu betrachten?

Karlsruher Institut für Technologie
Annette Leßmöllmann*: Das Gendern regt die Leute enorm auf. Wir wollen herausfinden, was genau die Trigger sind. Also: Kann man die sprachlich oder rhetorisch festmachen?
Olaf Kramer: In der Forschung zum Thema Wissenschaftskommunikation gibt es eine gewisse Gender-Blindness, also erstaunlich wenig Arbeiten, die sich wirklich mit der Gender-Problematik in der Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen. Insofern erschien es uns sinnvoll, das Gendern als Fallbeispiel für unser Projekt zu nehmen.
Grundsätzlich interessiert uns polarisierende Kommunikation, also Kontexte, in denen Streitfragen zu Identitätsfragen werden. Gendern ist dafür ein Beispiel, aber wir beobachten Ähnliches auch in der Klimakrise. Hinter der Frage, wie wir auf die Klimakrise reagieren sollen, steht eine ganze Identitätskonstruktion. An die Stelle einer sachlichen Bewertung wissenschaftlicher Erkenntnisse treten emotionale Debatten, Grabenkämpfe, die oft aus einem Gefühl der Bedrohung der eigenen Identität heraus entstehen.

Leßmöllmann: Wir wollen auch der Praxis signalisieren, wie man mit solchen Themen umgehen kann. Viele Kommunikator*innen haben große Probleme: Müssen wir diese Veranstaltung absagen; dürfen wir sie absagen; wie definieren wir Forschungsfreiheit? Das wirft große Fragen auf und ist ein wichtiger Impuls für unser Projekt.
Können Sie sich erklären, warum dieses Thema bisher im Forschungsbereich Wissenschaftskommunikation ausgeklammert wurde?
Leßmöllmann: Ich kann nur spekulieren, ob alles, was mit Gender zu tun hat, vielleicht zu einer gewissen Vorsicht führt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Menschen, die zum Thema Gender forschen, haben oft mit Hass zu tun. Das ist vielleicht ein Punkt, der uns in Zukunft mehr beschäftigen wird: Werden Nachwuchswissenschaftler*innen bestimmte Themen überhaupt noch aufgreifen, wenn sie wissen, dass sie dann Morddrohungen bekommen?
Kramer: Ich denke, es spielt auch eine Rolle, dass die Wissenschaftskommunikation oft auf Naturwissenschaften fokussiert ist. Dadurch kommen geistes- und sozialwissenschaftliche Themen, wie die Gender-Thematik nicht so zur Geltung, wie es vielleicht notwendig wäre.
Lobin: Zudem ist es bei diesem Thema besonders schwierig, auf die wissenschaftliche Ebene des Diskurses vorzudringen. Die Diskussion ist stark von Identitätsfragen überlagert, wie Olaf Kramer ausführte. Die Genderforschung ist äußerst vielfältig und umfangreich. Das zeigen auch die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Geschlechterforschung in Deutschland. Es geht nicht nur um Sprach- und Sozialwissenschaften, sondern auch um Maschinenbau, Stadtplanung, Medizin und Biologie. Überall gibt es Genderforschung. Insofern ist das Thema sehr schwer zu greifen, weil es ein enorm großes Querschnittsthema ist.
Sie wollen sich verschiedene polarisierte Diskurse ansehen. Was für Gemeinsamkeiten erwarten Sie in den Diskursen um das Gendern, Pandemie-Politik und Klimaforschung?
Kramer: Die verschiedenen Diskurse enthalten alle bestimmte Grundprinzipien polarisierender Kommunikation. So werden beispielsweise immer eine In-Group und eine Out-Group konstruiert. Die In-Group wird mit positiven Eigenschaften versehen, die Out-Group möglichst negativ dargestellt. Das ist ein Grundmuster, das sich in allen polarisierenden Diskursen wiederfindet. Rhetorisch haben wir dann mit Antithesen und Übertreibungen zu tun: Auf der einen Seite die Guten, auf der anderen die Bösen. Häufig wird auch hyperbolisch konstruiert, also stark übertrieben. Das Erkennen solcher Grundmuster hat den Vorteil, dass die Reaktionsmöglichkeiten, über die wir in unserem Projekt nachdenken, universell anwendbar sind. Natürlich gibt es diskursspezifische Aspekte, aber es gibt auch grundlegende Reaktionsmöglichkeiten, die im Geschlechterdiskurs genauso funktionieren wie im Klimadiskurs oder in anderen polarisierten Auseinandersetzungen.
Leßmöllmann: Auch der Diskurs über gute Wissenschaft wird in den sozialen Medien, etwa in den Kommentarspalten auf Instagram, immer wieder geführt. Also grundsätzliche Fragen wie: Was ist denn genau gute Klima- oder Genderforschung, und wer definiert das? Ist die Impfforschung von der Pharmaindustrie gekauft? Diese Art von Fragen über wissenschaftliche Qualität finden sich auch bei Querdenker*innen, die sich übrigens oft eine objektive und vorurteilsfreie Forschung wünschen. Das sind im Kern nachvollziehbare Anliegen, von Personen, die dann aber leider irgendwann in ihrer Argumentation falsch abbiegen. Solche epistemischen Aushandlungsprozesse findet man in vielen Diskursen.
Kramer: Das ist auch einer der Gründe, warum das Thema Gender vernachlässigt wird. Es gab eine Tendenz, Wissenschaftskommunikation sehr unpolitisch zu sehen und zu sagen, sie hat die Aufgabe, die gesicherten Ergebnisse der Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu tragen. In den letzten Jahren stellen wir aber zunehmend fest, dass viele Forschungsfelder unmittelbare gesellschaftliche Auswirkungen haben. Das gilt für die Künstliche Intelligenz genauso wie für die Virusforschung während der Corona-Pandemie. Man kann sich also nicht mehr so heraushalten, wie man es sich vielleicht früher oft gewünscht hat. Wissenschaftskommunikation hat eine politische Dimension.
Leßmöllmann: Es reicht eben nicht, einfach nur Fakten zu vermitteln. Das kann nach hinten losgehen, wie wir aus der Wissenschaftskommunikationsforschung wissen12. Jetzt müssen wir genau herausfinden, warum und wie das rhetorisch und sprachlich nach hinten losgeht und ob man daraus verallgemeinerbare Prinzipien ableiten kann. Das versuchen wir in unserem Projekt mit dem Fokus auf Linguistik und Rhetorik, was in der Wissenschaftskommunikationsforschung nicht Standard ist. Wir gehen also mit einem sprachlichen Fokus an ein sprachliches Thema heran.
Wie unterscheidet man denn Linguistik und Rhetorik?
Leßmöllmann: Die Rhetorik ist mehrere tausend Jahre alt, während die Linguistik eine viel jüngere Disziplin ist. Trotzdem gibt es viele Überschneidungen. Als übergreifende Methode dient uns die Korpuslinguistik. Durch den systematischen Aufbau von Korpora, also großen Sammlungen von Sprachdaten, versuchen wir, zum Beispiel den gesamten medialen Diskurs rund um Marie-Luise Vollbrechts abgesagten Vortrag bei der Langen Nacht der Wissenschaft an der Humboldt-Universität 2022 abzubilden. Die Debatten um die Zweigeschlechtlichkeit und pointierte mediale Schlachten um die Freiheit der Forschung sind zum Beispiel auf X sehr prominent geführt worden; auch die Bundesforschungsministerin hat sich eingeschaltet. Dann analysieren wir dieses Korpus aus verschiedenen theoretischen und methodischen Blickwinkeln und identifizieren zum Beispiel sprachliche Polarisierungs-Trigger.
Wir untersuchen sowohl kleine sprachliche Partikeln als auch ganze Diskurse. Ein Beispiel: Im Satz „wir wissen ja alle, dass es nur zwei Geschlechter gibt“ kann die kleine Partikel ‚ja‘ betonen, ein bestimmtes, angenommenes gemeinsames Wissen – einen Common Ground – für gesetzt zu halten. Das gemeinsame Wissen wird verstärkt, weniger hinterfragbar. Wir vermuten, dass das ein In-Group-Gefühl beim Publikum erzeugen oder verstärken kann. Diese Common Ground-Trigger sind eine Schnittstelle zur Rhetorik. Wir analysieren die sprachliche Ebene, um zu verstehen, wie Menschen sich diskursiv organisieren und welche Argumentationsmuster häufig vorkommen.
Kramer: Die Linguistik hat sich so entwickelt, dass sie sehr viel genauer auf einzelne Phänomene schauen kann. Die Common Ground-Theorien aus der Linguistik bieten eine Mikroanalyse, die die Rhetorik in dieser Form nicht leisten kann. Natürlich kann man rhetorische Figuren zuordnen, aber mit linguistischen Modellen sieht man mehr als mit der rhetorischen Systematik. Diese Kombination von globaler Kommunikationstheorie aus der Rhetorik und präziser linguistischer Analyse ist eine sehr gute Mischung für unser Projekt. Sie ermöglicht es uns, sprachliche Polarisierungseffekte genau zu untersuchen und empirisch zu stützen.
Was für ein rhetorisches Tool könnte man denn nutzen, um das Polarisierungspotenzial zu senken?
Kramer: Oft sind es Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Wenn ich den Unterschied zwischen Aussagen und Entscheidungsfragen nehme, dann sieht man das deutlich. Wenn ich eine Aussage zurückweise, steigt das Polarisierungspotenzial. Ein Beispiel: „Sam ist zu Hause“. Wenn das jemand verneint, gibt es eine kleine Kommunikationskrise. Wenn ich aber frage: „Ist Sam zu Hause?“, kann man einfach mit „Ja“ oder „Nein“ antworten.
Dieses Beispiel aus der Mikroebene ist für die Untersuchung von Polarisierungsphänomenen relevant. In der Wissenschaftskommunikation macht es einen Unterschied, ob man affirmativ und belehrend auftritt – „Wer nicht gendert, übt Dominanz aus und untergräbt das Prinzip der Chancengleichheit“ – oder ob man eine These eher als Frage einführt und mehrere Antworten zulässt. Auf diese Weise können Informationen möglicherweise besser vermittelt und Abwehrreaktionen vermieden werden. Diese kleinteilige sprachliche Modellierung hilft, die Wissenschaftskommunikation weiterzuentwickeln und der Polarisierungsfalle zu entgehen.
Sie sprachen bereits vom Common Ground-Modell in der Rhetorik. Warum ist es für die Wissenschaftskommunikation von Bedeutung?
Leßmöllmann: Common Ground kann als gemeinsames Wissen, aber auch als geteilte Grundannahmen verstanden werden. Diese Grundannahmen können sehr fundamental sein oder auf Erwartungen beruhen, die man in Gesprächen oder im medialen Austausch hat. Deshalb sind Linguistik und Rhetorik so wichtig, weil sie die Wissenschaften des Nicht-Gesagten, aber Mit-Gemeinten sind.
Lobin: Der Common Ground, also die Annahmen der Gesprächspartner*innen, müssen in Erfahrung gebracht werden. Oft stimmt das, was man annimmt, nicht. Deshalb brauchen wir im Gespräch Anhaltspunkte, um dieses Wissen über den anderen zu erlangen.
In der Kommunikation beispielsweise mit Kindern oder mit Menschen mit anderen religiösen Überzeugungen ist es beispielsweise sehr wichtig, diese Annahmen zu kennen, um eigene Kommunikationsziele zu erreichen. In der Wissenschaftskommunikation ist die Kenntnis von Wissen und Annahmen der Adressat*innen zentral, um damit umzugehen, wenn jemand etwa an Verschwörungstheorien glaubt oder für bestimmte Argumente nicht zugänglich ist.
Welche Mechanismen spielen dabei eine Rolle?
Kramer: Ein Beispiel ist das sogenannte „Grounding“. Dabei geht es darum, sicherzustellen, dass meine Botschaft von anderen richtig verstanden wird. Wenn ich merke, dass dies nicht der Fall ist, muss ich zusätzliche Informationen geben oder umformulieren, um eine gemeinsame Verständigungsbasis zu schaffen.
Common Ground erfordert auch, dass man sich an die Annahmen des anderen anpasst, selbst wenn man sie nicht teilt, um weiterarbeiten zu können. Dies ist wichtig für das Verständnis und sogar notwendig für koordiniertes Handeln.
Ihrem gemeinsamen Projekt zugrunde liegt auch das Konzept der sogenannten „Invitational Rhetorics“. Wie könnten sie in der Wissenschaftskommunikation eingesetzt werden?
Kramer: Invitational Rhetorics3 kann das Grundproblem polarisierter Debatten angehen, bei denen zwei Gruppen sich voneinander abgrenzen und nichts miteinander zu tun haben wollen. Ein Instinkt in der Wissenschaft wäre es in einem solchen Fall dagegen zu argumentieren und mit besseren Argumenten zu zeigen, dass die andere Seite Unrecht hat. Darauf sind wir im Wissenschaftssystem alle trainiert. Dieser Ansatz ist jedoch oft nicht effektiv. Mehr Klimakommunikation, die wiederholt erklärt, was uns erwartet, ist nicht unbedingt effektiv und führt nicht dazu, dass alle Menschen einsehen, dass die Klimakrise dringende Handlungen erfordert.
Leßmöllmann: Wie ich es verstehe, ist der erste Schritt für die Kommunikator*innen, selbst gegen den Strich zu denken. Es geht darum, den Impuls, mehr Fakten zu liefern oder auf Konfrontation zu gehen, zu überwinden und stattdessen eine systematische Irritation zu erzeugen, um eine andere Gesprächsebene zu erreichen. Man sollte aktiv unterschiedliche Positionen in unserer Gesellschaft wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen, sei es digital oder analog. Also raus aus der eigenen Blase!
Kramer: Im Idealfall führt das zu Veränderungen durch gegenseitiges Verstehen, nicht durch Belehrung und Überredung. Man vermeidet so weitere Polarisierung und Reaktanz.
Sie verwenden selbst auf Ihrer Projekt-Website den Genderstern und positionieren sich somit auf eine gewisse Weise. Was entgegnen Sie Kritiker*innen, die sagen, Sie seien bereits vor Beginn des Projektes voreingenommen?
Leßmöllmann: Ich kann gendergerechte Sprache verwenden und sie gleichzeitig kritisieren. Es ist nicht so, dass uns durch die Verwendung von Sprache automatisch eine Ideologie übergestülpt wird. Es gibt Thesen in der Öffentlichkeit über den angeblich sehr engen Zusammenhang zwischen Sprache und Denken, aber ich würde hier als Linguistin zu Vorsicht raten. Es ist nicht empirisch nachgewiesen, dass eine bestimmte Art zu reden auch klar determiniert, wie man denkt.
Lobin: Es gibt Forschungsgegenstände, die auf den ersten Blick wenig mit unserem Alltag zu tun haben, wie zum Beispiel Quantenphysik. Andere, wie Sprache und Sprachverwendung, sind stark in unser Leben integriert. Wir können uns einem solchen Thema nicht entziehen. Ob wir den Genderstern verwenden oder nicht: Wir verhalten uns irgendwie dazu. Wichtig ist, dass Forschende von ihrer eigenen Alltagsverwendung absehen und einen externen Blick auf sich selbst einnehmen können. Das ist in der Wissenschaft zwar üblich, wird ihr aber momentan immer stärker aberkannt.
Kramer: Es hängt immer von der Referenzgruppe und den Adressat*innen ab, auf die ich mich beziehe. Unsere Webseite richtet sich an ein wissenschaftliches Publikum, bei dem diese Sprachverwendung Teil eines breit geteilten Common Ground ist. Innerhalb dieser Community habe ich also kaum Polarisierungseffekte.
Der Trick ist aber, im öffentlichen Diskurs jemandem, der das völlig ablehnt, die Chance zu geben, seine Perspektive darzulegen und meine zu erklären, ohne voreingenommen zu wirken. Das ist Invitational Rhetoric: verschiedene Perspektiven zulassen und die Debatte nicht weiter polarisieren.
* Wissenschaftskommunikation.de ist ein gemeinsames Portal von Wissenschaft im Dialog (WiD) mit dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) und dem Lehrstuhl von Annette Leßmöllmann am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
- Kahan, Dan M. 2012. Cultural cognition as a conception of the cultural theory of risk. In Sabine Roeser, Rafaela Hillerbrand, Per Sandin & Martin Peterson (eds.), Handbook of Risk Theory. Epistemology, decision theory, ethics, and social implications of risk, 725–759. Amsterdam: Springer. ↩︎
- Kahan, Dan M., What is the ‚Science of Science Communication‘? (February 8, 2015). Journal of Science Communication, 14(3), 1-10 (2015), Yale Law School, Public Law Research Paper No. 539, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2562025 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2562025 ↩︎