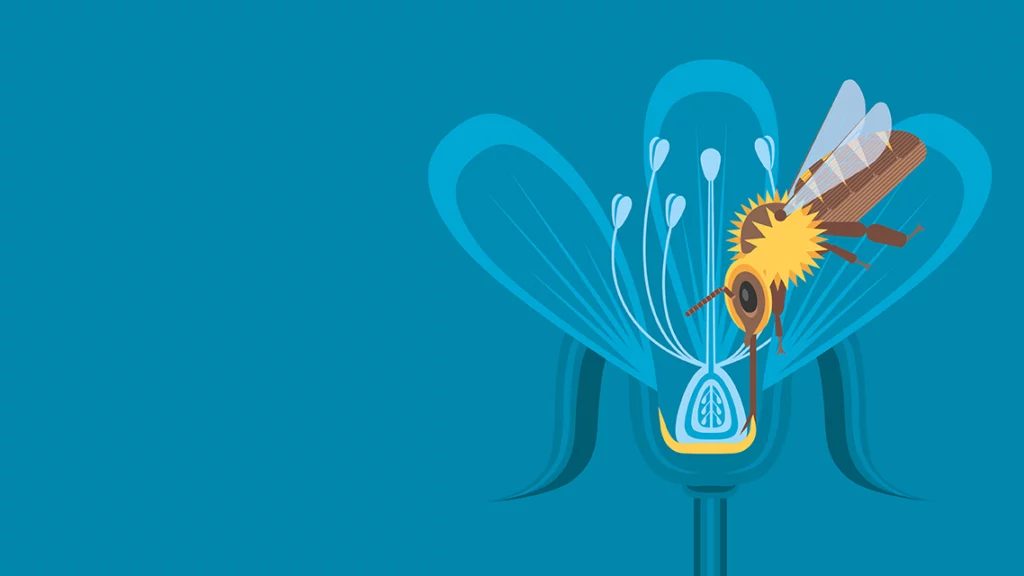Kommunikationsformate sollen immer persönlicher, interaktiver und digitaler sein. Ist das auch die Zukunft der Wissenschaftskommunikation? Wir haben Kommunikationsberater Claudio Gallio gefragt.
AR, VR, 360° – Was sind die zukünftigen Trends in der Wissenschaftskommunikation?
Herr Gallio, was sind die Formate der Zukunft in der Wissenschaftskommunikation? Sehen Sie Trends?
Ich würde zunächst gerne zwischen neuen Formaten, die auch mal Trends unterliegen, und einem grundsätzlichen Wandel in der Wissenschaftskommunikation unterscheiden. Während früher der Schwerpunkt auf dem Faszinosum Wissenschaft lag – zu zeigen, was alles technisch möglich ist – wird heute viel mehr nach der Sinnhaftigkeit von Forschung gefragt. Es geht also stärker um die Gestaltung unserer morgigen Gesellschaft durch Wissenschaft heute, um Relevanz, Alltagsnähe und Akzeptanz. Das ist zunächst sehr zu begrüßen. Daraus folgt, dass etwa Citizen Science oder andere partizipatorische Formate an Bedeutung gewinnen. Der Wissenschaftler ist hier nicht mehr abgehobener oder auch mal alltagsfremder Welterklärer, sondern ein Berater auf Augenhöhe, der natürlich über Spezialwissen verfügt, welches er aber alltagsnah und plakativ vermitteln muss.

Müssen Formate immer persönlicher, interaktiver, digitaler werden?
In der Regel ist das so, aber das ist für Wissenschaftskommunikatoren erst der zweite Schritt. Viel wichtiger ist es, zunächst eine Vermittlungsstrategie zu entwickeln, die die Relevanz des Themas rüberbringt. Die zweite Frage ist dann die nach den Kanälen und Formaten. Ob ich neue Tools wie Augmented oder Virtual Reality einsetzen will, hängt von meinem Inhalt und meiner Vermittlungsstrategie ab. Und natürlich gilt: Wenn ich ein großes Thema groß und langfristig bespielen will, werde ich keinen Kanal vernachlässigen …
Wie bauen Sie eine Vermittlungsstrategie zu einem Thema auf?
Wir versuchen zunächst, uns klarzumachen, was eigentlich die Botschaft ist. Das Wissenschaftsjahr Meere und Ozeane zum Beispiel hatte ein Thema, das unmittelbar Sympathien auslöst, weil es spontan Vorstellungen von Romantik, Urlaub oder Freizeit evoziert. Da aber die wenigsten Deutschen direkt an der Küste leben, haben sie nicht den Eindruck, dass sie die gravierenden Veränderungen der Meere direkt betreffen. Sie sehen sich weder als Verursacher noch als Leidtragende von Meeresspiegelerhöhung oder Verschmutzung. Das ist aber ein Irrglaube. Zahlreiche Alltagsentscheidungen – ob ich nun Lebensmittel in eine Plastiktüte packe oder vor dem Frühstück ein Duschgel mit Mikroplastik-Kügelchen nutze – haben Auswirkungen auf die Meere, auch und vor allem aus dem Binnenland heraus. Deswegen haben wir als Grundlage der Vermittlungsstrategie den Satz formuliert: „Das Meer beginnt hier!“ Wir wollten die Menschen mit dem Meer vor ihrer Haustür konfrontieren. Und mit der politischen Dimension des augenscheinlich leichten Themas.
Wie haben Sie das genau gemacht?
Wir haben verschiedene Aktionen für das Binnenland entwickelt, die diese Vermittlungsstrategie um eine Erlebnisdimension erweitert haben – zum Beispiel die Plastikpiraten für eine jugendliche Zielgruppe. Bei diesem Format haben wir direkt über Schulen, über außerschulische Lernorte und über soziale Medien viele junge Menschen dazu bewegt, an Fluss- und Seeufern deutschlandweit Plastik zu sammeln und die Ergebnisse der Forschung zur Verfügung zu stellen, also ein klassisches Citizen-Science-Projekt mit einem verlängerten PR-Arm. Denn so gut wie jede Sammelaktion wurde wiederum von lokalen Medien begleitet. Ein zweites Beispiel ist die Elbschwimmstaffel. Hier sind erstmals 250 Hobbyschwimmerinnen und -schwimmer aus der Region gemeinsam mit Kampagnenbooten und mit einem Forschungsschiff die gesamte Elbe hochgeschwommen. Das hat einerseits für eine Aktivierung der gesamten Region – andererseits auch für überregionale Aufmerksamkeit über die entsprechende Medienresonanz gesorgt.
Wie messen Sie den Erfolg solcher Aktionen?
Die klassische und zugleich harte Währung, in der gemessen wird, ist die erzielte Präsenz in TV, Radio, Print und online – also Presseclippings – sowie die Zahl der Teilnehmenden an den einzelnen Stationen. Dabei geht es aber nicht nur um die Quantität (also Reichweite) der Berichterstattung, sondern auch um die Qualität der Botschaften. Wir konnten viele Interviews, Porträts und Hintergrundgeschichten vermitteln und so nicht nur die Kernbotschaft „Das Meer beginnt hier“, sondern das Thema insgesamt tiefgründiger kommunizieren.
Wie wählen Sie das richtige Format für eine Zielgruppe aus?
Ein Format wird ja eher entwickelt als gewählt. In der Wissenschaftskommunikation kann es verschiedene Gründe dafür geben, warum man eine Zielgruppe in den Fokus rückt. Vielleicht will man bestimmte Menschen erreichen, weil sie bisher noch sehr weit weg von einem Thema sind und die Relevanz noch nicht erkannt haben. Oder aber umgekehrt, weil sie schon sehr nah dran, vielleicht sogar Verursacher oder direkt Betroffene sind, aber gewisse Zusammenhänge noch ignorieren. Das passende Format ist dann jenes, welches das Vorwissen der Zielgruppe berücksichtigt, die Menschen also auf Augenhöhe anspricht und ihnen dann ein Aha-Erlebnis verschafft. OK, ich gebe zu: Ein bisschen Magie ist dabei…
Welche Zielgruppen sind leichter, welche schwerer zu erreichen?
Junge Menschen in der Ausbildungs- und Lernphase des Lebens, vom Kindergartenkind bis zum Studierenden, sind in der Regel recht gut zu erreichen. Sie sind neugierig, medienaffin, und man kann stark mit Multiplikatoren wie Lehrern, Trainern, Professoren oder Erziehern arbeiten. Aktionen kann man hier außerdem so spielerisch aufbauen, dass sie dann dankbar angenommen werden. Viel schwerer wird es bei den Erwachsenen, die in der Rushhour des Lebens zwischen Beruf und Familie stehen. Da muss man Relevanz und Alltagsnähe besonders hervorheben und erklären, warum sie sich mit einem neuen Thema beschäftigen sollten. Hier kann auch die Vermittlung über etablierte Medien helfen.
Es heißt doch immer, die Menschen lesen weniger Zeitung oder nutzen weniger klassische Medien. Funktioniert Pressearbeit trotzdem noch?
Sie funktioniert weiterhin. Der Talk in Town wird aber natürlich nicht mehr alleine durch die Tageszeitung geprägt, die hier und da morgens noch im Briefkasten liegt. Onlinemedien und Social-Media-Kanäle sind dabei entscheidend. Aber die reine Präsenz ist auch hier noch kein Allheilmittel. Nur attraktive Inhalte, die tagesaktuell oder überraschend sind, die mit Bewegtbildern oder mit klugen Gewinnspielmechaniken daherkommen, funktionieren gut. Wir machen aber überdies auch gute Erfahrungen mit dem klassischen Medium Hörfunk. Radio ist tatsächlich ein dankbares und niederschwelliges Medium für die Wissenschaftskommunikation. Wenn man interessante Interviewpartner vermitteln kann, nehmen die Redaktionen das gerne an – und viele hören zu.
Gewinnspiele und Videos sind eher aufwendige Formate. Braucht man heute mehr Manpower, um die gleiche Menge Menschen zu erreichen?
Nicht unbedingt. Der Ressourceneinsatz findet meist in den frühen Stadien statt, wenn man sich in ein wissenschaftliches Thema einarbeitet oder Vermittlungsstrategien und Botschaften entwickelt. In der Produktion sind dann viele dieser neuen Formate wie Selfies oder kurze Videos nicht immer sehr aufwendig – und wirken ggf. viel authentischer als ein durchproduziertes Video, das Kinoqualität hat.
Wird das auch in der direkten Wissenschaftskommunikation durch Forschende schon umgesetzt?
Das ist eine Generationenfrage. Das Forschungs-Establishment hadert manchmal noch mit diesen individuellen Produktions- und Selbstvermarkungsmethoden. Viele zwischen zwanzig und fünfzig aus dem Mittelbau sehen das aber oft ganz anders. Bei ihnen ist eher die Frage, ob sie zeitlich auch immer selbst in der Lage sind, so etwas umzusetzen. Viele sind tatsächlich Vollprofis und haben im Studium bereits gelernt, eigene Explain-it-Videos zu drehen, auf Science Slams aufzutreten und vor Publikum Thesen zuzuspitzen. Da sehen wir selbst in der klassischen Wirtschaft oder in der Politik oft einen konservativeren Medieneinsatz.Wie gestaltet man eine gute Kommunikationskampagne?
Zumindest bei einer Wissenschaftskampagne sollten vor der Konzeption maßgeblich drei Fragen diskutiert werden: Liegt dem Ganzen, erstens, ein wirklich relevantes und gut erzählbares Thema zugrunde? Ist der Kommunikationsabsender, zweitens, auch glaubwürdig und kompetent, um diese Geschichte zu erzählen? Und gibt es, drittens, charismatische, spannende, interessante Köpfe, die man auf die Kampagnenbühne setzen kann? Der Rest ist dann Magie …