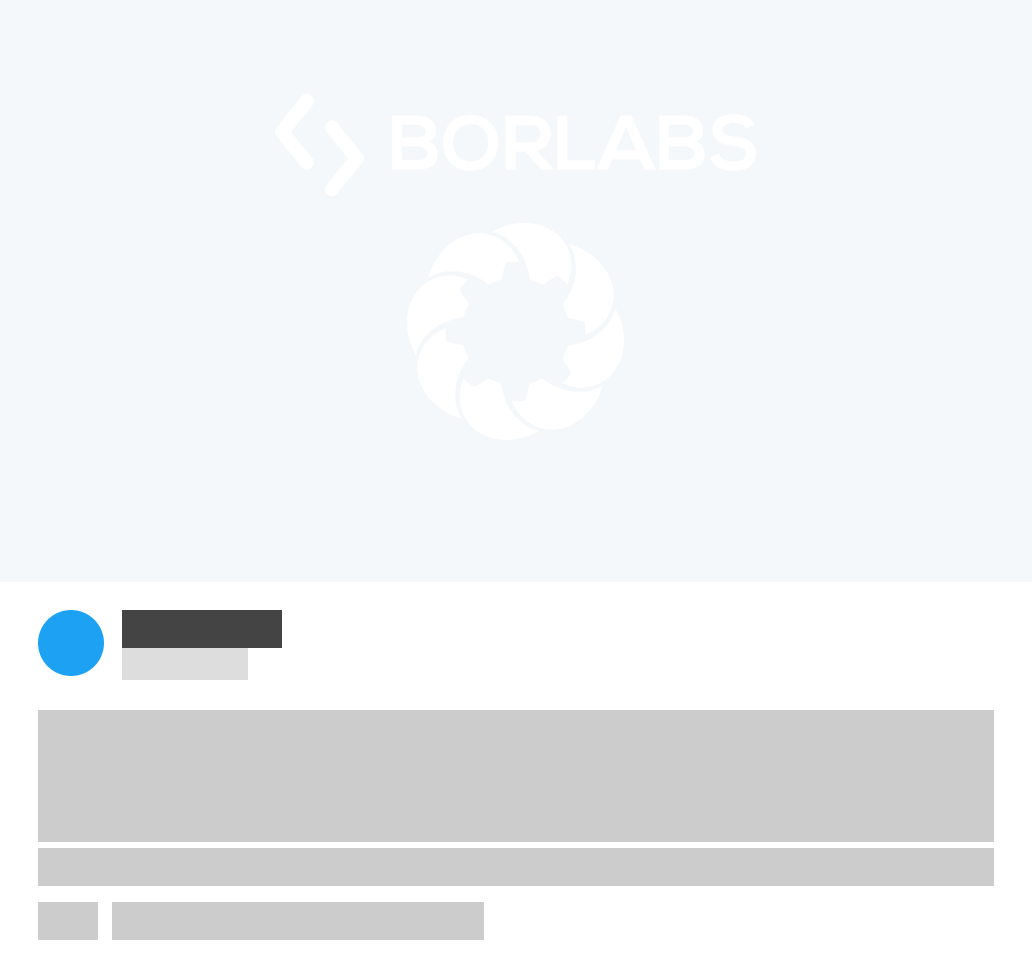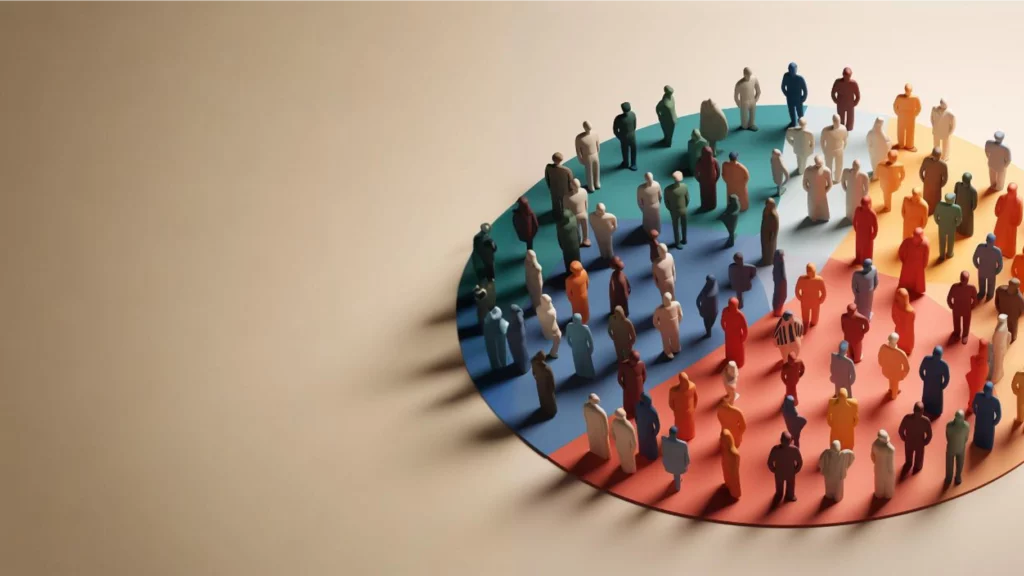Was ist eigentlich dieses Vertrauen von dem immer alle sprechen? Wie sehr Vertrauen die Menschen in die Wissenschaft? Und wenn es fehlt, wie kann man es gewinnen? Damit beschäftigte sich eine der Arbeitsgruppen im Rahmen der Tagung „Wissenschaft braucht Gesellschaft“. Moderiert wurde sie von Markus Weißkopf, Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog.
Tagung #wowk17 – Befinden wir uns überhaupt in einer Vertrauenskrise?
Insgesamt ist das Vertrauen in die Wissenschaft hoch, so die erste und wohl wichtigste Schlussfolgerungen aus dem Impulsvortrag von Julia Metag, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Universität Fribourg in der Schweiz. Das belegen verschiedenste Studien im nationalen und internationalen Kontext wie beispielsweise das Wissenschaftsbarometer für Deutschland und die Schweiz. Hat die Wissenschaft und damit auch die Wissenschaftskommunikation also gar kein Vertrauensproblem? Zumindest, so zeigen die Daten, kein Flächendeckendes und kein so großes, wie es oft in den Medien dargestellt wird.
Zunächst ein paar Worte zur Verteilung des Vertrauens innerhalb der soziodemographischen Schichten in der Gesellschaft. Metag zeigt auf: Vertrauen ist individuell von Bildung und Wissenschaftsnähe abhängig, aber eher nicht von Alter, Religion, politischer Meinung oder Geschlecht – zumindest in Deutschland und der Schweiz, so die Einschränkung.
Weniger Vertrauen für Forschung in der Industrie
Ebenfalls bemerkenswert beim Blick auf die Studienergebnisse: Das Vertrauen in Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die für Universitäten und Forschungseinrichtungen arbeiten, ist größer als das in diejenigen, die in der Industrie tätig sind. Das ist folgerichtig, schließlich wird als Grund für Vertrauen in allen Studien auch das Vertrauen in das System Wissenschaft und in die wissenschaftlichen Standards genannt – die Institution Universität beziehungsweise Forschungsorganisation hat also immer noch eine gewisse Macht und Kraft. Zumindest im Publikum gibt es in der anschließenden Diskussion Stimmen, dass dies unter anderem an der guten PR-Arbeit der Wissenschaftsinstitutionen liegen könne. Hier muss in Zukunft auch die Frage gestellt werden, was das bedeutet, wenn wir mehr und mehr drittmittelabhängig in der Forschung sind und dadurch automatisch enger mit der Politik verknüpft.
Doch was ist das eigentlich, dieses Vertrauen von dem dabei immer wieder gesprochen wird? Michaela Maier, Professorin an der Universität Koblenz-Landau, erklärt die drei Ebenen, die uns darin beeinflussen, ob wir jemanden Vertrauen oder nicht als Integrität, Kompetenz und Wohlwollen. Wenn wir einem Forschenden diese drei Eigenschaften zuschreiben, sind wir eher geneigt, seinen Ergebnissen zu vertrauen. Bei den ersten beiden sehen sowohl sie als auch ihre Kollegin Monika Taddicken, Professorin an der TU Braunschweig, nur wenige Probleme im deutschen Wissenschaftssystem. Einzig in Sachen Integrität könne die Kommunikation von fehlerhaften Ergebnissen beziehungsweise negativen Erkenntnissen weiter zunehmen.
Den gesellschaftlichen Nutzen der Forschung vermitteln
Anders sieht es beim Wohlwollen oder anders der Gemeinwohlorientierung aus. Zugespitzt also dem Bereich, der anzeigt, ob ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sich um die Allgemeinheit kümmert bzw. bemüht – wobei der englische Begriff „somebody cares“ besser passt. Grundlage für Vertrauen – und hier herrscht sowohl im Publikum als auch auf dem Podium Einigkeit – sind das Verständnis wissenschaftlicher Prozesse, wissenschaftlicher Werte und eben auch der sozialen Komponente der Wissenschaft – also der gesellschaftlichen Verantwortung. Hier sieht Maier gerade in der Grundlagenforschung Probleme, die im allgemeinen nur schwer mit direkten Errungenschaften für Menschen und Alltag zu verbinden ist. Gleichzeitig ist hier ein möglicher Ansatz für die Kommunikation, die Wissenschaft bei der Vertrauensbildung zu unterstützen.
Unterstützung die die Wissenschaft vor allem dann zu brauchen scheint, wenn sie sich in das Zusammenspiel mit Politik und Wirtschaft begibt, denn dann sinkt das Vertrauen in sie. Denn die Debatte im Publikum zeigt schnell, was auch die Datenanalyse widerspiegelt: Das Problem besteht im komplexen System und nicht unbedingt unmittelbar zwischen der Bevölkerung und der Wissenschaft.
Ist die Krise eher die der Medien und Politik?
Ist also die angebliche Vertrauenskrise der Wissenschaft eher eine Krise der Medien und Politik? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Dass sie aufgeworfen wird ist dennoch wichtig, betont Markus Weißkopf in seinem Fazit. Ebenso einig sind sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops und wohl auch der Konferenz insgesamt, dass man einen Umgang mit der Problematik Fake News und Wissenschaftsskepsis in bestimmten Teilen der Gesellschaft entwickeln muss. Das „Wie“ ist auch hier die große bisher noch unbeantwortete Frage, denn – so zeigt die Debatte und die Analyse der Studien zu Vertrauen – dafür, wie man Vertrauen gewinnt und Skeptikern begegnet, dafür gibt es noch keine echte Lösung.
Alle Beiträge zu #wowk17, der Tagung „Wissenschaft braucht Gesellschaft“ der Volkswagen-Stiftung, 25.–26.10.2017:
- Ausblick und Zielsetzung: Geh‘ weg mit deinen Fakten!
- Eröffnungsimpuls von Naomi Oreskes: Die richtige Portion Skepsis … und Öffentlichkeitsarbeit
- Arbeitsgruppe 1 zur Rolle der Medien: Wissenschaftsjournalisten als Vermittler auf Abruf
- Arbeitsgruppe 4 zum Umgang mit Skepsis: Befinden wir uns überhaupt in einer Vertrauenskrise?
- Ergebnisse: Zu Besuch im Physikerzoo?