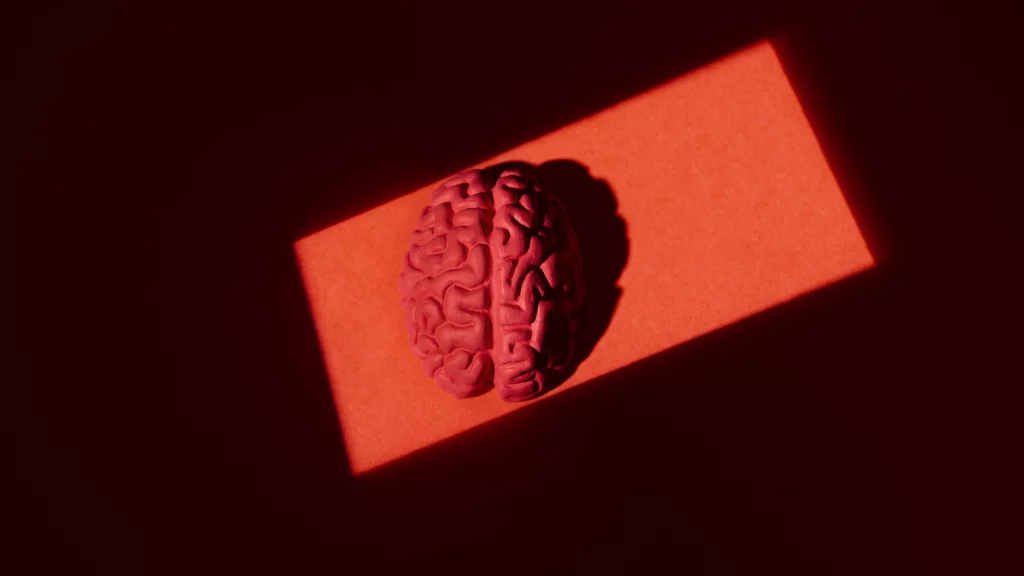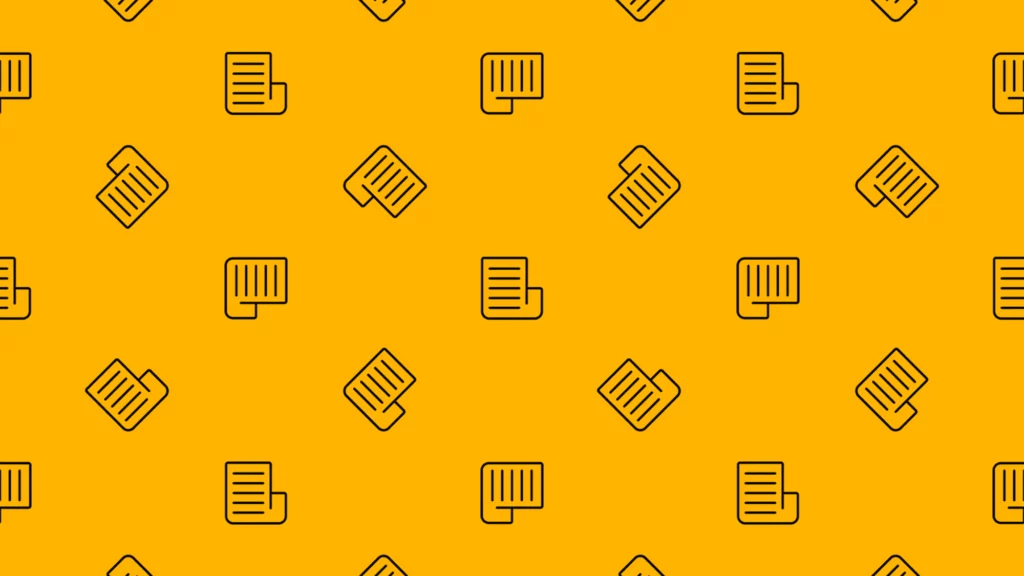Vernetzen, orientieren, professionalisieren: Das WissKomm-Kolleg unterstützt junge Wissenschaftskommunikator*innen beim Karrierestart. Wie genau? Darüber spricht Absolventin Jana Haack im Interview.
„Ich habe jetzt wieder ein Netzwerk, an das ich mich mit Problemen wenden kann“

Das WissKomm-Kolleg ist 2024 in die erste Runde gestartet. Was war Ihre Motivation, sich zu bewerben?
Gerade am Anfang meiner Karriere wollte ich mich mit Leuten austauschen, die in einer ähnlichen beruflichen Situation sind wie ich. Welche Berufsfelder gibt es in der Wissenschaftskommunikation? Welche Qualifikationen brauche ich für bestimmte Berufe? Bei diesen Fragen sind Wissenschaftskommunikator*innen beim Berufseinstieg oft auf sich gestellt. Ich selbst bin nach meinem Volontariat in der Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Universität Münster in meine jetzige Stelle als Wissenschaftskommunikatorin für ein großes Forschungsprojekt gewechselt. Mir fehlte das Volontariats-Netzwerk, in dem ich mich mit Kolleg*innen austauschen konnte, die in einer ähnlichen beruflichen Situation steckten. Diesen Austausch hatte ich mir vom WissKomm-Kolleg erhofft.
Wisskomm-Kolleg
Das WissKomm-Kolleg ist ein Jahresprogramm, das sich an junge Wissenschaftler*innen, Kommunikator*innen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Wissenschaftsjournalist*innen richtet. In vier Modulen lernen sich die Teilnehmenden kennen und können sich über Erfahrungen, Projekte und Erwartungen austauschen. Ziel ist die Vernetzung und Professionalisierung der eigenen Arbeit. Das Wisskomm-Kolleg wird von der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. und der Claussen-Simon-Stiftung gemeinsam mit den Kooperationspartner*innen Bundesverband Hochschulkommunikation**, Volkswagenstiftung, Wissenschaft im Dialog* und dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation* durchgeführt.
Im Januar ging Ihr Jahr am WissKomm-Kolleg zu Ende. Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
Zum einen wollte ich mir selbst klarer werden: Was will ich in der Wissenschaftskommunikation erreichen und wo will ich beruflich hin?
Zum anderen wollte ich mich mit Gleichgesinnten vernetzen. In beiden Punkten wurden meine Erwartungen voll erfüllt oder sogar übertroffen. Ich habe jetzt wieder ein Netzwerk, an das ich mich mit Problemen wenden kann, die vielleicht nicht die Arbeitskollegin als erstes hören sollte oder wo Freunden der berufliche Hintergrund fehlt.
Können Sie ein Beispiel für Probleme nennen, mit denen Sie sich an das Netzwerk wenden?
Wir haben zum Beispiel viel darüber gesprochen, wie man es schafft, sich Freiräume für die eigene Entwicklung zu schaffen, zum Beispiel eigene Projekte zu etablieren. Ein Thema war auch, sich als jüngere Person ein Standing aufzubauen und zu sagen: Ich habe Kompetenzen, die ich einbringen kann. Und das Selbstbewusstsein entwickeln, selbst Vorschläge zu machen.
Es hat mir sehr geholfen, dass ich diese Themen mit dem Netzwerk diskutieren konnte. Man kann fragen: Seht ihr das auch so? Welche Lösungsvorschläge habt ihr vielleicht gefunden?
Sie haben erwähnt, dass Sie in ihrem Beruf Wissenschaftskommunikation für ein großes Forschungsprojekt machen. Worum geht es in diesem Projekt?
Ursprünglich bereitete mein Chef, Hubert Wolf, Professor für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, eine Biografie über Papst Pius XII. vor. Als die Archive im März 2020 zum Pontifikat Pius XII. geöffnet wurden, hat er in den Archiven des Vatikans nach Material gesucht. Doch stattdessen fanden er und seine Mitarbeiter*innen Bittschreiben, mit denen sich jüdische Verfolgte während des Zweiten Weltkriegs an Papst Pius XII. gewandt hatten. Das Projektteam beschloss, sich auf diese Bittschreiben zu konzentrieren und diese Stimmen wieder hörbar zu machen. Dazu werden die Briefe identifiziert, aufbereitet und in einer digitalen Edition der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So entstand das Projekt „Asking the pope for help“.
Die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, wie es ist, in den Archiven des Vatikans zu arbeiten. Deshalb ist es uns wichtig, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den Forschungsprozess mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Welche Inspirationen für das Projekt konnten Sie aus den Gesprächen mit anderen Teilnehmer*innen beim WissKomm-Kolleg gewinnen?
Wir sind im Projekt immer auf der Suche nach neuen Formaten, um vor allem jüngere Menschen zu erreichen. Dafür konnte ich viele Anregungen mitnehmen. Ich habe mich zum Beispiel mit einem Teilnehmer ausgetauscht, der Spiele als Format nutzt. Unser Projekt behandelt ein sensibles Thema, deshalb hatte ich anfangs Bedenken. Gemeinsam mit ihm habe ich überlegt, wie man ein Spiel zu einem so sensiblen Thema umsetzen kann. Um das Dilemma zu umgehen, das die Perspektive eines Verfolgten mit sich bringen würde, entwickelten wir die Idee, die Perspektive von Archivar*innen oder Forscher*innen einzunehmen. Man würde diese Person bei der Spurensuche begleiten, um die Geschichte der Menschen hinter den Bittschriften zu rekonstruieren. Eine andere Idee, um jüngere Zielgruppen zu erreichen, ist mit der Wissenschaftskommunikatorin und Illustratorin Sophie Elschner entstanden. Graphic Novels oder Comics könnte ich mir auch für unser Projekt gut vorstellen.
Es gab insgesamt vier Module, in denen verschiedene Themenschwerpunkte behandelt wurden. Welche Erkenntnisse konnten Sie in den Modulen gewinnen?
Besonders das Modul „Verantwortung“ hat mir die Augen geöffnet. Da ging es um Fragen wie: Sehe ich mich in Zukunft in einer Führungsrolle? Welche Rolle möchte ich in Teamstrukturen einnehmen? Welche Verantwortung hat Wissenschaftskommunikation gegenüber der Gesellschaft? Da hatte ich einige Aha-Momente, welche Aufgaben und welche Verantwortung eine Führungsposition aber auch die Arbeit im Berufsfeld allgemein mit sich bringt.
Gleichzeitig ging es auch darum, Selbstbewusstsein für die eigene Arbeit zu entwickeln und zu reflektieren, wo man bereits viel Verantwortung übernimmt. Ich berate zum Beispiel meinen Chef und er verlässt sich auf meine Expertise. Dass ich da schon viel Verantwortung übernehme, war mir vorher gar nicht so bewusst. Auch die Zusammenarbeit zwischen Journalist*innen und der institutionellen Wissenschaftskommunikation wurde in Modul 2 und 4 thematisiert.
Wie werden institutionelle Kommunikator*innen von Journalist*innen wahrgenommen? Was brauchen Journalist*innen von uns? Diese Medienlogiken und gegenseitigen Erwartungshaltungen verliert man aus den Augen, es war sehr hilfreich, das noch einmal zu vertiefen.
Wie hoch war für Sie der zeitliche Aufwand für das WissKomm-Kolleg?
Ich hatte das Glück, dass mir die Teilnahme als Fortbildung beziehungsweise als Dienstreise angerechnet wurde. So hielt sich der zeitliche Aufwand in meiner Freizeit in Grenzen. Vor- und Nachbereitung sind aber schon notwendig. Vor allem die Präsenzmodule sollte man nacharbeiten, sonst geht viel verloren. Das hat das eine oder andere Wochenende gekostet.
Einmal im Monat versuchen wir uns zudem in Kleingruppen nach der Arbeit digital für eineinhalb Stunden zu treffen. Außerdem versuche ich mich mit anderen Teilnehmer*innen des Kollegs alle drei Monate persönlich zu treffen, das kann zum Beispiel auch auf einer Konferenz sein, wo wir uns verabreden.
Außerdem arbeiten wir als gesamter Jahrgang des Kollegs an einem Leitfaden, in dem wir unsere Zeit und die gewonnenen Erkenntnisse reflektieren. Damit möchten wir insbesondere jungen Kommunikator*innen eine Hilfestellung für den Start ins Berufsleben bieten. Vor allem in Form von Fragen, die helfen können, die eigenen Arbeitsstrukturen zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Letztendlich ist das natürlich alles Zeitaufwand, aber Zeitaufwand, der dieses Projekt am Leben hält und dafür sorgt, dass man auch selbst weiterhin davon profitiert.
*Wissenschaft im Dialog und das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) sind zwei der drei Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de
**Der Bundesverband Hochschulkommunikation ist Partner der Plattform Wissenschaftskommunikation.de