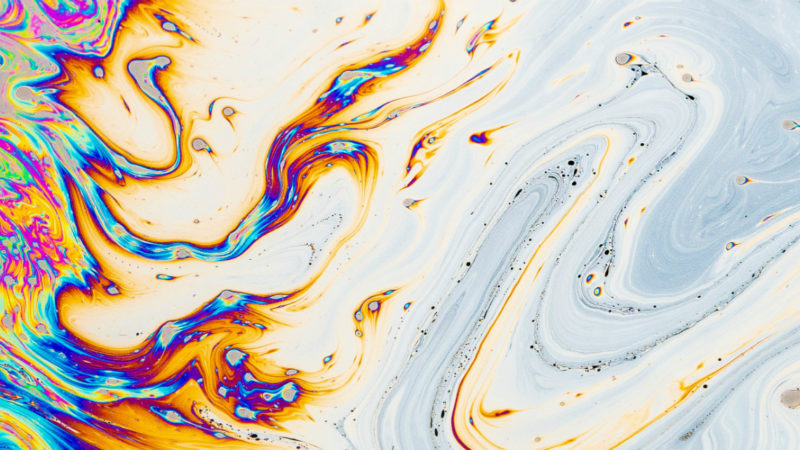Einsame Menschen fühlen sich oft von der Gesellschaft ausgeschlossen. Für die Demokratie kann das katastrophale Folgen haben, sagt der Soziologe Berthold Vogel. Welche Maßnahmen jetzt nötig sind.
Warum Einsamkeit politisch gefährlich ist
Herr Vogel, Sie schreiben, Einsamkeit könne die Demokratie gefährden. Ist es nicht übertrieben, einem persönlichen Gefühl eine solche politische Sprengkraft zuzuschreiben?

Die Frage ist, ob Einsamkeit wirklich nur ein persönliches Gefühl ist, also eine Emotion, die ausschließlich mit dem Individuum zu tun hat. Oder ob nicht doch mehr Soziales in der Einsamkeit steckt, als wir vielleicht auf den ersten Blick sehen.
Ich bin der Überzeugung, dass Einsamkeit ein soziales, ein gesellschaftsbezogenes Gefühl ist. Insofern hat Einsamkeit auch etwas mit der Entwicklung und Zukunftsfähigkeit einer Demokratie zu tun. Denn sie ist eine Emotion, die auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert und insofern kollektive Konsequenzen hat.
Können Sie den gesamtgesellschaftlichen Kontext etwas näher erläutern?
Zunächst einmal ist die Demokratie eine im Prinzip optimistische Staatsform. Zur Demokratie gehört, dass Menschen Interesse daran haben, sich aufeinander zu beziehen, also miteinander in Kontakt zu kommen, Kompromisse zu bilden und einen Konsens zu finden. Davon lebt die Demokratie: die Bürger*innen nehmen aufeinander Bezug.
Wenn ich mich einsam fühle, bitter werde und mich zurückziehe, dann werde ich weniger die Neigung haben, mich an Prozessen zu beteiligen, die für eine Demokratie förderlich sind. Einsamkeit fördert eine Haltung, die sich eher von der Gesellschaft abwendet.
Ist dann die Staatsform der Einsamen eine Diktatur oder ein totalitärer Staat?
Ich glaube nicht, dass einsame Menschen gleichsam von Natur aus autoritär gesinnt sind. Nicht jede Person, die sich einsam fühlt, ist daher schon Feind*in der Demokratie. Das wäre völlig übertrieben. In unserem Buch „Einsamkeit und Ressentiment“ versuchen wir zu zeigen, dass es keine Kausalität gibt. Es ist nicht so, dass Einsamkeit zwangsläufig zur Wahl extremistischer oder autoritärer Parteien führt.
Aber einsame Menschen sind empfänglicher für autoritäre Politikangebote, die ihre negativen sozialen Emotionen, ihre Verbitterung und ihre Weltabgewandtheit ansprechen und verstärken. Solche Politikangebote bedienen geschickt Ressentiments, also Groll und Vorurteile, die mit Einsamkeit einhergehen können.
Auch der Vertrauensverlust in öffentliche Institutionen, Parteien und Verbände scheint stark mit Einsamkeitserfahrungen zu korrelieren, wie zahlreiche Studien zeigen. Misstrauen ist in diesem Zusammenhang eine zentrale Kategorie. In der Isolation entwickelt man eher eine misstrauische Haltung – nicht nur gegenüber den Mitmenschen, sondern auch gegenüber der öffentlichen Ordnung und ihren Repräsentant*innen. Doch Vertrauen in die gewählte Politik, dass sie verantwortungsbewusste Entscheidungen trifft, ist für das gesellschaftliche Zusammenleben in einer Demokratie essenziell.
Es gibt einige Risikofaktoren, die Sie in Ihrem Buch auch klar benennen. Welche sind das?
Interessanterweise lässt sich Einsamkeit nicht eindeutig sozial zuordnen – sie betrifft Menschen quer durch alle gesellschaftlichen Schichten, Orte und Generationen. Eine wichtige Rolle spielt der Verlust öffentlicher Räume und Infrastrukturen. Es gibt immer weniger Einrichtungen, die Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen oder zumindest unterstützen.
Gerade im ländlichen Raum wirkt sich der Verlust öffentlicher Infrastruktur stark aus. Die örtliche Verwaltungsstelle ist verschwunden, auch die Bankfiliale schließt, ebenso die lokale Grundschule. Das soziale Leben vor Ort schwindet. Das hängt auch mit dem Bedeutungsverlust von Institutionen wie Parteien, Kirchen, Vereinen und Gewerkschaften zusammen, die als wichtige Treffpunkte dienten.
Ein weiterer Faktor ist der Wandel der Arbeitswelt. Veränderungen in der Arbeitsorganisation, wie Homeoffice und projektorientiertes Arbeiten, lösen feste Bindungen und Kollegialität auf, die früher durch die Arbeit vermittelt wurden. Dies hat zur Folge, dass Gemeinschaftserlebnisse in der Arbeitswelt tendenziell seltener werden. Auch die familiären Realitäten verändern sich. Natürlich kann man sich auch in einer großen Familie oder Ehe einsam fühlen, aber stabile soziale Bindungen – etwa familiäre Nähe oder nachbarschaftliche Beziehungen – können wichtige Schutzfaktoren gegen Einsamkeit sein.
Schließlich hat auch die Mediennutzung einen großen Einfluss. Soziale Medien bieten eine noch nie dagewesene Möglichkeit, negative Emotionen und Ressentiments anonym und ohne Korrektiv zu verstärken. Je radikaler die Position, desto mehr Bestätigung. Entscheidend ist, dass der direkte, persönliche Austausch mit anderen fehlt, der helfen könnte, die Emotionen zu beruhigen.
Sollte die Politik Gefühle ernster nehmen?
Die Politik sollte jedoch nicht nur über oder mit Gefühlen arbeiten, denn dies birgt auch Risiken – wie man an autoritären Parteien sehen kann, die negative Emotionen gezielt ausnutzen. Es ist wichtig, dass die Politik erkennt, dass Emotionen gesellschaftliche Auswirkungen haben und diese in ihre politischen Strategien einbezieht.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Demokratie gestärkt werden kann, indem Gesundheitsversorgung, Bildungseinrichtungen und funktionierende Verkehrsbedingungen gewährleistet werden. Strukturen, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden, stärken auch positive Emotionen für das Gemeinwesen.

Vertrauen spielt eine Schlüsselrolle – Vertrauen in die Wissenschaft, Vertrauen in die Demokratie. Was könnte die Politik tun, um Vertrauen wieder zu stärken?
Geselligkeit lässt sich nicht verordnen, das ist nicht Aufgabe der Politik. Aber die Politik kann darauf achten, öffentliche Räume und Gelegenheiten zu schaffen, an denen Menschen sich begegnen können.
Dazu gehört, Kreuzungspunkte zu fördern, an denen anlasslose Begegnungen stattfinden können, zum Beispiel in der Stadtteilbibliothek. Oder öffentliche Plätze so zu gestalten, dass Menschen sich dort gerne aufhalten. Das lässt sich durch einladende Architektur und Raumplanung erreichen.
Das Investieren in den öffentlichen Raum und in kommunale Initiativen ist eine sehr wichtige und sinnvolle Maßnahme, die nicht nur Einsamkeit bekämpft, sondern als Folge auch positive gesellschaftliche und demokratieförderliche Auswirkungen hat.
In Ihrem Buch sprechen Sie von einem „Psychological Turn“, also einer Art psychologischen Wende – wie beeinflusst das steigende Bewusstsein für mentale Gesundheit den gesellschaftlichen Umgang mit Einsamkeit?
In den Sozialwissenschaften ist generell ein gewisser „Turn“ zu beobachten, der die Emotionen stärker in den Mittelpunkt rückt. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die diesen Trend skeptisch sehen, da auf diese Weise die Gesellschaftsanalyse emotionalisiert und zu stark vereinfacht wird.
Ich persönlich denke aber, dass der Blick auf Gefühle, Emotionen und soziale Atmosphären für eine soziologische Analyse wichtig ist. Wir erleben Gesellschaft nicht nur als Struktur. Daher sollten wir uns in der Wissenschaft mehr mit sozialen Emotionen beschäftigen. Denn zu guter Letzt wählen die Menschen nicht nur nach Wahlprogrammen, sondern vor allem nach Emotionen.
Stichwort: Wahlen. Sie zitieren empirische Studien, die eine Korrelation zwischen Einsamkeit und autoritären Einstellungen belegen. Europaweit beobachten wir ein Erstarken des Rechtspopulismus. Wie nutzen Populist*innen diese Schwachstelle?
Ressentiment ist eine Ohnmachtserfahrung, die sich in dem Gefühl ausdrückt, die Welt dreht sich weiter – nur ohne mich. Alles, was um mich herum passiert, richtet sich eigentlich gegen mich, und ich bin nicht mehr Teil dieser Veränderungen, von denen alle anderen profitieren.
Autoritäre Parteien spielen sehr virtuos mit genau diesen Gefühlen. Sie geben den Menschen erst einmal die Bestätigung, dass sie mit ihrer Unzufriedenheit richtig liegen: Ja, die Welt ist gegen euch. Ihr habt Recht, dass man den Regierenden nicht mehr trauen kann. Ihr habt Recht, dass die Demokratie nur noch ein Geklüngel ist, dass die Mächtigen sich gegenseitig die Bälle zuspielen.
Sie holen die Menschen aus der Unsichtbarkeit und belohnen ihre Ansichten. Das ist ihr Erfolgsrezept. Gerade wenn man einsam ist, verstärkt sich das noch: Endlich ist jemand da, der einem sagt, dass man die Lage richtig erkannt hat, dass alles schief läuft, dass ein großer Krieg droht, dass die Wärmepumpe das Verhängnis ist, dass man durch die Politik der Ampelkoalition ruiniert wird. Es tut gut, endlich jemanden zu haben, der einem sagt: „Du hast Recht, und ich bin dein Sprachrohr“. Diese Verbindung, die sehr giftig ist, funktioniert im Moment leider sehr gut.
Wie kommuniziert man am besten mit Personen, die sich einsam fühlen und denen, die Ressentiments verspüren?
Als Soziologe habe ich das Privileg, viele verschiedene Lebenswelten kennenzulernen, sei es in Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen und durch Diskussionen mit Entscheidungsträger*innen. Diese Erfahrungen motivieren mich, Menschen nicht in ihren Ressentiments stecken zu lassen. Ich möchte in meiner Forschung Menschen in ihren unterschiedlichen sozialen Realitäten eine Stimme geben, sie verstehen und sie nicht nur als “zu Belehrende” betrachten. 
Diese Aufgabe, Ressentiments ernst zu nehmen und ihnen eine Form zu geben, in der sie demokratisch verhandelbar sind, muss uns leiten. Wir sollten unsere Kommunikation überdenken, unsere Formate verändern, damit wir nicht nur mit uns selbst sprechen oder nur innerhalb unserer wissenschaftlichen Community kommunizieren.
Ein Beispiel: Ich war mit einer Projektgruppe im ländlichen Raum unterwegs und wir haben Dorfspaziergänge zum Thema „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ gemacht. Damit wollten wir zeigen, dass man nicht in eine Universitätsstadt wie Göttingen kommen muss, um etwas über Wissenschaft zu erfahren. Wissenschaft muss zur Gesellschaft sprechen können, muss in der Gesellschaft sichtbar sein. Erst dann wird sie nach meinem Verständnis ihrer Verantwortung gerecht.