Protestbewegungen an Universitäten sind kein neues Phänomen. FU-Präsident Günter M. Ziegler erklärt, wie die Gründungsgeschichte die Freie Universität Berlin als Ort der Systemkritik geprägt hat und welche Rolle der Dialog in der aktuellen Krise spielt.
„Um Vielfalt zu gewährleisten, müssen alle Seiten zu Zugeständnissen bereit sein.”
Herr Ziegler, die Freie Universität Berlin wurde 1948 als Reaktion auf die Verfolgung systemkritischer Studierender gegründet. Inwiefern sind Protest und Systemkritik in der DNA der FU Berlin verankert?

Das steckt tief in unserer DNA. An der damaligen Universität Unter den Linden, der späteren Humboldt-Universität, im Ostteil der Stadt wurden nicht nur Studierende, sondern auch Dozierende aufgrund ihrer systemkritischen Haltung verfolgt. Diese Personen wollten eine freie Universität und gründeten sie im amerikanischen Sektor, mit Unterstützung von Ernst Reuter, dem Bürgermeister von Berlin. Die FU ist also eine Gründung von kritischen Studierenden, und trägt das auch im Namen.
Das Siegel der Universität trägt die Worte Veritas, Iustitia, Libertas – Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit – worauf sich auch die Studierendenproteste in den 60er Jahren beriefen. 1966 hatten wir an der FU das erste Sit-in und das erste Teach-in an einer bundesdeutschen Universität. Rudi Dutschke, der das mit angeführt und 1973 an der Freien Universität promoviert hat, ist vielleicht der berühmteste Student dieser Zeit. Proteste sind Teil einer langen Tradition an unserer Universität, ihre Mitglieder setzen sich für soziale Gerechtigkeit und kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen ein. Schon seit der Gründung der Hochschule.
Was unterscheidet denn die Proteste von heute von denen von damals?
Der Unterschied liegt aber auch an der Unklarheit der Akteur*innen, die damit einhergeht. Damals, Ende der 60er Jahre, war klar, wer spricht. Das ist heute teilweise nicht mehr so. Da verbergen sich hinter Instagram-Accounts und Social-Media-Hashtags wie „Students for Palestine FU“ und „Student_Coalition_Berlin“ unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Vorstellungen und Forderungen.
Ist mittlerweile etwas Gras über die Sache gewachsen?
Es ist weiterhin akut. Direkt nach der Beendigung des Protestcamps folgte die kurzfristige Besetzung eines Hörsaals. Und es war dann leider keine verlässliche Kommunikation mit den Akteur*innen möglich, weshalb wir letztlich den Hörsaal von der Polizei räumen lassen mussten. Wir haben trotzdem, wie vorher vereinbart, den Sprecher*innen des Camps Redezeit im Akademischen Senat eingeräumt, um ihre Forderungen darzustellen. Und natürlich wird die Kommunikation weitergehen.
Und zu den Narben oder Wunden, über die so schnell kein Gras wächst, gehören auch konkrete Gewaltdrohungen.
Viele Studierende sind sich nicht bewusst, dass Demonstrationen im Grundgesetz verankert und zulässig sind. Das Protestcamp vor der Universitätsbibliothek war eine polizeilich angemeldete und legitime Versammlung. Das haben wir selbstverständlich respektiert und sind nicht eingeschritten. Die Besetzung eines Hörsaals oder des Theaterhofs hingegen ist nicht genehmigt und nicht legal gewesen. Und wenn wir Sicherheit und Ordnung für die Mitglieder unserer Universität nicht mehr garantieren können, müssen wir die Polizei einschalten.
Wie können Sie den Protestierenden die Rechtslage verständlich machen und sicherstellen, dass der Dialog in geordneten Formaten stattfindet?
Zunächst: Wer wirklich mit uns sprechen will, muss das schon sagen. Instagram-Kacheln mit Forderungen haben wir zunächst nicht als Einladung zum Gespräch verstanden. Zu dem Protestcamp ist einer meiner Vizepräsident*innen dann persönlich hingegangen, um ins Gespräch zu kommen. Wir nehmen die Akteur*innen ernst und bemühen uns, in den Dialog zu gehen, auch wenn es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was als Einladung zum Dialog gilt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Themen und Formaten. Einige Anliegen der Protestierenden sind sehr spezifisch und erfordern eine nicht-öffentliche Diskussion, um die Vertraulichkeit zu wahren und die Situation nicht weiter zu eskalieren. Allgemeinpolitische Forderungen, die sich an die Bundesregierung oder nach Israel richten, brauchen wir nicht in einem öffentlichen Forum mit der Universitätsleitung behandeln, das ist der falsche Ort dafür.
Für wissenschaftliche und bildungspolitische Themen hingegen, wie israelische Politik, die Situation in Gaza oder Antisemitismus, organisieren wir spezielle Veranstaltungen und Vorlesungsreihen, um sicherzustellen, dass die Diskussion auf einem informierten und sachlichen Niveau stattfindet. Hierbei nutzen wir die Expertise innerhalb der Universität und führen Dialoge in geeigneten wissenschaftlichen Formaten.
Darüber hinaus sind wir uns bewusst, dass es Informationslücken geben kann. Zum Beispiel forderten einige Gruppen Stipendien für Flüchtlinge aus Gaza, ohne wirklich informiert zu sein, welche Unterstützungsmaßnahmen die Universität bereits anbietet. Solche Anliegen klären wir in gezielten Gesprächen, um Missverständnisse auszuräumen und passende Lösungen zu finden.
Welche Rolle spielt die institutionelle Kommunikation an der Universität und wie müssen Universitäten in solchen Situationen, bei Protesten oder auch bei medialen Angriffen, aufgestellt sein?
Zunächst: Als Universitätspräsident habe ich kein allgemeinpolitisches Mandat und deswegen gibt es Dinge, zu denen wir uns als Universitätsleitung nicht äußern. Dazu gehört die israelische Politik und auch die Kriegsführung in Gaza.
Das ist der eine Teil, der andere Teil ist die Frage, wie ich die Kommunikation der Universität aufstellen muss. Das ist eine komplexe Angelegenheit. Wir sehen, dass wir auf der einen Seite die kommunikativen Herausforderungen der letzten Monate gut gemeistert haben. Dazu gehört auch der Kampf mit einseitiger Kommunikation und Fake News. Wir stellen aber auch fest, dass wir noch schneller werden müssen. Wir müssen die konventionellen Medien, wie Presseanfragen von der dpa, und das, was über Instagram läuft, zusammenbringen. Das muss alles am Ende zusammenpassen, schnell und abgestimmt sein.
Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat gesagt, Hochschulen sind Orte maximaler Freiheit. Was meint sie damit?
Frau Stark-Watzinger twittert aus der Ferne, ohne Gefühl für die Lage vor Ort. Und das funktioniert einfach nicht. Davon sind wir alle enttäuscht. Auf dieser Informationsbasis sind solche Sätze einfach sehr hohl.
Von Prof. Klaus Ferdinand Gärditz, einem Rechtswissenschaftler aus Bonn, habe ich mir in einer Runde von Universitätspräsident*innen erläutern lassen, dass die Meinungsfreiheit oft eingeschränkt wird, wie man an den vielen Auflagen zum Demonstrationsrecht sieht. Die Wissenschaftsfreiheit hingegen ist ein fundamentales Grundrecht, das nicht einschränkbar oder aufhebbar ist. Dem stimme ich voll und ganz zu.
Was heißt das in der Praxis?
Wissenschaftler*innen kamen auf mich zu und fragten, was sie noch zitieren dürfen. Ich habe ihnen gesagt, dass man in der Wissenschaft alles zitieren darf. Die Wissenschaft ist frei. Auch Hitlers „Mein Kampf” kann man in der Universitätsbibliothek ausleihen. Wenn das die Grundlage von Forschungen ist, muss man daraus zitieren dürfen. Das gilt für alle anderen Quellen auch.
Es ist klar, dass die Frage, ob die Ereignisse in Gaza ein Genozid sind, gestellt werden darf und muss. Forschende müssen dazu Antworten bieten können, und dafür muss Freiraum bestehen. Dasselbe gilt für die Frage, ob die Zustände auf der Westbank Apartheid darstellen. Auch kontroverse und unzulässige Äußerungen auf Demos müssen wissenschaftlich untersucht werden können.
Ebenso muss man diskutieren können, wie „From the river to the sea” zu interpretieren ist. Ist das antisemitisch? Ist das eine Gewaltandrohung? Wir haben auch Anzeige erstattet, weil auf Plakaten in der Mensa „From the river to the sea” stand, mit der Silhouette von Israel und einer Palästina-Fahne darüber. Wir haben das als Aufruf zur Gewalt gewertet. Gerichte haben es anders gesehen. Ob der Slogan als antisemitisch oder Gewaltaufruf einzustufen ist, kann in einem Rechtsstaat geklärt werden.
Wie frei ist eigentlich eine Universität in der Wahl der Forschungsfragen, denen sie sich widmet?
Ich halte das für einen schwierigen Bereich, den man thematisieren muss und zu dem es auch Papiere vom Wissenschaftsrat gibt. Wissenschaftsfreiheit ist nicht begrenzt, aber daraus lässt sich nicht das Recht ableiten, dass alle Wissenschaft automatisch gefördert wird. Für mich ist daraus ableitbar, dass zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als Selbstverwaltungsorganisation der deutschen Wissenschaft in ihren Förderausschreibungen das gesamte Spektrum wissenschaftlicher Themen abdecken muss.
Das bedeutet, dass sie Qualitätskriterien anlegen muss, aber natürlich auch begrenzte Mittel hat. Wenn ich jetzt ein Experimentalphysik-Projekt anbiete, das 5 Milliarden Euro kostet, habe ich nicht aufgrund der Wissenschaftsfreiheit das Recht, dass es von der DFG oder vom BMBF gefördert wird. Da sieht man die offensichtlichen Limitationen. 
Wenn es gezielte Ausschreibungen zu bestimmten Themen vom BMBF gibt, muss man das in Ruhe anschauen. Es ist legitim, dass das Ministerium sagt, Forschung in einem bestimmten Bereich sei besonders wichtig und von Interesse, und deswegen gibt es dort zusätzliche Fördermöglichkeiten. Umgekehrt zu sagen, in diesem Bereich sei Forschung nicht erwünscht und dürfe nicht gefördert werden, wäre nicht legitim. Ebenso wenig wäre es legitim, wenn gesagt würde, diese Wissenschaftler*innen haben Äußerungen getätigt, die mir nicht gefallen, und deswegen wird deren Forschung nicht gefördert. Da befinden wir uns sicher außerhalb von Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Das ist ja die aktuelle Debatte um Stark-Watzinger, Döring und Philippi.
Die Universität ist ein Ort, an dem eine Vielzahl von Studierenden und Lehrenden zusammenkommt. Vielfalt klingt immer so einfach, aber wie kann man sie ermöglichen und tatsächlich leben?
Also erstens: Das ist unsere Agenda, und das ist sehr, sehr wichtig. Eine Universität kann nur dann ein freier Ort der Wissenschaft und Forschung sein, wenn sie auch die volle Vielfalt ermöglicht. Zweitens tauchen Forderungen auf, wie zum Beispiel die, dass wir die Sicherheit von jüdischen Studierenden garantieren müssen. Es gibt auch Forderungen, dass wir sicherstellen müssen, dass sich alle sicher fühlen. Das sind Erwartungen, die absolut verständlich sind, die wir aber auch besprechen müssen.
Natürlich wollen wir keine Zugangskontrollen für den Campus, wir wollen nicht weiträumig Überwachungskameras installieren, und wir können und wollen auch keine Campuspolizei. Unser universitärer Wach- und Pförtnerdienst hat nur eine unterstützende Funktion im Bereich der Sicherheit und des Objektschutzes. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besitzen keine hoheitlichen Befugnisse, die mit denen der Polizei vergleichbar wären. In Konfliktsituationen müssen die zuständigen Behörden, wie die Polizei, von außen hinzugezogen werden.
Die Diskussion um Diversität an Hochschulen umfasst nicht nur die Sicherheit aller Studierenden, sondern auch die Möglichkeit, ihre Identität offen auszudrücken. Jüdische Studierende sollten sich mit Symbolen wie dem Davidstern oder der Kippa wohlfühlen können, während palästinensische Studierende das Recht haben, eine Kufiya zu tragen, ohne deshalb unter Verdacht der Gewalt zu stehen. Hier entsteht ein Konflikt: Wenn jüdische Studierende die Kufiya als Bedrohung empfinden, während palästinensische Studierende sie als Ausdruck ihrer Identität sehen, führt dies zu Spannungen.
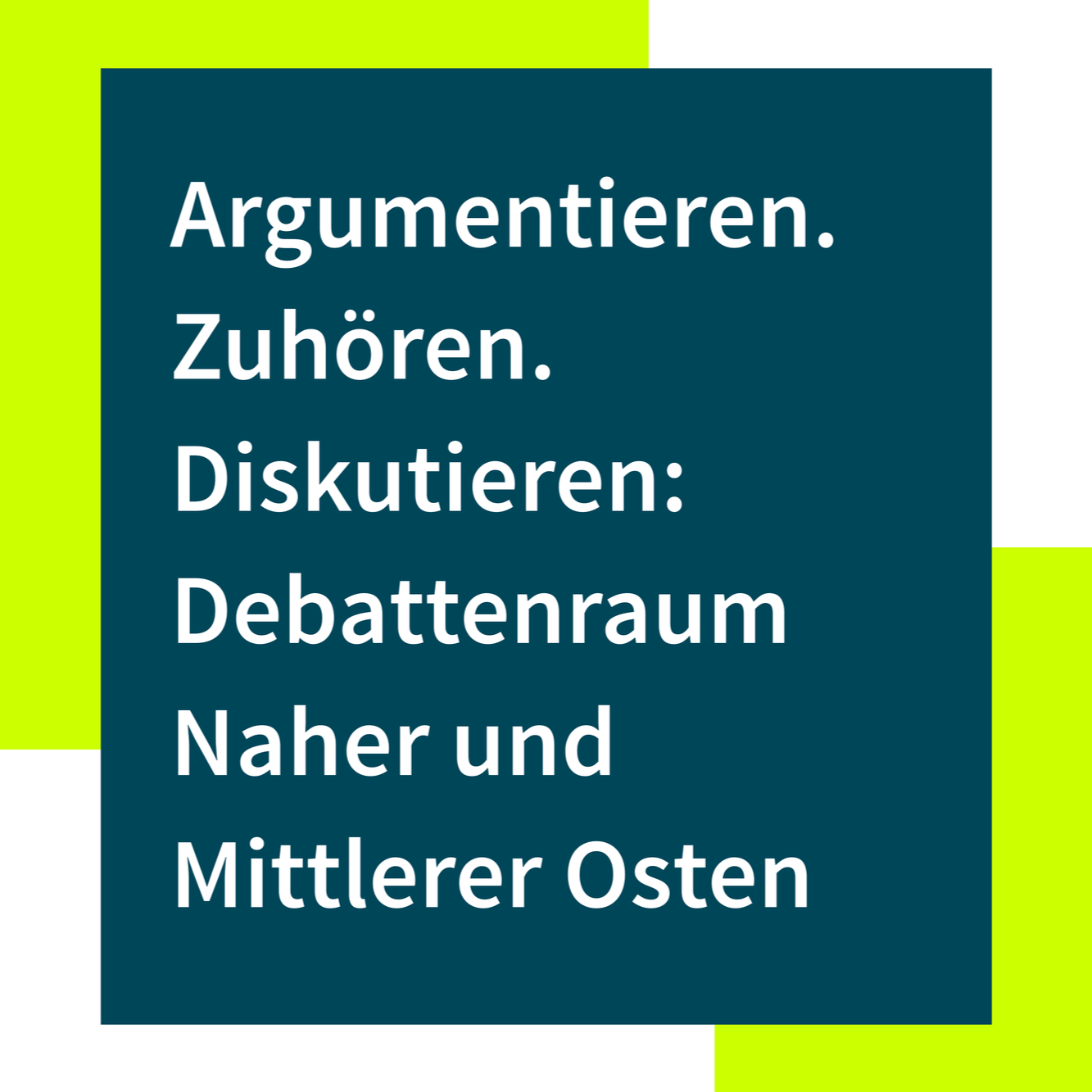
Unsere Antwort ist nicht, dass wir die Studierenden trennen und Wachschutz dazwischen stellen. Um ein inklusives Umfeld zu schaffen, ist es entscheidend, solche Differenzen offen zu diskutieren und Lösungen zu finden, die die Identität und Sicherheit aller Studierenden respektieren. Wir müssen Standards definieren, wie wir die Freie Universität als offenen und angstfreien Raum auf Augenhöhe für alle gestalten. Dies erfordert ein gemeinsames Verständnis und eine klare Kommunikation über die verschiedenen Perspektiven und deren Bedeutung. In einem diversitätsbewussten Umfeld sollten alle Mitglieder der Hochschulgemeinschaft die Möglichkeit haben, ihre kulturellen und religiösen Identitäten ohne Angst vor Diskriminierung oder Gewalt auszudrücken.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Diversität an der Freien Universität ist die LGBTQ+-Community. Hier ist das Thema sehr präsent, und als schwuler Präsident gehört das zur Normalität. Es gibt Netzwerke an der Universität, die Safe Spaces organisieren und klarstellen, dass Diversität nicht nur willkommen ist, sondern ein Teil der Kultur.
In einer E-Mail der Universitätsleitung vom 5. Dezember 2023 noch vor der ersten, später polizeilich geräumten Hörsaalbesetzung am 14. Dezember wurden Standards für den offenen Umgang miteinander auf dem Campus und entsprechende rote Linien definiert. Die Hoffnung war, dass diese Standards dazu beitragen, einen offenen Raum für alle zu schaffen. Natürlich kann das auch zu Spannungen führen. Doch um Vielfalt zu gewährleisten, müssen alle Seiten zu Zugeständnissen bereit sein. Es ist eine Herausforderung, einen Raum zu schaffen, der die unterschiedlichen Perspektiven respektiert und gleichzeitig Sicherheit und Wohlbefinden für alle Mitglieder der Hochschulgemeinschaft fördert. Das ist unser Ziel. Daran möchten wir gemeinsam arbeiten.





