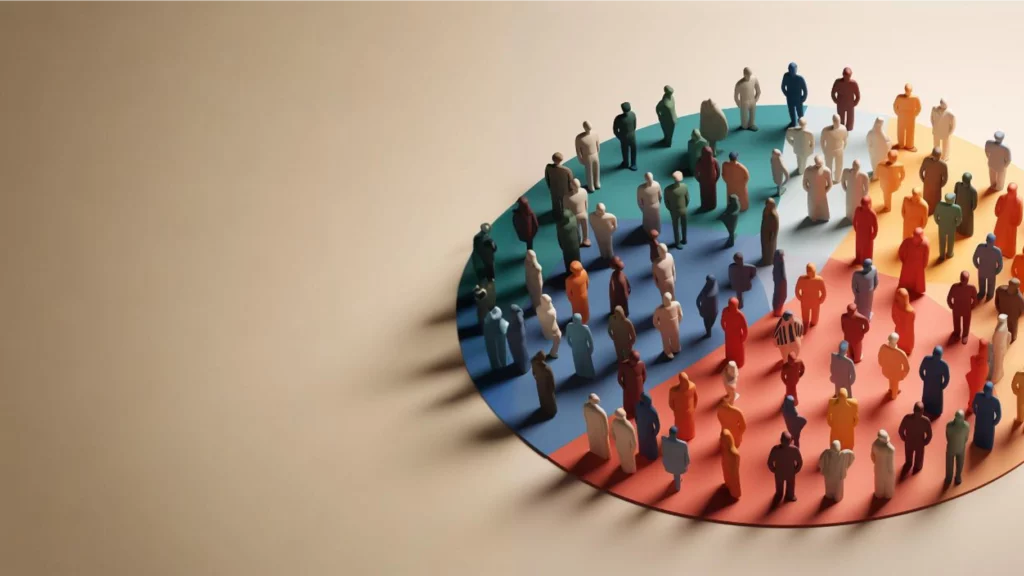Citizen Science erlebt derzeit in Deutschland einen echten Aufstieg. Johannes Vogel ist Leiter des Museums für Naturkunde Berlin und einer der Wegbereiter für Citizen Science in Deutschland. Ein Gespräch über Hintergründe, Zukunftsvisionen und das Wissenschaftssystem in Deutschland.
„Wir müssen die Bevölkerung aktiv an Wissenschaft beteiligen!“
Herr Vogel, weshalb interessieren Sie sich für Citizen Science?
Ich habe einen Großteil von dem, was mich an Natur begeistert und was mich dann auch zu meinem Beruf geführt hat, in einem Amateurverein gelernt, dem Naturwissenschaftlichen Verein in Bielefeld. Dort habe ich als Jugendlicher meine Mentoren gefunden, als ich begonnen habe, mich für die Pflanzenwelt zu interessieren. Das hat mich damals sehr beeindruckt und ich bin bis heute Mitglied des Vereins. Es hat mich nachhaltig geprägt zu sehen, dass Menschen mit und aus Leidenschaft hervorragende Wissenschaft machen können – ganz egal ob sie dafür ausgebildet sind oder nicht.
In Deutschland erlebt das Thema Citizen Science eine Art Hype. Hat sich das verändert und wie stehen wir im internationalen Vergleich da?

Ich habe natürlich vor allem einen guten Überblick im Bereich der Naturkunde. Da gab es immer schon immer viele Menschen, die sich ehrenamtlich auf Hobby- oder Amateurbasis mit der Erkundung der Natur beschäftigt haben. Es gibt aber derzeit eine neue Öffentlichkeit dafür und Leute können inzwischen einfacher sagen: Ich interessiere mich für Naturkunde. Wir haben den Rahmen verschoben und das Image aufgebessert.
Ein schönes Beispiel für diese Entwicklung ist das Projekt Bürger Schaffen Wissen von Wissenschaft im Dialog und uns hier im Museum für Naturkunde Berlin. Diese Webseite zeigt, wie vielfältig die Palette an Projekten inzwischen ist und das ist ein tolles Zeichen. Diese Projekte haben gemein, dass sie eine wissenschaftliche Fragestellung haben und Spaß an der Wissenschaft vermitteln – das finde ich toll.
Nützen Citizen Science Projekte denn der Wissenschaft?
Für mich ist ganz wichtig, dass immer breitere Teile der Bevölkerung nicht nur den Prozess von Wissenschaft verstehen, sondern auch aktiv daran teilhaben. In einer demokratischen Gesellschaft muss das zum guten Ton gehören, weil immer mehr politische Entscheidung auf wissenschaftlichen Grundlagen basieren. Dazu muss man die Prozesse dahinter verstehen. Wie die Wissenschaft sowas schafft, ist eine sehr offene Frage und da kann die Wissenschaft von dem Engagement von Amateuren lernen. Deswegen liegt mir die Förderung dieser Bereiche am Herzen. Für mich ist dabei sekundär, ob die Wissenschaft am Ende von konkreten Ergebnissen profitiert.
Braucht es einen bestimmten Typus Wissenschaftler um solche Projekte umzusetzen?
Das große Ziel muss doch sein, ein neues Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft herzustellen. Die Bringschuld dafür liegt meiner Meinung nach bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Alle Umfragen die ich kenne, zeigen ein großes und oder steigendes Interesse an Wissenschaft in der Bevölkerung. Gleichzeitig wächst aber auch die Skepsis an wissenschaftlichen Ergebnissen. Deshalb müssen wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unser Verhalten ändern. Wir müssen die Zeit dafür erhalten mit der Bevölkerung zusammenarbeiten zu können, wir müssen eine neue Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausbilden und diese brauchen dann Unterstützung und Raum. Wir brauchen dafür einen Systemwandel und an genau diesem arbeitet derzeit die Europäische Union.
Was genau tut die EU denn?
Die Open Science Policy Platform, der ich vorsitze, ist genau dafür da, mit etablierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu diskutieren und so das Wissenschaftssystem und die Wissenschaftsakteure in ihrer großen Dynamik und Vielfalt auf die anstehenden Veränderungen vorzubereiten. Hier geht es darum, den besten Weg zu finden und gemeinsame Politikempfehlungen für die EU zu erarbeiten. Greifen werden diese dann ab 2020.
Gibt es denn ein Interesse von jungen Wissenschaftlern, sich für das Thema zu öffnen?
Ich sehe da grundsätzlich ein großes Interesse. Vor allem kleine und mittelgroße Länder, wie Finnland und Estland, sind sehr interessiert an solchen systemischen Veränderungen und sehen die Chancen – natürlich auch für einen europäischen Arbeitsmarkt. Andere Länder, wie etwa Deutschland, tun sich damit noch etwas schwerer.
Hängt Deutschland also zurück?
Ich finde, Deutschland ist ein sehr interessanter Fall. Ich sehe auch hier viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Lust haben, etwas zu verändern und sie sind die Führungskräfte der Zukunft. In Deutschland geht es vielleicht langsamer als in anderen Ländern, aber der Wandel wird dafür auch nachhaltiger werden.
Durch die Wahl von Donald Trump und das Aufkommen von Fake News ist die Wissenschaftskommunikation zuletzt in den Fokus gerückt. Beobachten sie dadurch einen Wandel?
Ich glaube es ist ein gutes Wachrütteln. Die Idee, dass Wissenschaft frei zu sein hat, hat dazu geführt, dass man sich lange sehr sicher war und es ausreichte, nur innerhalb des Systems zu kommunizieren. Die Entwicklungen in den USA, in Ungarn oder in Polen zeigen aber, dass das nicht ausreicht und wir die Diversität, von der die Wissenschaft lebt, leben und einfordern müssen. Der Vorteil von Diversität muss von uns sowohl im Denken als auch im Handeln herausgehoben und besser erklärt werden. Wir dürfen uns da nicht in eine Opferrolle begeben. Wenn wir es nicht hinbekommen, wird es uns langfristig unsere Freiheit kosten.
Müssen Wissenschaftler folglich gleichberechtigt Wissenschaft und Kommunikation betreiben?
Ich würde niemandem empfehlen, sich nur auf die Kommunikation von Wissenschaft zu konzentrieren. Man braucht auch eine solide wissenschaftliche Basis. Ich halte es aber für absolut sinnvoll, sich in diesem Bereich weiterzubilden. So habe ich es auch gemacht und ich glaube, es hat meiner wissenschaftlichen Karriere nie geschadet, mich im Kommunikationsbereich zu engagieren und offen zu kommunizieren. Natürlich gibt es auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen es nicht liegt, aber aus meiner Sicht sind es Ausnahmen. Denn wenn man Wissenschaft aus Leidenschaft betreibt, ist man als Kommunikator natürlich gut geeignet.
Wie läuft die Kommunikation denn bei Ihnen im Museum?
An einem Forschungsmuseum wie dem Museum für Naturkunde in Berlin muss die Verbindung zwischen exzellenter Forschung und innovativer Kommunikation gelingen. Ein Großteil unserer wissenschaftsbasierten Kommunikation wird deshalb von unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern getragen und die machen aus meiner Sicht einen tollen Job.