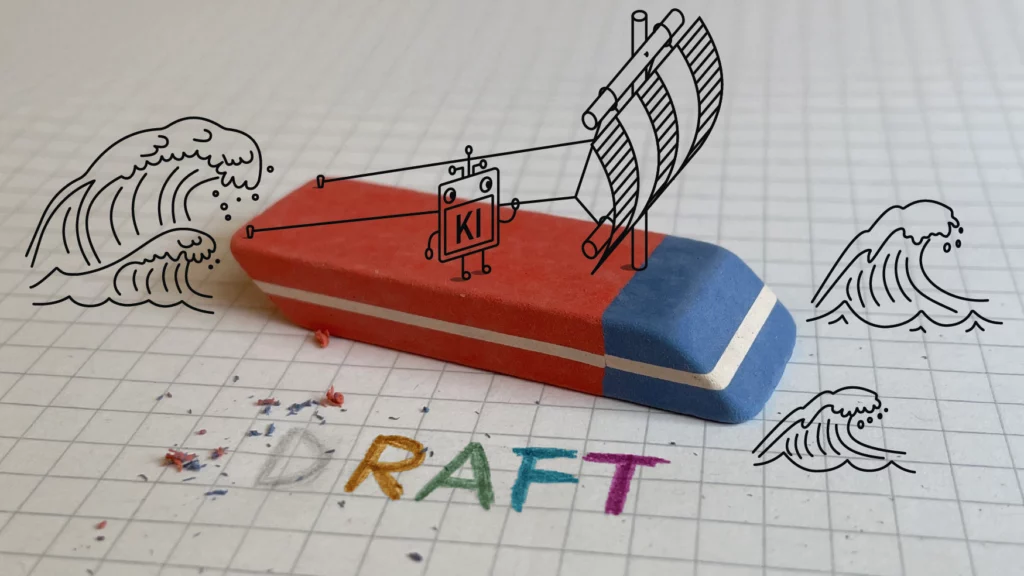Jan Philipp Rudloff erklärt psychologische Phänomene am liebsten in kurzen Videos auf Instagram. Wie es ihm gelang, seine Reichweite zu vergrößern und warum er es schade findet, wenn sich Wissenschaftler*innen von Humor abgrenzen, verrät der Psychologe im Interview.
„Es ist kein Widerspruch, seriöse Inhalte unterhaltsam zu verpacken“
Auf Ihrem Instagram-Kanal erklären Sie in kurzen Videos Fachbegriffe und Forschungsergebnisse aus der Psychologie. Wie ist die Idee entstanden?
Nach dem Studium hatte ich bei InMind, einem Online-Magazin für Psychologie, zum ersten Mal die Möglichkeit, Medienpraxis und Wissenschaft zu verbinden. Für das Magazin habe ich Interviews geführt und Videos gedreht.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich wollte nicht immer nur die Fragen stellen, sondern auch selbst vor der Kamera stehen. Instagram hat sich dafür angeboten. Außerdem benutze ich die Plattform selbst gerne. Ich bin aber mittlerweile auch bei TikTok. Diese ganzen textbasierten Plattformen, wie Twitter (X) haben mich nie gecatcht.

Foto: Leon Becker
Sie sagen auf Ihrer Website, dass alle Forschung der Welt nichts nützt, wenn sie nicht so kommuniziert wird, dass sie jeder versteht. Sehen Sie in der Wissenschaftskommunikation eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft?
Ja, ich finde jeder sollte die Chance bekommen zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Wenn es uns gelingt, komplizierte Themen einfacher zu erklären, hilft das auch gegen Wissenschaftsskepsis.
Man sagt schnell, Wissenschaft ist schwer zu erklären, weil die Themen zu kompliziert sind. Das ist sicher in vielen Bereichen auch noch schwieriger als in der Psychologie, weil wir ja alle jeden Tag denken und fühlen. Aber es lohnt sich immer, darüber nachzudenken, ob es nicht doch noch ein einfacheres Wort gibt oder ob man den Satz nicht etwas einfacher formulieren könnte. Ich finde es arrogant zu glauben, dass jeder Fachbegriffe versteht. Ich beobachte mich auch ständig selbst, um nicht wieder in die Fachsprache zu verfallen.
Was hilft Ihnen sonst noch dabei, Inhalte möglichst einfach zu erklären?
Ich versuche mir immer wieder vorzustellen, wie es wäre, wenn ich mich nicht so sehr für Wissenschaft interessieren würde und wenn ich einen anderen Background hätte. Meine Eltern sind beide in der Forschung, ich bin damit aufgewachsen, dass am Küchentisch über Wissenschaft gesprochen wurde. Aber ich habe früh gemerkt, dass die Leute um mich herum damit nicht so vertraut sind.
In meinen Videos versuche ich immer eine Überschneidung zu finden mit dem was Leute im Alltag erleben, einen Aufhänger, damit die Leute sagen: „Ah ja, das kenne ich“. Ich habe zum Beispiel ein Video zur Aufmerksamkeitsspanne gemacht, indem steige ich damit ein, dass ich kaum noch Filme gucken kann, ohne mein Handy in der Hand zu haben.
Und ich versuche Humor reinzubringen.
Ich habe oft das Gefühl, dass Wissenschaftskommunikation zu ernst ist und die Inhalte viel zu anspruchsvoll. Ich finde es schade, wenn Wissenschaftler*innen versuchen, sich von Humor abzugrenzen. Nach dem Motto: „Ich bin seriös, also spreche ich hochgestochen“. Das erreicht die Leute nicht. Ich finde, es ist kein Widerspruch, seriöse Inhalte unterhaltsam zu verpacken.
Für mich ist das schönste Feedback, wenn mir jemand, der nichts mit Wissenschaft zu tun hat, sagt, dass er oder sie meine Erklärungen verstanden hat und sich im besten Fall noch gut unterhalten gefühlt hat.
Sie haben eine große Fangemeinde auf Instagram. Wie haben Sie die aufgebaut?
Am Anfang habe ich ziemlich aufwendige Videos gemacht, mit einem kleinen Intro oder einem kleinen Sketch am Anfang, die ich einmal die Woche gepostet habe. Das hatte nicht so viel Erfolg. In einem halben Jahr sind nur etwa 150 Follower dazugekommen. Das war mir nicht genug. Wenn ich schon so viel Zeit in die Videos investiere, dann muss es sich auch lohnen. Ich hatte damals schon vor, Wissenschaftskommunikation zu meinem Beruf zu machen. Daher wollte ich, dass der Account besser läuft.
Was haben Sie dann geändert?
Statt eines langen Videos pro Woche habe ich drei kurze gemacht. Ich brauchte zwar mehr Themen, aber der Aufwand war genauso groß wie für ein langes Video.
Außerdem habe ich die Sketche am Anfang der Videos weggelassen. Ich habe sie zwar gerne gemacht, aber sie waren sehr aufwendig. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass sie irreführend waren. Die Leute erwarten dann ein Comedy-Video, aber dafür war es nicht lustig genug und dann geht es plötzlich um Wissenschaft. Bei Social Media ist es ungünstig, wenn die Leute nicht von Anfang an wissen, worum es geht. Da ist man nur eine kleine Kachel, die durch den Feed rast. Es muss von Anfang an klar sein, was die Leute erwartet.
Deshalb habe ich am Anfang nur gesagt: Ich bin Jan. Ich bin Psychologe und jetzt kommt ein kleiner „Psychologie-Snack“, damit die Videos einen Wiedererkennungswert haben.
Die Kombination aus dem neuen Intro und dreimal pro Woche posten hat dazu geführt, dass die Followerzahl innerhalb eines Jahres plötzlich sprunghaft auf über 17.000 angestiegen ist.
Haben Sie ein Lieblingsvideo von sich?
Ja, ich mag das Video „Denken in Kategorien“. Darin erkläre ich, dass wir in Kategorien denken, um die Welt zu ordnen: Baum, Balkon, Zimmer, Pflanze. Und das tun wir auch mit Menschen.
Aber diese Kategorien sind ziemlich willkürlich und das kann man leicht zeigen. Geschlecht ist zum Beispiel so eine Kategorie. Nicht das biologische Geschlecht, sondern die Geschlechtsidentität, also wie man sich selbst sieht.
Für mich macht es wenig Sinn, nur die Kategorien Männer und Frauen zu haben, wenn die Menschen innerhalb dieser Kategorien so unterschiedlich sind. Das Video war ziemlich aufwendig, weil ich mich dafür geschminkt habe, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bekommen Sie viele Hasskommentare?
Auf Instagram weniger, bei YouTube bekomme ich regelmäßig negative Kommentare.
Vor allem während der Pandemie habe ich mich relativ viel öffentlich geäußert, weil ich damals zu Verschwörungstheorien geforscht habe. Da habe ich einige Mails bekommen, in denen ich beleidigt oder mir gedroht wurde.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe nicht geantwortet, weil ich das Gefühl hatte, dass die Person nicht wirklich mit mir reden will. Mir hat es geholfen, mit Freunden drüber zu sprechen.
Bei dem Thema Verschwörungstheorien, habe ich mich selbst gefragt, ob ich damit so stark in Verbindung gebracht werden möchte. Ich hatte das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt ohnehin nicht vorhatte, weiter daran zu forschen, sondern stattdessen in den Journalismus wechseln wollte. Wenn Forscher*innen ein Thema wie Verschwörungstheorien persönlich sehr wichtig ist und sie sich deshalb immer wieder mit Anfeindungen auseinandersetzen müssen, kann das echt schwer sein. Aber Wissenschaftler*innen sollten sich natürlich nicht aufgrund von Anfeindungen die Frage stellen müssen, ob sie an einem Thema forschen möchten oder nicht.
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Instagram macht mir viel Spaß, aber manchmal ist es auch etwas einsam, weil ich es größtenteils alleine mache. Mein Wunsch wäre es, mehr mit anderen zusammenzuarbeiten und einen Podcast oder eine Sendung zu moderieren. Und da ist tatsächlich auch was geplant und ich kann bald mehr dazu verraten.
* Das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) ist einer der drei Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de