In der Gesundheitsdigitalisierung werden Frauen systematisch benachteiligt. Die Initiative #SheHealth möchte dem entgegenwirken. Im Interview spricht Sylvia Thun, Mitgründerin der Initiative, über Wissenschaftskommunikation und die Risiken des technischen Fortschritts.
„Nachdem wir so lange für unsere Rechte gekämpft haben, sind wir plötzlich wieder unsichtbar“

Frau Thun, die Initiative #SheHealth möchte Frauen in der Gesundheitsdigitalisierung vernetzen und sichtbar machen. Inwiefern kann sich geschlechtsbasierte Diskriminierung durch Digitalisierung weiter verstärken?
Seit sieben Jahren gibt es die Initiative #SheHealth. Wir haben jedes Jahr verschiedene Leitsätze und einer davon war, dass wir der Diskriminierung in den Gesundheitsdaten entgegenwirken wollen. Die Diskriminierung gibt es zum Beispiel, weil wir bei klinischen Studien zu wenig Frauen einschließen. Bis 1994 wurden dafür extrem wenige Frauen zugelassen. Und die meisten Medikamente, die jetzt eingenommen werden, sind ältere Medikamente.
Das heißt, wir haben jetzt schon die Situation, dass die Daten, mit denen wir arbeiten, eine Diskriminierung gespeichert haben. Die Dosierung ist für den weiblichen Körper nicht adäquat, weil unsere Organe anders arbeiten, die Hormone anders wirken und nun durch Algorithmen das Problem potenziert wird. Auch wenn es so klingt, als wären die Algorithmen intelligent, suchen sie nur nach Ähnlichkeiten. Und wenn ich nach Ähnlichkeiten mit vorhandenen Daten suche, dann bleibe ich bei den diskriminierenden Schlussfolgerungen, die dann passieren, wenn wir mit vorwiegend männlichen Daten arbeiten.
Kann andererseits der technologische Fortschritt dazu beitragen, die Vernachlässigung von Frauen und weiblich gelesenen Personen in der Medizin auszugleichen?
Ja, sofern die Forscher*innen in der Analyse der Daten und auch in der Erhebung geschult sind. Wenn ich bereits bei der Datenerhebung sowohl Männer als auch Frauen einbeziehe, sorgfältig die Dosierung wähle und auch bei der Analyse und Weitergabe darauf achte, kann es trotzdem vorkommen, dass irgendwo in der Datenverarbeitung ein Fehler passiert. Es besteht die Gefahr, dass im Laufe der Jahre, in denen die Daten erhoben, aufbereitet und analysiert werden, die Zuordnung von männlich und weiblich verloren geht. Deshalb ist es wichtig, dass wir mehr gut geschulte Wissenschaftler*innen haben, insbesondere auch Mediziner*innen und Datenwissenschaftler*innen, die dafür sensibilisiert werden.
Sie setzen sich auf vielfältige Weise für bessere Kommunikationsstandards im Gesundheitswesen ein. Dabei geht es vor allem um die Vergleichbarkeit von Daten. Für Ihr Engagement haben Sie sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Wie sehen Sie den Stand der Digitalisierung in Deutschland im internationalen Vergleich?
Wir haben das mit dem DigitalRadar für Krankenhäuser gemessen. Demzufolge befinden wir uns im unteren Mittelfeld. Natürlich gibt es Raum für Verbesserungen. Bereiche, in denen wir besonders schlecht abschneiden, sind die Kommunikation mit den Patient*innen sowie die Patientenakte. Hier müssen wir aufholen. Was den Datenschutz und die Datensicherheit betrifft, sind wir jedoch weltweit führend, und das wurde auch durch die Daten des Krankenhausradars bestätigt. In einigen Bereichen sind wir extrem gut und sehr schnell, während wir in anderen messbaren Bereichen oder in denen, die von bestimmten Studien in Auftrag gegeben wurden, schlecht abschneiden. Die Unternehmen, die solche Studien durchführen, haben natürlich auch ihre eigenen Interessen.
Sie treten als Referentin zu sehr komplexen und potenziell kontroversen Themen auf. Was ist Ihr Erfolgsrezept in der Wissenschaftskommunikation?
Ich habe keine speziellen Kurse oder Influencer-Fortbildungen absolviert, sondern mein Wissen basiert rein auf Fakten und meinem Gefühl. In den sozialen Medien konnte ich auch für eher uninteressante Themen wie die Standardisierung im Gesundheitswesen viele Follower*innen gewinnen, indem ich die Themen ansprechend und einfach präsentiert habe. Es ist jedoch wichtig, dass wir uns auch trauen, komplexe neue Themen anzusprechen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Ein Beispiel dafür ist der FHIR-Standard – Fast Healthcare Interoperability Resources, ausgesprochen wie englisch „fire“ – der hochkomplex ist, aber mittlerweile kennen ihn sogar Politiker*innen. Dieser Standard unterstützt den Datenaustausch zwischen Softwaresystemen im Gesundheitswesen.
Warum ist die Wissenschaftskommunikation zur Gesundheitsdigitalisierung so wichtig?
Bei uns geht es um Patient*innen, Krankheit und Gesundheit, daher ist das immer emotional und betrifft jeden. Wissenschaftler*innen haben in Deutschland die Möglichkeit, frei zu forschen und zu sagen, was sie als richtig erachten. Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Grundsätze in einem demokratischen Land: Dass wir weiterhin Missstände ansprechen dürfen, wenn etwas nicht richtig läuft. Als Forschende in der Medizin haben wir unsere evidenzbasierte Meinung und sollten auch ethisch beraten, aber wir müssen dennoch laut sagen dürfen: Hier wird gerade eine schlechte Entscheidung getroffen. Das ist das wichtigste Gut, nicht nur für Journalist*innen, sondern auch für Expert*innen.
Wie kam es dazu, dass sie sich für die Gleichstellung der Geschlechter in der Digitalisierung der Gesundheitsbranche einsetzten?
Das war vor sieben Jahren auf einer Fachmesse, als Christiane Groß und ich nebeneinander in Sessions zur digitalen Gesundheit saßen. Sie ist mittlerweile Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Wir waren die einzigen Frauen in der Messehalle, schauten uns an und fragten uns: „Was ist hier eigentlich los?“. Da entstand die Idee für #SheHealth. Vorher war mir gar nicht bewusst, dass ich ausschließlich mit Männern zusammenarbeitete.
Das wird zum Problem, wenn die Gesellschaft nur Männer zulässt und Männer sich selbst wieder in Führungspositionen bringen. Das ist insbesondere problematisch, da die Digitalisierung genau das abbildet.
Auf welche Erfolge der Initiative blicken Sie zurück?
Ein großer Erfolg ist die Zusammenarbeit von über 860 weiblichen Expertinnen, die sich virtuell auf einer LinkedIn-Plattform zusammengeschlossen haben und sich zwei- bis dreimal im Jahr treffen. Kürzlich haben wir uns auf einer Fachmesse für digitale Gesundheit getroffen, wo es einen großen Andrang gab. Ich denke, der größte Erfolg liegt in der Sichtbarkeit der Frauen. Es muss immer wieder gesagt werden: Hier sind genug Frauen, die auf ein Podium und in Führungspositionen gebracht werden können und exzellente Beiträge liefern.
Wir haben das Thema Künstliche Intelligenz und Geschlechtergerechtigkeit ins Leben gerufen und sichtbar gemacht. Vor fünf Jahren gab es kaum Veröffentlichungen zu diesem Thema. Jetzt ist die Situation besser. Wir sind mehr geworden. Es ist auch wichtig, die Zusammenarbeit mit anderen Frauennetzwerken hervorzuheben, wie zum Beispiel den Spitzenfrauen Gesundheit. Sie haben viel dazu beigetragen, dass Krankenversicherungen gesetzliche Quoten für Frauen in Führungspositionen festgelegt haben. Je mehr Frauen in solchen Positionen sind, desto besser wird es auch in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit der Daten. Das korreliert direkt miteinander.
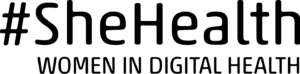
Welche weiteren Ziele verfolgt das Netzwerk?
Die Frage ist: Was braucht die nächste Generation? Sie braucht mehr Informationen über ihre Gesundheit und Krankheit, die möglicherweise über Apps mit der Patientenakte verknüpft werden können. Ein Beispiel dafür ist der Bereich der digitalen Gesundheitsapps, bei dem wir darauf geachtet haben, dass Geschlechtergerechtigkeit nachgewiesen werden muss. Doch ich glaube, dass wir noch viel zu tun haben.
Es gab Rückschritte nach der Zeit der Corona-Pandemie, die wir jetzt aufholen müssen, und die Sichtbarkeit der Frauen wieder betonen müssen. Man merkt deutlich, dass es wieder Podien gibt, die ausschließlich mit Männern besetzt sind. Was wir jetzt tun müssen, ist die Expertise der Frauen stärker hervorheben. Frauen sind die Hauptakteurinnen im Gesundheitswesen mit einem Anteil von 75 Prozent, und sie haben sehr gute Ideen, wie man bestehende Prozesse verbessern und digitalisieren kann.
Sollten sich die Frauen ändern oder das System?
Ich denke, wir brauchen beides. Wir müssen aufeinander zugehen. Frauen sollten mutiger werden und sich häufiger an Podiumsdiskussionen beteiligen und auf Führungspositionen bewerben. Wir müssen aber auch wachsam sein und darauf aufmerksam machen, wenn wieder nur ein Podium mit Männern besetzt wurde.

Und auch das System ändert sich. Zum Beispiel haben wir am Berlin Institute of Health neue flexible Arbeitszeitmodelle vorgestellt. Drei Tage Home-Office, und wenn man mehr benötigt aufgrund der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen, erhält man mehr. Man muss einfach neu denken. Frauen sind extrem wichtig in unserer Gesellschaft. Wenn wir die Gleichberechtigung im professionellen Kontext nicht hinbekommen, dann hat unsere Gesellschaft demnächst ein großes Problem mit dem Fachkräftemangel.







