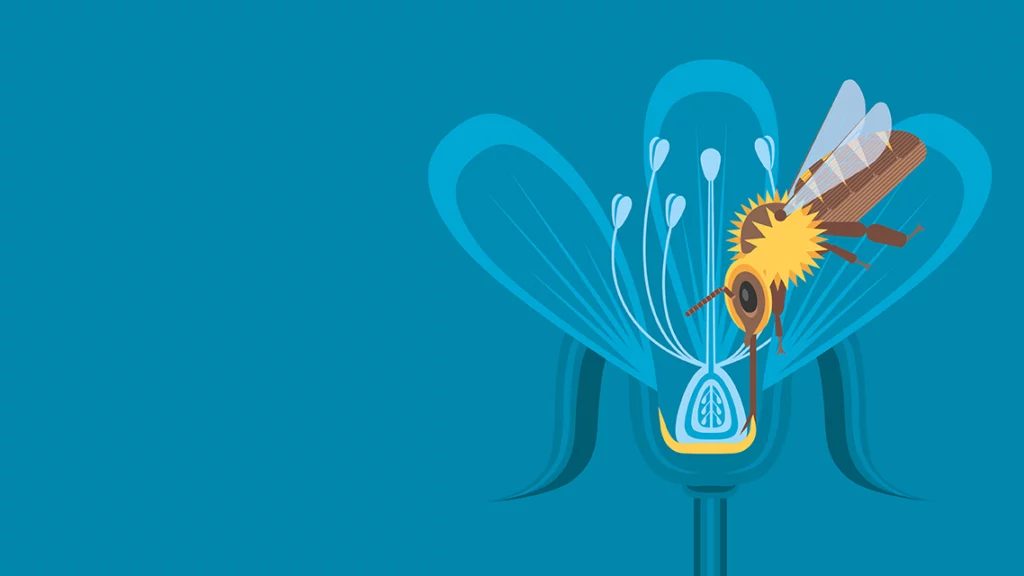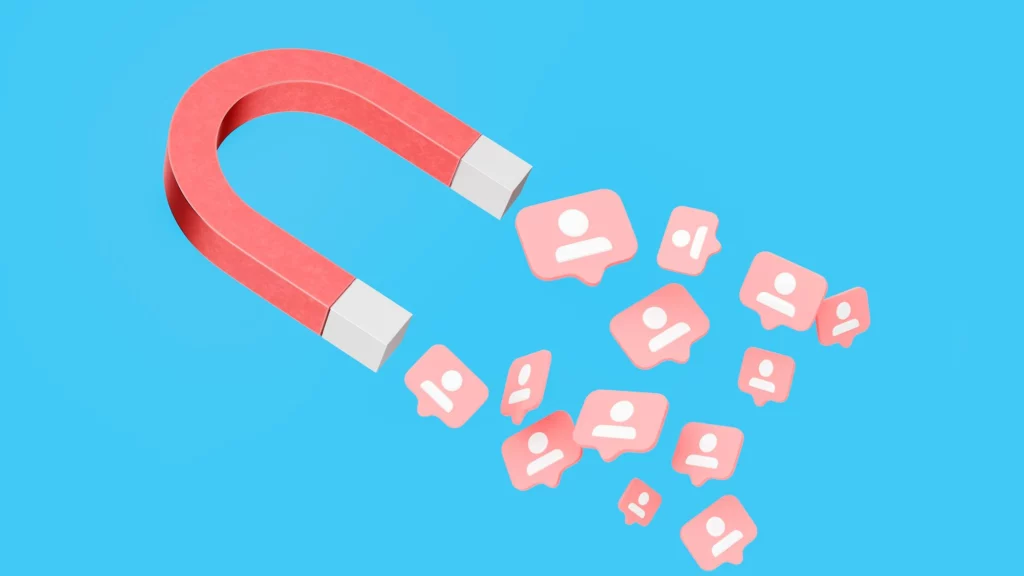Immer mehr Universitäten verankern Wissenschaftskommunikation auf der Leitungsebene. Welche neuen Rollen durch diese Stellen entstehen, welche strategischen Ziele Hochschulen damit verfolgen und wie sich das auf die Wissenschaftskommunikation auswirkt, erklären Jeanne Rubner und Elisabeth Hoffmann im Interview.
„Kommunikation sollte Teil des Prozesses sein und kein Add-On“
Ob Vice President Global Communication and Public Engagement oder Chief Communication Officer, in der Wissenschaftskommunikation an Hochschulen entstehen derzeit neue Stellen, die über denen eine*r Pressesprecher*in angesiedelt sind. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Elisabeth Hoffmann: Die Stellen an sich sind eigentlich nicht neu. Was sich tatsächlich geändert hat, ist eine Zugehörigkeit zur Hochschulleitung. Allerdings gibt es bereits seit ganz langer Zeit Kolleg*innen, die mit in den entsprechenden Rektoraten sitzen und dort sehr eng in die Entscheidungsprozesse involviert sind. Sie haben nicht unbedingt Stimmrechte, aber teilweise durchaus Einfluss auf die Entscheidungen und die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen. Insofern sind diese Stellen formell eine Neuentwicklung und auch ein wichtiger Schritt für eine Aufwertung der Wahrnehmung von Wissenschaftskommunikation, auch wenn der Schritt inhaltlich nicht so groß ist. Man merkt an der Aufwertung nach außen, dass das Thema Wissenschaftskommunikation in den Hochschulleitungen angekommen ist. Das zeigt sich auch daran, dass es derzeit immer mehr dieser Stellen gibt.

Jeanne Rubner: Ich erinnere mich gerade an eine Begebenheit, die über 20 Jahre her ist. Damals war ich im gerade neu gegründeten Hochschulrat einer Universität und habe dem Rektor empfohlen, seine Ein-Mann-Pressestelle aufzurüsten. Darauf sagte er, er wolle lieber Wissenschaftler*innen einstellen. Das war die klassische Situation an vielen Hochschulen vor 20 Jahren. Da hat sich einiges entwickelt. Der Bereich Wissenschaftskommunikation hat sich professionalisiert. Weil dazu noch das politische Interesse am Thema gestiegen ist, ist es in der Leitungsebene der Hochschulen angekommen. Wobei auch ich betonen möchte, dass der Pressesprecher der TUM schon seit längerem als Gast an den Präsidiumssitzungen teilnimmt.
Die Ausgestaltung der neuen Stellen ist durchaus unterschiedlich. Frau Rubner, wie ist sie bei Ihnen konzipiert?
Rubner: An der Technischen Universität München gibt es wie gesagt einen Pressesprecher, der das Presseteam leitet und der vor allem auch für den Auftritt des Präsidenten zuständig ist. Sein Team erledigt die ganz klassischen Aufgaben einer Pressestelle, also Pressemitteilungen schreiben oder den Kontakt zu Journalist*innen pflegen. Das PR-Team sowie das Web- und Social Media-Team bilden unser Corporate Communications Center, das ich leite. Das ist die eine Aufgabe. Die andere ist die der Vizepräsidentin Global Communication und Public Engagement – also in der Hochschulleitung Kommunikation und Marketing strategisch zu verantworten.
Hoffmann: An der Universität zu Köln sind wir ähnlich aufgestellt. Wir haben zwei Abteilungen: die Kommunikation, zu der die klassischen Aufgaben von Pressestellen gehören, und das Marketing. Die Onlinekommunikation ist bei uns verteilt auf beide Abteilungen. Es gibt auch bei uns operative und strategische Schnittmengen zwischen den Bereichen. Ich bin in den Rektoratssitzungen dabei, in denen strategische Themen besprochen werden. Anders als Frau Rubner bin ich aber kein stimmberechtigtes Mitglied der Hochschulleitung, also keine Vizepräsidentin. Für mich ist der wichtigste Punkt der Neuausrichtung, dass man als Kommunikationsleiterin von Anfang an in Prozesse eingebunden ist und dabei die kommunikative Sichtweise mitdenkt.
Frau Rubner, hätten Sie die Position ohne den Titel einer Vizepräsidentin übernommen? Wie wichtig ist der Titel für Sie?
Frau Hoffmann, verzichten Sie ganz freiwillig auf den Titel oder gibt es einen anderen Grund?
Hoffmann: Das stand bei uns nicht zur Debatte. Generell ist die Wahrnehmung einer Vizepräsident*in natürlich nochmal etwas anderes, und das kann die eigene Position und die eigenen Themen deutlich aufwerten. Das Dezernat, welches ich leite, ist bei uns Teil der Verwaltung, die hier allerdings viel mehr Wissenschaftsmanagement ist. Ich habe den Einfluss, den es braucht, um das Thema Kommunikation bei strategischen Entscheidungen mitgestalten zu können.
Weshalb ist das wichtig?
Hoffmann: Wir haben einen sehr breiten Blick über den Campus und ein Ohr bei den Menschen außerhalb der Universität. Wir können beispielsweise in inhaltliche Debatten die Wahrnehmungsebene einbringen und sagen, wie bestimmte Dinge außen wirken und ob sie als stimmig wahrgenommen werden.
Droht durch diese neue Entwicklung eine Zweiklassengesellschaft in der Hochschulkommunikation?
Rubner: Man muss sich da keine Illusionen machen. Es ist schlicht und ergreifend so, dass sich die besser ausgestatteten Universitäten es eher leisten können, solche Stellen einzurichten und Kommunikation strategischer zu gestalten. Ich denke schon, dass dadurch eine Klassengesellschaft entsteht, aber die gibt es auch in vielen anderen Bereichen und spätestens durch die Exzellenzinitiative hat man sich zu diesen Unterschieden auch sehr klar bekannt.
Hoffmann: Ich glaube auch, dass es eine solche Zweiklassengesellschaft schon länger gibt, und die Exzellenzinitiative hat diese nochmal zementiert. Es hängt aber auch schlicht mit der Größe der Universitäten zusammen. Ob ich als Kommunikator*in Einfluss habe, ist nochmal etwas anderes. Ich kann auch an kleinen Universitäten eine wesentliche und gestaltende Rolle spielen. Welche das ist, hängt auch von meiner Kompetenz, von Vertrauensverhältnissen und auch Geschick ab. Die Mitgestaltung sollte auch an kleinen Universitäten das Ziel der Kommunikationsverantwortlichen sein.
Ist es für die Wissenschaftskommunikation und den Wissenschaftsjournalismus schädlich, wenn die strategische und marketingorientierte Kommunikation an Hochschulen gestärkt wird – was Ihre Titel implizieren?
Hoffmann: Das kommt natürlich darauf an, was die Strategie ist. In den Bereichen, in denen wir uns hier bewegen, gehört die Kommunikation zum Selbstbild einer Universität. Das ist verhältnismäßig neu für Universitäten, die sich traditionell anhand ihrer Forschungsergebnisse messen lassen. Hier hat der Wettbewerb etwas Positives bewegt, denn die Universitäten nutzen die Möglichkeit, sich zusätzlich klare Profile in den Bereichen gute Lehre, Diversität, Nachhaltigkeit, Unternehmergeist oder Public Outreach zu erarbeiten.
Aber klar, die generelle Gefahr besteht, dass sich Universitäten durch zu starke Selbstvermarktung von ihrer Kernaufgabe entfernen. Es geht insgesamt darum, wie strategische Kommunikation ausgearbeitet wird. Dazu gehört eben auch, dafür zu sorgen, dass es nicht zu viel Selbstvermarktung ist, vor allem, dass wir glaubwürdig bleiben. Das sind Aushandlungsprozesse. Unsere Rolle kann sicherlich dabei helfen, die richtige Balance zu finden. Je früher wir als Kommunikation eingebunden sind, desto größer die Chance dazu.
Rubner: Die alte Debatte zwischen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschafts- bzw. Hochschul-PR lebt natürlich weiterhin. Es kommt aber sehr stark darauf an, was für PR wir machen. Wir alle kennen Beispiele von Universitäten, die schlechte Pressearbeit machen und Journalist*innen beispielsweise weiterhin mit wenig zielgerichteten Pressemitteilungen überschütten. Gute PR bedeutet immer auch, Inhalte einzuordnen und bestimmte Ergebnisse in einen Rahmen zu setzen. Universitäten sollten aus meiner Sicht ihre Rolle als gesellschaftliche Akteure stärker annehmen und in dieser Rolle auch stärker mit der Politik und der Gesellschaft in einen Dialog treten. Deshalb finde ich es sehr wichtig, gute Kommunikation zu stärken. Ich denke, dahin geht die Entwicklung.
Nun nehmen Sie beide in Ihren Rollen aktiv am Entscheidungsprozess teil, Frau Rubner, Sie stimmen sogar mit ab. Inwiefern ist es dann noch möglich, von außen darauf zu schauen?
Hoffmann: Ich selbst habe kein gutes Gefühl damit, auch stimmberechtigt zu sein. Vermutlich auch, weil ich sehr viel Ehrfurcht vor den Kernthemen habe, aber eben auch, weil ich die Außenperspektive nach innen transportieren muss. Mir persönlich fällt das leichter, wenn ich nicht mitbestimme. Ich kann dann besser kritisieren. Ich hatte also an dieser Stelle ein wenig ein Rollenproblem.
Rubner: Ich verstehe das Dilemma und das Rollenproblem. Formal bin ich auch nicht stimmberechtigt, allerdings fühle ich mich an den Entscheidungsprozessen ausreichend beteiligt, so dass ich Abstimmungen des Präsidiums erklären kann und im Zweifel auch verteidigen würde.
Hoffmann: Es kommt hier auch darauf an, wie es genau gehandhabt wird, wer die Personen sind, die die Rollen mit Leben füllen, und mit wem sie zusammenarbeiten. Hier gibt es große Unterschiede zwischen den Universitäten.
Es gibt für die neuen Positionen noch viel Gestaltungsspielraum. Wie sieht Ihre Rolle idealerweise aus?
Hoffmann: Eine ganz wichtige Voraussetzung ist es, zusammen mit der Hochschulleitung auszudifferenzieren und zu definieren, wie die Rollen und das Zusammenspiel funktionieren soll. Es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass Kommunikation Teil des Prozesses ist und kein Add-On und keine Kleinigkeit, die man am Ende beachten kann. Gedanken über die Außenwelt sollten Teil des strategischen Prozesses in der Wissenschaft werden, und dazu möchte ich einen Beitrag leisten.
Wie oft muss man sich mit anderen Leitungsmitgliedern streiten, um so eine Rolle gut auszuführen?
Hoffmann: Ich streite mich nicht, aber ich widerspreche natürlich ab und zu. Ich versuche dabei immer die unterschiedlichen Interessenlagen zu verstehen und die Leute dann abzuholen. Ein potenzieller Konfliktpunkt ist leitlinienkonforme Wissenschaftskommunikation, und wie offen und transparent man sein darf und kann. Da bin ich gespannt, wie sich dies entwickelt.
Rubner: Ein Beispiel, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es nicht ganz ohne Kontroverse abläuft, ist die Frage, wie stark man CEO beziehungsweise. präsidiale Kommunikation versus Corporate Kommunikation macht. Wir haben hier einen starken Präsidenten, der seine Rolle ausfüllen möchte und muss, auch medial. Eine Universität ist aber mehr als ein Präsident und ich denke, hier muss man die richtige Balance finden. Da könnte ich mir potenzielle Konflikte vorstellen.
Hoffmann: Das ist ein sehr wichtiger und spannender Aspekt und ein super aktuelles Thema. Der aktuelle Goldstandard ist eine sehr personalisierte und direkte Kommunikation der Rektor*innen und Präsident*innen der Hochschulen, und viele machen da einen tollen Job. Ich finde diese Entwicklung spannend und heikel zugleich. Auch hier können und sollten wir eine beratende Rolle einnehmen, denn derzeit werden Personen immer stärker zu einem Zweit- oder Dritt-Logo der Hochschulen.
Wir haben viel über mögliche Gefahren und Freiräume in der Ausgestaltung gesprochen. Was könnten die neuen Rollen denn idealerweise im Bereich der Wissenschaftskommunikation bewegen?
Was genau ist denn dann aus Ihrer Sicht gute Wissenschaftskommunikation, von der wir scheinbar mehr brauchen?
Rubner: Gute Wissenschaftskommunikation ist vor allem zielgruppengerichtete Wissenschaftskommunikation. Wir machen uns noch nicht ausreichend Gedanken darüber, wen wir wie und mit welchen Inhalten erreichen wollen. Darüber hinaus ist gute Wissenschaftskommunikation nicht nur getrieben davon, was die Universität macht – also den Forschungsergebnissen – sondern auch getrieben davon, was die Gesellschaft bewegt, was die relevantesten Themen für die Lösung großer gesellschaftlicher Probleme sind und was wir dazu beitragen.
Hoffmann: Zusätzlich dazu sollte gute Wissenschaftskommunikation auch sein, was gute Wissenschaft ist: selbstkritisch, transparent, vernetzt und offen. Der Begriff Open Science Communication passt hier aus meiner Sicht sehr gut, und den sollten wir mit Leben füllen.