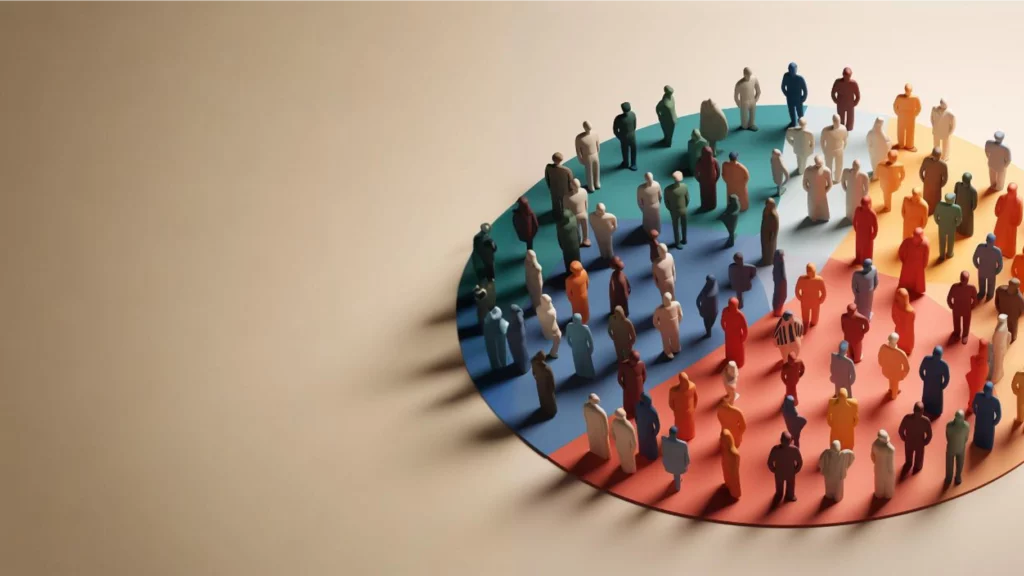Wie können in der Gesundheitskommunikation Angebote für spezifische Zielgruppen konzipiert werden? Omer Idrissa Ouedraogo ist Fachreferent der Deutschen Aidshilfe im Bereich Migration und spricht im Interview über die Rolle von Partizipation in der HIV-Prävention.
„Gesundheit ist kein Privileg, sondern ein Menschenrecht“
Welche Aufgaben hat der Fachbereich Migration der Deutschen Aidshilfe?
Den Fachbereich Migration gibt es seit 2017. Es war der Deutschen Aidshilfe wichtig, eine eigene Abteilung zu initiieren, damit zielgruppenspezifische Angebote für verschiedene Gruppen von Migrant*innen entwickelt werden können. Wir arbeiten dafür mit Kooperationspartnern in verschiedenen Bundesländern und Migrant*innen-Communities zusammen. Gleichzeitig agieren wir auch auf politischer Ebene. Wir sprechen mit Politiker*innen, um die Bedarfe und Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen zu kommunizieren.

Warum ist es wichtig, zielgruppenspezifische Angebote für Migrant*innen zu schaffen?
Statistisch gesehen betrifft in Deutschland circa jede dritte HIV-Neudiagnose eine Person, die zugewandert ist. Das zeigt also, dass es Angebote und Maßnahmen braucht. Es geht dabei in erster Linie darum, Ungleichheiten abzubauen und Zugang zu Informationen, zu Prävention, zu Beratung und Versorgung zu schaffen. Die Gruppe der Migrant*innen ist sehr heterogen. Es gibt queere Menschen, Geflüchtete, Leute, die zum Beispiel Arabisch, Englisch oder Französisch sprechen. Eine unserer Zielgruppen sind Männer, die Sex mit Männern haben. Eine andere Zielgruppe sind Menschen, die Drogen gebrauchen.
Eine bisher vernachlässigte Gruppe in der HIV-Prävention in Deutschland sind Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere und Krankenversicherung. Diese Gruppe wird vom Gesundheitssystem de facto ausgeschlossen. Denn viele haben Angst, sich testen zu lassen, weil sie keinen Aufenthaltsstatus haben. Sie fürchten zum Beispiel, abgeschoben zu werden. Denn ohne Krankenversicherung oder gültige Aufenthaltspapiere ist eine Antiretrovirale Therapie nicht möglich. Für diese Menschen müssen Wege zu Testangeboten und Kampagnen, sowie Infomaterial und Schlüsselstellen für Behandlung und Betreuung gefunden werden.
Wir denken, die Zeit ist reif, dass Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel keine Angst mehr haben sollten, Angebote der Gesundheitsversorgung zu nutzen. Wir setzen uns politisch dafür ein, dass es eine Gesundheitsversorgung gibt, die nicht abhängig vom Aufenthaltstitel oder dem Geburtstort ist. Gesundheit ist kein Privileg, sondern ein Menschenrecht.
Welche Hürden gibt es für Ihre Zielgruppen, an Informationen zu kommen?
Wie entwickeln Sie zielgruppenspezifische Angebote?
Die Methoden sind sehr verschieden. Als Dachverband versuchen wir im Fachbereich Migration Konzepte in unterschiedlichen Sprachen zu entwickeln, die die lokalen Aidshilfen vor Ort in ihrer Präventionsarbeit umsetzen können. Es sollte immer Teil der HIV-Prävention sein, dass Mitarbeiter*innen die Menschen vor Ort aufsuchen, um Präventionsangebote anzubieten. Positive Ergebnisse haben wir erzielt, indem wir mit Menschen aus den verschiedenen Communities zusammengearbeitet haben, die dann als Gesundheitsbotschafter*innen oder Mediator*innen Peer-to-Peer-Arbeit leisten.
Wir arbeiten auch partizipativ mit Menschen zusammen, die mit HIV leben. Es gibt zum Beispiel die Kampagne „selbstverständlich positiv“ von Menschen mit HIV für Menschen mit HIV. „Hör zu! Selbstverständlich positiv“ ist ein Podcast für ein aktives, offenes und selbstbewusstes Leben mit HIV. Die Gäst*innen der Podcasts erzählen persönliche Geschichten über Erfolge aber auch Rückschritte und deren Bewältigung. Der Podcast, der sich an erster Stelle an Menschen mit HIV richtet, möchte hier Ratgeber sein, unterstützen und auf dem Weg zur Selbstverständlichkeit stärken.
Warum denken Sie, ist partizipative Beteiligung wichtig?
Ich bin ein Fan von Partizipation. Wir haben zum Beispiel das Projekt PaKoMi entwickelt, kurz für „Partizipation und Kooperation in der HIV-Prävention mit Migrantinnen und Migranten“ und in verschiedenen Städten partizipative Fallstudien durchgeführt. Ich habe in Hamburg mitgewirkt, wo es darum ging: Wie kann man französischsprachige Afrikaner*innen besser erreichen? Von Anfang an haben wir uns mit den Schlüsselpersonen aus den Communities auseinandergesetzt und gemeinsam Fragen und Methoden entwickelt. Dabei haben wir identifiziert: Wer bringt welche Kompetenz mit? Denn jeder Mensch ist Expert*in für irgendwas.
Dann haben wir die Befragung innerhalb der Community durchgeführt und auch gemeinsam ausgewertet. Die Ergebnisse der Begleitstudien haben gezeigt: Wenn die Menschen von Anfang an involviert sind und eigene Ideen und Wünsche einbringen, kann man herausfinden, was sie wirklich brauchen. Durch aktive Beteiligung von Menschen mit einer Migrationsbiografie kann die Primärprävention deutschlandweit die Zielgruppen erreichen. Gezielt muss es auch um Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere oder/und ohne Krankenversicherung gehen.
Welche Rolle spielen Vorurteile und Diskriminierung bei der Präventionsarbeit mit Migrant*innen?
Migrant*innen erleben Alltagsrassimus, aber auch strukturellen Rassismus. Viele von uns haben keine Chance, bessere Stellen zu besetzen und auf gleicher Stufe in der Hierarchie zu arbeiten wie Menschen ohne Migrationshintergrund. Ein Problem ist, dass Schulabschlüsse oft nicht anerkannt werden. Durch die Polizei werden einige Menschen aufgrund der Herkunft, der Ethnie bzw. der Hautfarbe ständig kontrolliert. Auch im Gesundheitswesen erfahren BPoC (Black und People of Color) Rassismus und Diskriminierung. Gerade im Gesundheitswesen ist das absolut unerträglich, denn dort treffen wir auf Menschen in besonders vulnerablen Lebenssituationen.
Was bedeutet das für partizipative Forschungsprojekte und die Institutionen dahinter?
Wie läuft HIV-Präventionsarbeit in Zeiten von Corona?
Die vergangenen zwei Jahre haben uns gezeigt, dass nichts vorhersehbar oder selbstverständlich ist. Die Gesundheitskrise hat die Fortschritte und jungen Siege im Kampf gegen HIV direkt getroffen.
Wir spüren, dass bei unserer Arbeit weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die Covid-Pandemie hat dazu geführt, dass die HIV-Prävention in Vergessenheit geraten ist. Das ist ein Problem, denn HIV ist nach wie vor da. In Frankreich läuft gerade die Kampagne „l’épidémie n’est pas finie“, „die Epidemie ist noch nicht vorbei“. Wir als Aktivist*innen im HIV-Bereich sagen, dass wir die Aufklärung nicht vernachlässigen dürfen. Wir befürchten, dass zum Beispiel die Nutzung von PrEP zurückgeht, der „Prä-Expositions-Prophylaxe“, bei der Menschen ein Medikament einnehmen, um sich vor einer möglichen Infektion zu schützen. Wir haben auch die Sorge, dass Menschen sich weniger testen lassen. Das heißt: Man muss parallel etwas gegen Corona und HIV tun.
Die Aidshilfen haben viel Erfahrung in der Gesundheitskommunikation. Lässt sich daraus etwas mitnehmen für den Umgang mit der Corona-Pandemie?

Im Fokus unserer Migrationsarbeit im Jahr 2021 standen zum Beispiel weiterhin die Umstellung der Fortbildungen auf digitale Formate, so haben wir von Januar bis April sieben Fortbildungen online anbieten könnten. Themen wie Hepatitis B und Covid-19 wurden in Präventionsveranstaltungen in afrikanischen Kirchengemeinden aufgenommen. Auch Präventionsangebote für queere Geflüchtete wurden weiterentwickelt. Darüber hinaus wurden die Fortbildungen zu Diversity um die Module Intersektionalität & Praxisreflektion sowie rassismuskritische Sozialarbeit erweitert. Die Fortbildungen zu „Migration, Flucht und Trauma“ wurden inhaltlich erneuert und mit verschiedenen Schwerpunkten angeboten.
Gesundheitskommunikation lässt sich in verschieden Formen umsetzen, wenn alle Beteiligten involviert werden. Der partizipative und integrative Dialog bleiben unumgänglich zum Erfolg der Präventionsarbeit in Gesundheitsbereich.