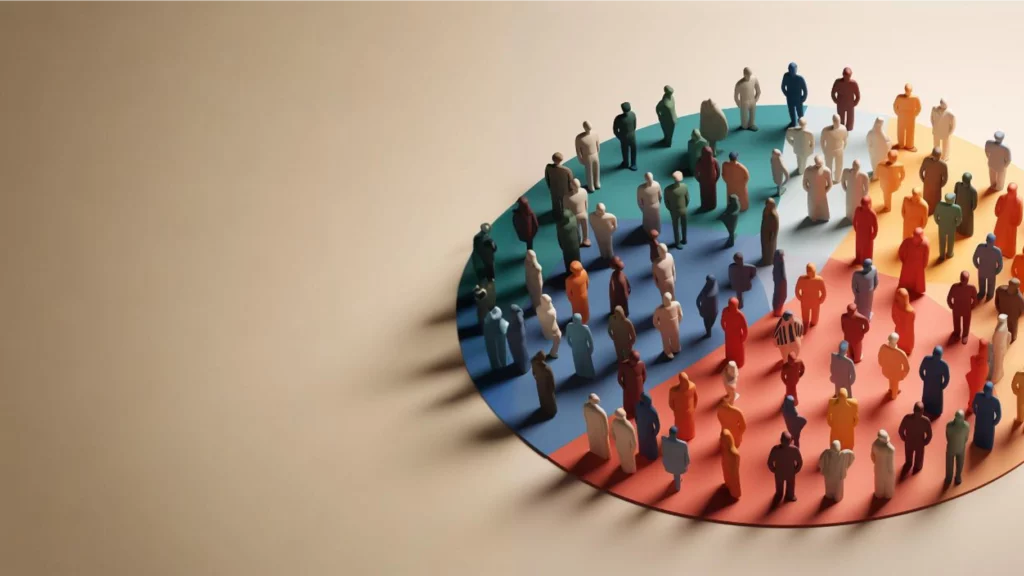Beteiligungssprojekte sollen Bürger*innen in wissenschaftliche Prozesse und politische Abwägungen einbeziehen. Wie gelingt das? Ein Gespräch mit dem Partizipationsforscher Ortwin Renn über aktuelle Entwicklungen, Chancen und Hürden partizipativer Formate.
„Partizipation wird zunehmend Gewicht bekommen“
Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung werden Wissenschaftskommunikation und Partizipation ausdrücklich erwähnt, es heißt „Perspektiven aus der Zivilgesellschaft sollen stärker in die Forschung einbezogen werden“. Wie hat sich der Stellenwert von Partizipation in der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation in den letzten Jahren verändert?

Die Rolle von Partizipation hat sich stark verändert. Man kann dabei drei Phasen ausmachen. In der ersten Phase ging es darum, Wissenschaft und ihre Erkenntnisse zu kommunizieren. In den 1980er-Jahren merkte man, dass es nicht reicht, einfach Informationen zu vermitteln. Es begann die zweite, die Dialog-Phase. Sie war und ist sehr stark geprägt von Formaten wie Podiumsdiskussionen, beispielsweise zur Kernenergie oder Gentechnik. Auf dem Podium sitzen zwar immer noch Wissenschaftler*innen. Die Idee dabei ist, Fragen aus dem Publikum aufzugreifen und so gut wie möglich zu beantworten. Man will damit auf die Anliegen und Bedenken der Menschen eingehen.
Etwa um die Jahrtausendwende verlagerte sich der Schwerpunkt mehr auf Partizipation. Dabei geht es anders als beim Dialog um Mitgestaltung und Mitwirkung der Menschen an Forschungsvorhaben oder Planungsprozessen. Es entstanden Citizen-Science-Projekte, in denen sich Menschen außerhalb der Wissenschaft in den Forschungsprozess einbringen können. Am Anfang waren das beispielsweise Vogelkundler*innen, die Vögel gezählt haben. Inzwischen werden nicht nur Daten von Lai*innen gesammelt, sondern Bürger*innen wirken auch an deren Interpretation oder am Forschungsdesign selbst mit.
Warum ist es wichtig, Bürger*innen an Wissenschaft und Forschung zu beteiligen?
Vieles, was Wissenschaft tut, schlägt sich in neuen Technologien oder in bestimmten wirtschaftlichen Entwicklungen und politischen Planungen nieder. Bei der Energiewende, der Pandemiebekämpfung oder der Digitalisierung der Arbeitswelt gibt es viele wissenschaftliche Aspekte, die eine Rolle für die gesamte Gesellschaft spielen. Bei Ersterem gibt es beispielsweise Beteiligungsformate wie den Bürger*innenrat, der Menschen einbezieht, die keine Wissenschaftler*innen sind. Das Ziel ist es, dass die kollektiven Entscheidungen nicht nur evidenzbasiert sind, sondern auch auf die Akzeptanz der Menschen stoßen.
Sie forschen an Kommunikations- und Partizipationsstrategien. Wovon hängen erfolgreiche Projekte ab?
Die nächste Stufe betrifft Einstellungs- oder Verhaltensänderung. Beides kann das Ziel von Partizipations- oder Dialogverfahren sein. Nehmen wir eine Informationsveranstaltung zur Pandemie, nach der die Menschen ihre Einstellung zum Impfen, Abstand halten oder Maske tragen ändern. Ein Ziel von Partizipationsverfahren – im Gegensatz zu Dialog- oder Informationsveranstaltungen – ist die Mitgestaltung der eigenen Lebenswelt. Die höchste Stufe ist die aktive Mitwirkung an Planungen oder an der Gestaltung von Maßnahmen. Hier können betroffene Bürger*innen direkt an politisch wirksamen Gestaltungsprozessen im Rahmen der rechtlich gegebenen Möglichkeiten mitwirken.
Wie gelingen partizipative Projekte?
Bei Partizipationsprozessen für kollektiv verbindliche Maßnahmen sind zwei Voraussetzungen ganz wesentlich: Erstens müssen die rechtlich legitimierten Entscheidungsträger*innen die Empfehlungen der Bürger*innen ernst nehmen.

Eine Herausforderung bei Beteiligungsprojekten wie auch in der Wissenschaftskommunikation allgemein ist, wie Zielgruppen angesprochen werden können. Wen erreichen Partizipationsverfahren tatsächlich?
Das hängt vom jeweiligen Partizipationsverfahren ab. Je besser Stakeholder*innen organisiert sind, desto eher sind sie bereit mitzumachen. Anders ist es bei nicht-organisierten, betroffenen Bürger*innen. Wenn das unsere Zielgruppe ist, arbeiten wir gerne mit Losverfahren. Von 100 Leuten, die wir anschreiben, machen vielleicht zehn Personen mit. Die Mehrheit beteiligt sich nicht. Schaut man sich diese zehn genauer an1, stellt man fest: Menschen aus bildungsferneren Schichten trauen sich häufig nicht mitzumachen und diejenigen, die viel Geld verdienen oder selbstständig sind, haben meist wenig Lust oder Zeit dazu.
Warum ist es wichtig, die Zivilgesellschaft auch an Wissenschaft und Forschung zu beteiligen?
Dafür gibt es mehrere Gründe: Sie sind Steuerzahler*innen: Bildung, Forschung und Wissenschaft werden von Bürger*innen bezahlt. Das heißt nicht, dass sie bestimmen sollen, was damit gemacht wird – wir haben die Freiheit von Forschung und Lehre und das ist auch gut so. Aber bei aller Wissenschaftsfreiheit ist die Wissenschaft auch rechtfertigungspflichtig, was mit den finanziellen Mitteln passiert. Die Bürger*innen sollten auch an der Entscheidung mitwirken können, wofür öffentliche Gelder ausgegeben werden.
Außerdem glaube ich, dass Wissenschaft davon lernen kann, was Menschen auf dem Herzen liegt. Eine Rückmeldung aus der Gesellschaft an die Wissenschaft ist wichtig. Wissenschaftler*innen können ihre Forschungsagenda teils danach ausrichten, was in der Gesellschaft als Problem erkannt wird und wofür man von der Wissenschaft gerne Lösungsvorschläge hätte. Und zuletzt braucht Wissenschaft in der Gesellschaft auch Akzeptanz.
Wie wirkt es sich auf die Akzeptanz, aber auch Vertrauen in Wissenschaft oder auf die Risikoeinschätzung aus, wenn man Bürger*innen aktiv in Gestaltungsprozesse einbezieht?
In dem Moment, in dem man Menschen an kollektiven Entscheidungen partizipieren lässt, führt es zu einer Veränderung der eigenen Ausgangslage: Die Menschen sehen sich nicht mehr in einer Opferrolle.
Sie haben die Arbeitsgruppe „Partizipation und Kommunikation“ im Projekt „Energiesysteme der Zukunft“ der acatech, der Leopoldina und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften geleitet. Welche Formate waren Teil des Projekts?
In diesem Projekt gab es verschiedene Formate: Neben reinen Informationsveranstaltungen zu Energiesystemen und -versorgung gab es auch Workshops mit eher praktischer Natur. Dabei haben wir die Fragen geklärt: Wie kann ich mein eigenes Energiesystem modernisieren? Wie kann ich einer Energiegenossenschaft beitreten? Wir haben versucht, Menschen damit zu empowern, selbst ein Teil der Energiewende zu werden. In Workshops haben wir mit Stakeholdern Empfehlungen für die Bundespolitik erarbeitet, wie man aus Sicht der befragten Gruppen die Energiewende vorantreiben kann. Daran nahmen sowohl Wissenschaftler*innen als auch Repräsentat*innen zivilgesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder verbandlich organisierter Gruppen und Organisationen teil. Die Ergebnisse haben wir beispielsweise an das Bundeswirtschafts- und das Bundesumweltministerium weitergegeben.
Sie beraten auch den „Bürgerrat Klima“. Können Sie anhand dieses Beteiligungsformats erklären, wie Bürger*innen an gesellschaftspolitischen Entscheidungen beteiligt werden können?
Viele der 160 beteiligten Bürger*innen hatten Fragen: Ist das mit dem Klimawandel so drastisch, wie in den Medien dargestellt? Muss ich auf mein Auto verzichten? Sie waren auch kritisch gegenüber Wissenschaftler*innen: „Die haben gut reden, sie verdienen viel Geld. Jetzt wollen sie mir die Ölrechnung erhöhen.“
Worin sehen Sie die Zukunft partizipativer Wissenschaftskommunikation?
Partizipation wird zunehmend Gewicht bekommen. Natürlich wird es auch Rückschläge geben. Vieles, was als Partizipation ausgegeben wird, ist keine oder schlecht gemachte Inszenierung. Partizipation kann auch instrumentalisiert werden: beispielsweise wenn Beteiligungsverfahren durchgeführt werden, um ein bereits bestehendes Ergebnis nachträglich zu legitimieren.
Aber das Rad können wir nicht mehr zurückdrehen. Ich habe viele Wissenschaftler*innen getroffen, die an Beteiligungsprojekten mitgewirkt und ihre anfängliche Skepsis abgelegt haben, Lai*innen einzubeziehen. Sie meinten, dass sie wertvolle Anregungen erhalten haben, was sie nicht erwartet hätten. Natürlich gibt es unter den Beteiligten immer verbohrte Personen. Aber gerade bei Losverfahren habe ich erlebt, dass das eine kleine Minderheit ist. Die meisten wollen lernen und rational mitwirken.