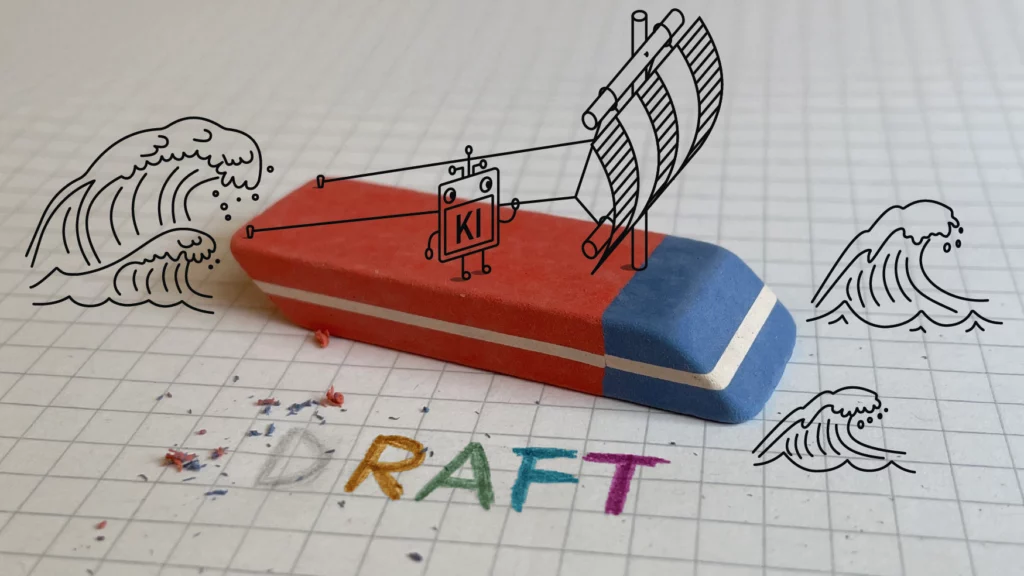Mit dem „Science Communication Accelerator“ Podcast möchte Julius Wesche zeigen, wie sich Soziale Medien für die Wissenschaftskommunikation nutzen lassen. Dabei will er vor allem Praxiserfahrung teilen. Im Interview spricht er über Zielgruppen, Digitalformate und darüber, wie viel Evidenzbasierung im Projekt steckt.
„Social Media ist das Beste, was Wissenschaftskommunikation passieren konnte“
Herr Wesche, in Ihrem Podcast „Science Communication Accelerator (scicomX)“ geht es um die Themen digitale Wissenschaftskommunikation und Social Media. Warum haben Sie diesen Fokus gewählt?
Seit Facebook im Jahr 2006 aufkam, hat sich Social Media weit verbreitet. Trotzdem gibt es in Deutschland, aber auch weltweit noch viele Wissenschaftsorganisationen, die nicht richtig verstanden haben, wie man Soziale Medien für die Wissenschaftskommunikation nutzt. Das sage ich nicht despektierlich, es ist nur eine Beobachtung.
In der wissenschaftlichen Arbeit wird Wissenschaftskommunikation noch nicht ausreichend wertgeschätzt. Es geht vorrangig darum, wie oft du als Wissenschaftler*in zitierst wirst. Es ist doch aber ein anachronistisches Konzept, den Einfluss von Wissenschaft daran zu messen, wie oft du von deinen Kolleg*innen zitiert wurdest. Den Impact nur daran festzumachen, wie viele Menschen du erreichst, die auch wissenschaftliche Publikationen schreiben, die peer-reviewed sind, womöglich hinter einer Paywall stecken und im Fachjargon geschrieben sind, ist für mich nicht nachvollziehbar.

Die Sozialen Medien sind meiner Meinung nach das Beste, was Wissenschaftskommunikation passieren konnte. Und das sage ich wohlwissend, dass die Plattformen auch Risiken bergen und negative Seiten haben. Die Sozialen Medien ermöglichen uns, so günstig und einfach wie nie zuvor Wissen zu teilen. Mit meinem Podcast möchte ich einen Beitrag dazu leisten, dass mehr Wissenschaftskommunikations-Content in den Sozialen Medien geteilt wird.
Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?
Ich sehe zwei Punkte, warum Wissenschaftsorganisationen oder Wissenschaftler*innen ihre Wissenschaft nicht über digitale Formen kommunizieren. Erstens wissen sie nicht, wie es geht. Das ist nachvollziehbar, bedeutet aber, dass es mehr Aus- und Fortbildung bräuchte. Zweitens trauen sie sich nicht, damit anzufangen, weil sie Angst davor haben, exponiert zu werden. Sie haben Angst, bewertet zu werden.
In meinem Podcast möchte ich ganz praktisch vermitteln, wie Social Media in der Wissenschaftskommunikation funktionieren kann. Es geht beispielsweise darum, wie man einen Podcast macht, eine Kommunikationsstrategie entwickelt oder einen Instagram-Account einer Organisation aufbaut. Ich möchte auch Mut machen, es auszuprobieren. Und natürlich passieren dabei Fehler, aber das ist okay. In der Wissenschaft gibt es das Prinzip „trial and error“: Wir machen andauernd Fehler und lernen daraus. So sollten wir auch in der Wissenschaftskommunikation denken. Niemand kann Social Media einfach von Anfang an. Bei meinem ersten Podcast „enPower“ mit Markus Fritz zur Energiewende waren die ersten aufgenommenen Folgen technisch, ich sage mal „verbesserbar“ produziert. Und irgendwann wurde es besser. Nichts, was ich produziere ist perfekt, aber ich glaube, dass es okay ist Fehler zu machen. Schnelligkeit schlägt langfristig den Fokus auf das letzte kleine Detail.
An welche Zielgruppen richtet sich Ihr Podcast?
Meiner Erfahrung in zwei Wissenschaftsinstitutionen nach war es oft so, dass die Wissenschaftler*innen nicht das Gefühl hatten, dass die Kommunikator*innen auf sie zukommen und andersherum. Ich möchte, dass die Menschen aufeinander zugehen, wenn sie meinen Podcast hören, und gemeinsam coole Formate erarbeiten.
Warum haben Sie einen Podcast als Format gewählt, um über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation zu sprechen?
Es gibt verschiedene Formate oder Arten, wie du kommunizieren kannst: Schreiben, Audio, Video, Grafik. Wissenschaftsorganisation sollten auf alle vier Arten kommunizieren. Und mittlerweile höre ich immer öfter, dass sie auch Social first-Strategien verfolgen. Aber wenn man alleine ein Projekt macht oder ein kleines Team ist, ist es am einfachsten ein Format zu wählen, das einem leichtfällt. Und bei mir ist es das Reden. Ich empfehle allen Wissenschaftler*innen sich zu fragen: Wie kannst du am besten kommunizieren? Und basierend auf der Antwort sollten sie das Format wählen.
Welche Themen und Facetten der Wissenschaftskommunikation möchten Sie in Ihrem Podcast abdecken?
Mir ist es wichtig, Praxiswissen zur Verfügung zu stellen. In den ersten Folgen bin ich erst einmal die verschiedenen Social-Media-Kanäle durchgegangen von Twitter bis Instagram oder auch Social-Audio-Formate wie Clubhouse und Twitter Spaces. Es geht auch um philosophische Themen wie Zwischenmenschlichkeit oder Humor oder Verständnisfragen wie in der Folge „Engaging the Disengaged“ mit Hayden Mort.
Wie evidenzbasiert sind diese Praxistipps?
Sie teilen aber nicht nur Ihr eigenes Wissen, sondern holen sich pro Folge eine*n Gesprächspartner*in dazu. Wie wählen Sie Ihre Interviewpartner*innen aus?
Ich habe eine lange, stetig wachsende Liste an Themen, die ich spannend finde und interessant für die Community halte. Ich frage mich dann, wen ich dazu in den Podcast einladen könnte. Natürlich sollte die Person Charisma haben, weil niemand Schlaftabletten im Podcast hören möchte. Ich schaue dann: Wer postet dazu auf Social Media? Wer hat Beiträge zum Thema veröffentlicht oder anderweitig dazu kommuniziert? Ich kontaktiere sie meistens über LinkedIn. Die meisten haben Lust mitzumachen, andere brauchen etwas Überzeugungsarbeit.
Welche Themen kommen noch?
Es kommen noch Gespräche zu Social-Media-Trends in der Wissenschaftskommunikation, institutionellen Instagram-Accounts, Blogging, Snap Chat, Suchmaschinenoptimierung, Open Science und den Erfahrungen mit der der Social-first-Strategie einer Australischen Universität. Die Liste ist lang.
Ins Machen zu kommen. Ich bin im Frühjahr nach Norwegen gezogen, habe im Juli meine Promotion eingereicht und im Oktober verteidigt. Zwischen Einreichung und Verteidigung ist der Podcast entstanden, er war aber bereits seit einem Jahr in meinem Hinterkopf. Ich musste Prioritäten setzen und mir eingestehen, dass nicht alles auf einmal geht.
In vielen Kommunikationsabteilungen der Wissenschaftsorganisationen gibt es die Einstellung, dass alle Projekte sehr gut sein müssen. Das ist schön, macht aber viele Prozesse sehr langsam und verhindert, Dinge auszuprobieren. Bei einem Podcast muss vor allem die Soundqualität gut sein. Aber sie muss nicht perfekt sein. Wenn du in den Sozialen Medien gesehen werden willst, musst du regelmäßig posten: „You have to make content available – at scale“: Aber dieses „Ganz viel“ ist nicht so nah am wissenschaftlichen Arbeiten dran. Damit scheinen viele Wissenschaftler*innen zu hadern.
Können Sie Zahlen nennen, wie häufig Ihr Podcast gehört wird?
Aktuell sind es 2200 Aufrufe bei 16 Folgen. Das ist nicht unendlich viel, aber digitale Wissenschaftkommunikation ist ein komplettes Nischenthema. Bei meinem anderen Podcast enPower haben wir gerade die 150 000 Streams geknackt. Bei scicomX investiere ich nur Zeit neben meinem Vollzeit-Job an der Universität. Gerade bin ich dabei scicomX als Firma anzumelden. Im Podcast werde ich weiterhin mein bestes Wissen teilen. Daneben möchte ich Wissenschaftsorganisationen bei der Social-Media-Strategieentwicklung begleiten. Mein Ziel mit dem Podcast ist es nicht, irgendjemand von digitaler Wissenschaftskommunikation zu überzeugen. Aber wenn Wissenschaftler*innen oder Wissenschaftsorganisationen darin besser werden wollen, freue ich mich sie zu unterstützen. Neben einer Reihe an Vorträgen habe ich bereits den ersten Kunden, ein kleines Forschungsinstitut in Süd-Deutschland, gefunden. Alles was die scicomX-Firma eines Tages dann einnimmt, investiere ich erst einmal wieder zurück in den Podcast, in Sichtbarkeit und Content. Das erste was ich abgeben werde, ist das Episodenschneiden, danach möchte ich mehr Blogposts schreiben und ein Wiki zur digitalen Wissenschaftskommunikation erstellen.
Wie fällt aktuell das Feedback zu Ihrem Podcast aus?
Matthew Lieber, einer der Gründer von Gimlet Media, das jetzt zu Spotify gehört, hat einmal gesagt, dass Podcasts stetig wachsen, solange sie kontinuierlich Content produzieren. Und das sehe ich auch bei scicomX. Die Frage ist nur, wie schnell man wächst. Gerade am Anfang ist man wenig sichtbar.
Ich bekomme Fragen zu Episoden unter meinen LinkedIn-Posts. Ich bitte die Personen dann, mir ihre Fragen als Audionachrichten zu schicken, die ich im Podcast verwenden darf. Ich plane daraus neue Folgen zu machen und ein Gespräch zu starten.
Warum haben Sie sich dazu entschieden, den Podcast auf Englisch zu produzieren?
Mittlerweile gibt es immer mehr deutsche Podcasts zu Wissenschaftskommunikation: das Wisskomm-Quartett, SciComm Palaver, Zeit für Wisskomm. Da bewegt sich etwas.
Haben Sie Tipps für Menschen, die mit digitaler Wissenschaftskommunikation beginnen möchten?
Das hängt von der Zielgruppe ab. Wissenschaftler*innen würde ich sagen: Anfangen ist alles, fang klein an und überlaste dich nicht. Geh am besten mal zu den Kommunikator*innen in deinem Institut und rede mit ihnen über die Möglichkeiten, Wissenschaft zu kommunizieren. Manchmal reicht schon ein Google Scholar- oder Twitter-Account für den Anfang.
Wissenschaftsorganisationen rate ich: Ignoriert Social Media nicht! Überlegt euch, wen ihr erreichen wollt, welche Kanäle ihr nutzen möchtet und macht Content für diese Zielgruppe.