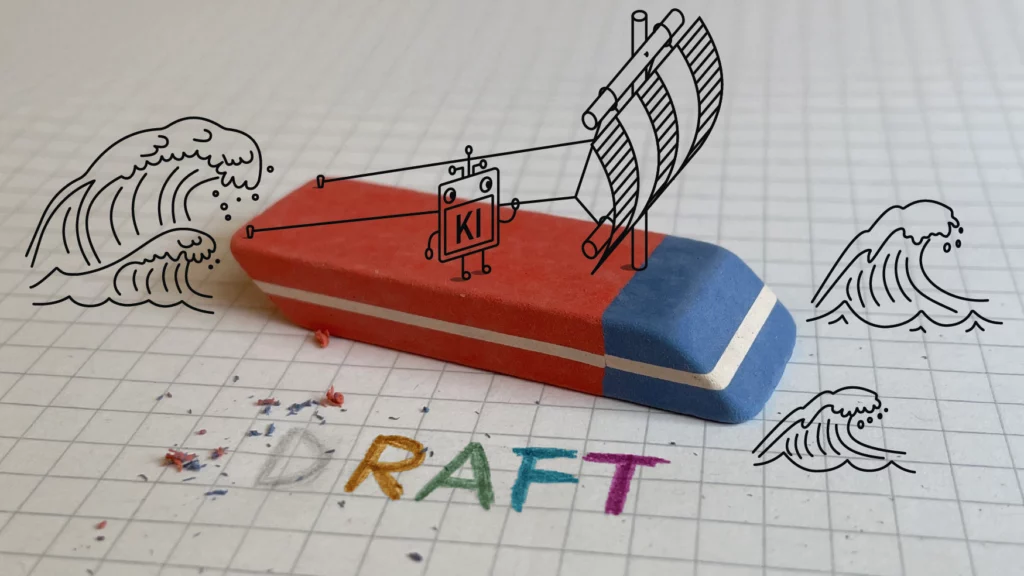Konstanze Marx forscht zu Diskursen im Netz, sprachlicher Gewalt und Cybermobbing und kommuniziert darüber. Wie die Professorin für Linguistik den Austausch auf Twitter und Instagram wahrnimmt und was sie daraus für ihre Forschung mitnimmt, erklärt sie im Interview und gibt Tipps für den Start.
„Twitter weitet den Blick in die vielfältige Gesellschaft“
Frau Marx, wieso finden Sie es wichtig, dass Wissenschaftler*innen mit der Öffentlichkeit kommunizieren?
Wissenschaftskommunikation gehört für mich zu meinem beruflichen Selbstverständnis und ist eng an meine Tätigkeit geknüpft. Meine Forschung wird von Steuergeldern finanziert und ich sehe es u.a. deshalb auch als eine Verpflichtung an, Ergebnisse zurück in die Gesellschaft zu tragen.
Welche Kommunikationskanäle nutzen Sie?

Ich sehe für mich drei Kanäle für Wissenschaftskommunikation. Als einen Kanal würde ich natürlich die traditionellen Medien sehen, hier ist man eher abhängig von aktuellen Ereignissen oder spezifischen Anfragen, die ich gern entgegennehme und nach Möglichkeit auch kurzfristig beantworte.
Soziale Medien sind ein zweiter Kanal, hier kann man deutlich mehr selbst bestimmen. Ich nutze vor allem Twitter – sowohl über meinen eigenen als auch den Lehrstuhl-Account. Meinen Facebook-Account habe ich schon lange nicht mehr aktualisiert, er war (oder ist) aber auch eher privat. Instagram nutze ich persönlich (noch) nicht, betreibe aber gemeinsam mit studentischen Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen einen Lehrstuhl-Account.
Als dritten Kanal würde ich Präventionsworkshops im analogen Bereich und Präventionsvideos auf YouTube einordnen, die ich für Eltern und Schulen (teilweise zusammen mit einem Kollegen aus der Kriminologie) zum Thema Cybermobbing anbiete.
Wie unterscheiden sich die Kanäle in Ihrer Wahrnehmung?
Unsere Lehrstuhl-Social-Media-Kanäle haben interessanterweise eine ähnliche Anzahl an Follower*innen, wobei wir auf Instagram deutlich mehr Studierende erreichen als auf Twitter. Twitter ist eher die Plattform für Kolleg*innen und die Fachcommunity.
Wie bewerten Sie den Diskurs auf Twitter?
Es ist schwierig, „den Diskurs“ auf Twitter überhaupt als solchen zu konturieren. Es gibt hier abhängig von der Reichweite und Vernetzungsgestaltung ganz unterschiedliche Diskurse. Ich selbst bewege mich mit meinen Followerzahlen noch in einem relativ geschützten Bereich, habe also nicht die Reichweite, die mich wirklich exponiert. Gewöhnungsbedürftige Erfahrungen habe ich bisher eigentlich nur gemacht, wenn ich mich zum Gendern äußere. Das ist ein Thema, mit dem man schon einmal schnell in Bubbles gelangen kann, mit denen es vorher keine Berührungspunkte gab. Da ich zu sprachlicher Gewalt forsche, ergibt sich auf diese Weise auch ein Zugang zu relevantem Datenmaterial. Gleichermaßen erfährt man so im klassisch ethnographischen Sinne die Dynamiken im „Feld“, eine Erfahrung, auf die man persönlich auch gern verzichten würde, die aber für die wissenschaftliche Durchdringung von Nutzen sein kann.
Wie haben Sie ihren Kanal gestartet?
Offiziell begonnen habe ich, als ich meine Professur in Mannheim angetreten habe. In der Zeit bin ich unheimlich viel gereist und so gab es eine Reihe von Anlässen, über Konferenzen zu berichten und die Diskurse in unserem Forschungsfeld abzubilden. Warum sage ich „offiziell“, weil es auch einen inoffiziellen zweijährigen „Trainingskurs“ bei Twitter mit einem kleinen, aber feinen anonymen Account gab. Damit wollte ich ein Gespür für die plattformtypischen Dynamiken entwickeln und mir die kommunikativen Prozesse zunächst erschließen.
Neben linguistischen Themen und Stellenausschreibungen innerhalb des Fachs, die lange hauptsächlicher Inhalt meines Kanals waren, sind seit der Pandemie Konzeptionen und Erfahrungen zu digitaler Lehre, deutlich ausgeweitete Interaktionen und zunehmend auch (bildungs)-politische Themen hinzugekommen. Ich beobachte das bei mir selbst durchaus mit Interesse, finde diese Entwicklung aber folgerichtig.
Merken Sie, dass sich Ihre Followerschaft verändert, seitdem Sie sich politischer und privater äußern?
Gibt es Feedback von Ihren Kolleg*innen zu Ihren Kommunikationsaktivitäten?
Viele Kolleg*innen twittern inzwischen selbst und vernetzten sich auch aktiv oder stehen kurz davor, auf Twitter oder Instagram aktiv zu werden. In diesen Zusammenhängen thematisieren und reflektieren wir unsere Aktivitäten auf Social Media auch. Es gibt aber auch Kolleg*innen, die zurückhaltender sind und einfach Bedenken haben. Viele lesen leise mit, das erfährt man dann bei Konferenzen. Die Momente, in denen man analog einfach an Twitter-Interaktion anschließen kann (obgleich man sich noch nie persönlich begegnet ist), schätze ich sehr. Sie spiegeln den Mehrwert für die Vernetzung und sind meines Erachtens auch für Studierende und Promovierende von Vorteil. Ich hätte mir eine solch niedrigschwellige Form der Kontaktaufnahme für meine Anfangszeit in der Wissenschaft jedenfalls sehr gewünscht.
Wie schaffen Sie es, Ihre Kommunikationsaktivitäten in den Alltag einzutakten?
Haben Sie sich Sachen bei anderen abgeschaut?
Unwillkürlich, ja: Wie gesagt, im Grunde bin ich ja quasi in die Twitter-Schule gegangen, um diese Plattform zu verstehen und von versierten Personen zu lernen. Das betrifft unterschiedliche Ebenen: die gesamte Funktionsweise, den Einsatz multimodaler Ressourcen, etwa gifs, Fotografien oder eigene Videosequenzen, oder sprachliche Strukturen. Insbesondere Twitter ist eine Plattform, die – ich formuliere das jetzt mal so personifiziert – sich selbst und andere Social-Media-Kanäle häufig auf einer Meta-Ebene reflektiert. Regeln werden also explizit gemacht, was es gerade Einsteiger*innen erleichtert, sie anzuwenden, darauf Bezug zu nehmen oder sie durchaus auch performativ zu hinterfragen. Nichtsdestotrotz verbleibt man manchmal ratlos, wenn etwas, dass man selbst furchtbar lustig findet, einfach im digitalen Nirvana verhallt, während Beiträge, die man für sich selbst als „nur so mittel“ eingeordnet hat, erstaunlich viele Likes erhalten. Ein bisschen mysteriös darf es aber auch bleiben, sonst erschöpft sich ja auch das Forschungsinteresse. 
Haben Sie einen Rat an Wissenschaftler*innen, die noch nicht kommunizieren, es aber gerne tun wollen?
Einfach anfangen. Ich glaube nicht, dass man so viel falsch machen kann. Der gestalterische Spielraum in den Sozialen Medien ist groß und Veröffentlichungsdruck, der ja häufig als Argument dafür angegeben wird diese Kanäle zu meiden, macht man sich allenfalls selbst.
Häufig ist zu lesen, dass Twitter eher ein Minenfeld ist, aber in der Wissenschaft habe ich es bisher ganz anders erlebt. Hier haben sich sehr positive Interaktionen mit der Community ergeben.
Ich darf an dieser Stelle vielleicht noch einen Tipp geben, der mir in der Vorbereitung auf die Woche als Kuratorin bei den RealScientists sehr gut gefallen hat. Man erhält dort zum Einstieg wertvolle Hinweise, aber vor allem diese Grundregel: „Die Leute, die für diesen Account tweeten, sind furchtbar nett.“ Das macht etwas mit einem, diese Einstellung darf man ruhig auch für die eigenen Accounts mitnehmen.
Was wünschen Sie sich, damit Wissenschaftskommunikation für Wissenschaftler*innen noch einfacher umzusetzen ist?