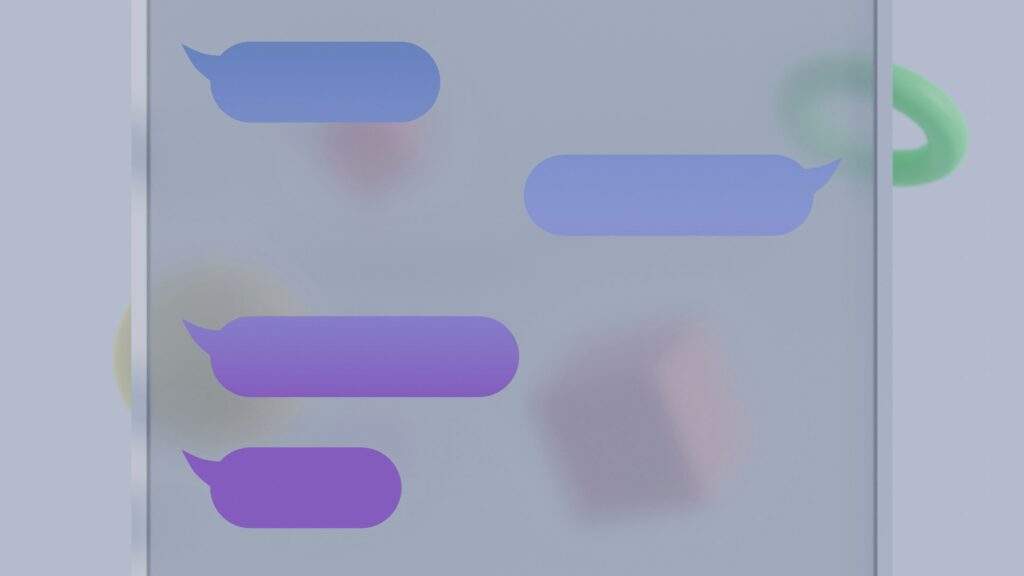Sollten sich Forschende in ihrer Kommunikation mehr auf Evidenz und weniger auf Storytelling fokussieren? Das fordert ein Beitrag auf Nature.com und stellt fünf Regeln für Evidenzkommunikation vor. Hans Peter Peters plädiert im Gastbeitrag dafür, das differenzierter zu sehen, sieht aber auch zwei wesentliche Probleme bei Storys.
Wahrheit oder Wirkung?
Im Jahr 2007 wurden zwei bemerkenswerte Meinungsbeiträge zur Frage evidenzbasierter Wissenschaftskommunikation veröffentlicht, deren Autoren ganz unterschiedliche Standpunkte vertraten: Matthew Nisbet und Chris Mooneys „ Framing Science“ sowie Baruch Fischhoffs „ Nonpersuasive Communication about Matters of Greatest Urgency: Climate Change“. Pointiert zusammengefasst meinen Nisbet und Mooney, dass die Wissenschaft sich nicht auf die öffentliche Kommunikation detaillierter Evidenz beschränken sollte, sondern dass es vielmehr auf angemessenes „Framing“ (Deutungsmuster) ankomme, um Fehlinterpretationen durch die Bevölkerung zu vermeiden. Fischhoff plädiert demgegenüber dafür, auf die Kraft der Evidenz und die Vernunft der Laien-Bevölkerung zu vertrauen und den Adressatinnen und Adressaten durch Vermittlung von Evidenz eigene Meinungsbildung zu ermöglichen.
Drei Dilemmas in Kommunikationssituationen
Ich habe diese beiden Extrempositionen von Wissenschaftskommunikation verschiedentlich als Orientierung an „Wahrheit“ oder „Wirkung“ bezeichnet. Damit impliziere ich natürlich nicht, dass diejenigen, die auf Wirkung abzielen, die Unwahrheit sagen. Gemeint ist, dass sich die Zielgrößen unterscheiden: bestmögliches Verständnis wissenschaftlicher Evidenz oder stärkste Veränderung von Einstellungen oder Verhalten in die gewünschte Richtung. Die Meinungsbildung vorwegzunehmen und Bürgerinnen und Bürgern Evidenz mithilfe von Framing so zu vermitteln, dass nur noch diese eine Meinung sinnvoll erscheint, behandelt sie als Objekt von Persuasion (Überzeugung, Überredung – anm. d. Red.) oder gar Manipulation. Zudem beansprucht man damit selbst eine mit dem Leitbild der mündigen Bürgerinnen und Bürger und einer demokratischen Gesellschaft (sowie dem „Public Engagement“-Paradigma) unvereinbare paternalistische Rolle. Ihnen durch verständliche, erklärende und Unsicherheiten transparent machende Evidenzvermittlung die Möglichkeit eigener Meinungsbildung zu eröffnen, geht demgegenüber das Risiko ein, dass die so gebildeten Meinungen zu Verhaltensweisen und politischen Präferenzen führen, die – wie im Falle der Corona-Pandemie – letztlich auch Gesundheit und Leben gefährden. Das ist das normative Dilemma.
Ein empirisches Dilemma besteht außerdem darin, dass man meist gar nicht genau wissen kann, ob die gewählte persuasive Strategie im Hinblick auf die gewünschten Wirkungen tatsächlich effizient ist. Framing ist eine dezidierte Form der Bedeutungskonstruktion, die auf der einen Seite potenziell persuasiv wirksam ist und auf der anderen Seite wegen dieses offenkundigen Persuasionscharakters bei einem Teil des Publikums Ablehnung der Evidenz provoziert und zu Misstrauen gegen den Kommunikator oder die Kommunikatorin führt. Der Industrieberater Hans-Christian Röglin formulierte es 1990 bei einem Umwelt-Symposium der Firma Bayer so: „Wer Akzeptanz will, darf sie nicht wollen!“ Und das gilt meines Erachtens nicht nur für die Akzeptanz der Chemieindustrie, sondern auch für Evidenzkommunikation über Klimawandel und Corona-Pandemie, also überall da, wo man bei einem Teil der Bevölkerung mit Skepsis gegen kommunizierte Inhalte und ihre praktischen Implikationen rechnen muss.
Ein drittes Dilemma will ich nur erwähnen, aber nicht weiter ausführen, dass nämlich verschiedene Segmente der Bevölkerung unterschiedliche Erwartungen an die Kommunikation haben und unterschiedlich auf ein und dieselbe Form der Kommunikation reagieren. Sollen sich Kommunikatoren beispielsweise an denen orientieren, die eindeutige und mit Autorität kommunizierte Wahrheiten erwarten, oder an denen, die den Prozess der Generierung von Wissen und die Abwägungen des Risikomanagements angesichts von Unsicherheiten mitvollziehen wollen? Sollen sie die Ängstlichen im Blick haben und beruhigen, oder die Abgebrühten durch alarmierende Kommunikation aufrütteln?
Für dieses komplizierte Problemfeld machen Michael Blastland et al. in ihrem Nature-Artikel „Five rules for evidence communication“ einen sinnvollen Vorschlag. Er entspricht im Wesentlichen der persuasionskritischen Position Fischhoffs und seinem Vertrauen in die Fähigkeit und Bereitschaft von Laien, mit gut erklärter wissenschaftlicher Evidenz sinnvoll umzugehen. Die Autorinnen und Autoren weisen auf die Bedeutung des Kommunikationskontextes hin und auf die Tatsache, dass Laien nicht nur die Validität wissenschaftlicher Evidenz beurteilen (was nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist), sondern auch die Vertrauenswürdigkeit der Wissenschaft und des Risikomanagements elaborieren.
Ich teile im Übrigen die zu Beginn des Artikels angedeutete Skepsis gegen Storytelling als Default-Ansatz in der Wissenschaftskommunikation. Eine gute „Story“ kann Interesse wecken, unterhalten, wissenschaftliche Erkenntnisse kontextualisieren und damit die praktische Relevanz der Evidenz zeigen. Es gibt tolle Wissenschaftsstorys. Aber bei der Vermittlung von Expertise durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Risikomanagerinnen und -manager haben Storys zwei potenzielle Probleme. Erstens können sie ablenken von der wissenschaftlichen Kernbotschaft und die Aufmerksamkeit auf Randaspekte lenken. Zweitens ist Storytelling eine starke Form des Framing und führt die Adressatinnen und Adressaten unmerklich hin zu bestimmten Perspektivübernahmen, Einstellungen, Emotionen und Schlussfolgerungen. Im Kino lassen wir uns das gern gefallen, aber von Wissenschaft und Staat in der öffentlichen Kommunikation? Natürlich ist es legitim, andere überzeugen zu wollen. Aber bitte doch offen und mit Evidenz und Argumenten.
Weitere Kommentare zum Thema
Mike S. Schäfer: „Evidenz statt Story? Evidenz und Story!“
Martin W. Bauer: „Die Ironie des Regelsets“
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.