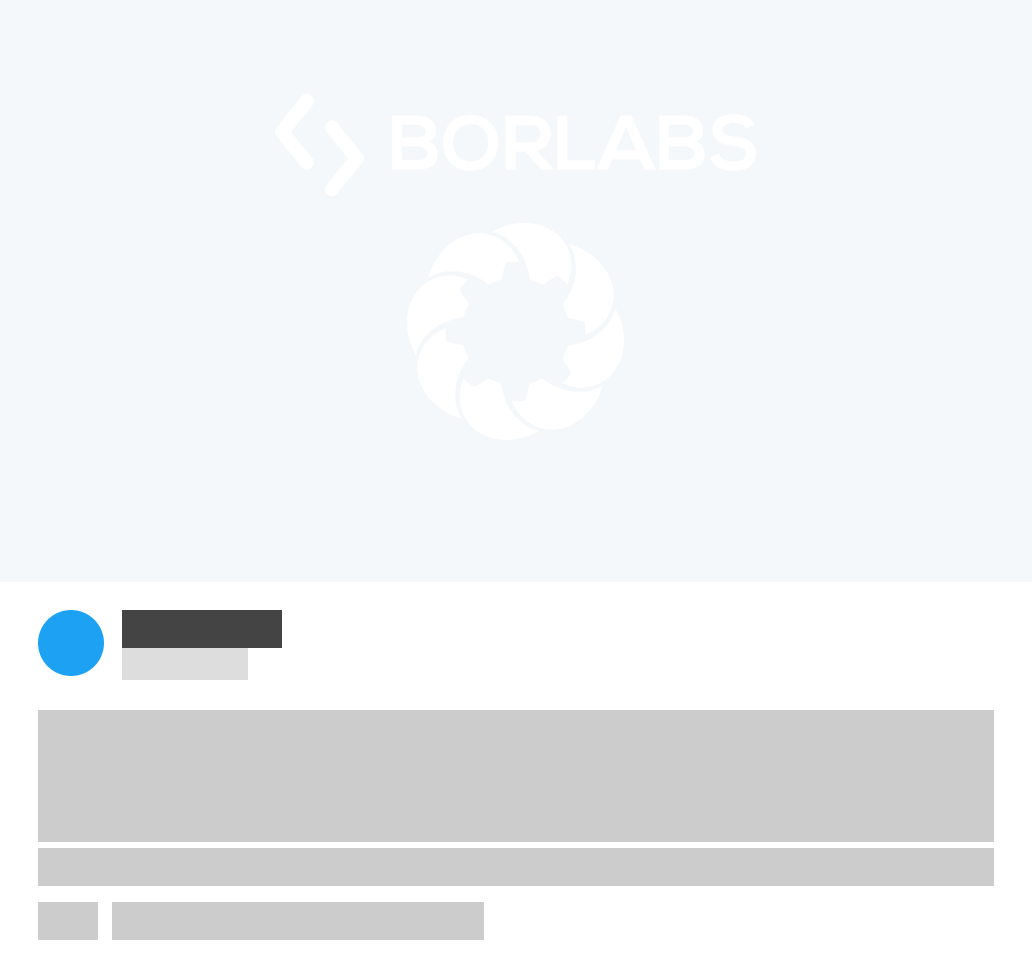Professionelle Kommunikation kann Wissenschaft schützen. Das zeigen die Fehler, die bei der Kommunikation der „Heinsberg-Studie“ der Universität Bonn gemacht wurden. Die Wissenschaftskommunikation kann und sollte daraus lernen, findet Nicola Wessinghage, Geschäftsführerin der Agentur Mann beißt Hund.
Ein Lehrstück für die Wissenschaftskommunikation
Die Kommunikationskampagne um die Heinsberg-Studie gibt Anlass für eine Besprechung der ethischen Richtlinien in der Wissenschaftskommunikation. In unserer Kommentarreihe zum „Fall Heinsberg“ ordnen Praktikerinnen und Praktiker des Feldes die Geschehnisse ein und zeigen auf, was wir aus ihnen lernen können.
In der aktuellen Corona-Krise haben Nachrichten aus der Wissenschaft Hochkonjunktur, die neue Erkenntnisse über das Virus versprechen. So schauten auch viele mit großer Erwartung auf die sogenannte „Heinsberg-Studie“ der Universität Bonn, noch bevor die ersten Zwischenergebnisse veröffentlicht worden waren. Ein Forschungsteam rund um den Studienleiter Hendrik Streeck hatte in der Ortschaft Gangelt im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg eine repräsentative Stichprobe untersucht und eine höhere Immunitäts- sowie eine niedrigere Sterblichkeitsrate ermittelt als jene, von denen man bis dahin ausgegangen war. Solche Neuigkeiten wollten in der Zeit nach den ersten Wochen des Lockdowns in Deutschland viele nur zu gerne hören – vor allem Politiker wie der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der sich zu diesem Zeitpunkt schon wieder für eine Lockerung der einschränkenden Maßnahmen stark gemacht hatte. Das Land hatte die Studie in Auftrag gegeben.

„Wenn ich mir die aktuelle Lage anschaue, denke ich, dass sich auch die institutionelle Forschung-PR gerade in einer Ausnahmesituation befindet. Es gilt massive, aber ganz unterschiedlich akzentuierte Erwartungen in Teilöffentlichkeiten der Gesellschaft mit Orientierungswissen und Handlungsempfehlungen zu versorgen: die Politik, die Wirtschaft, die Medien, das Gesundheitswesen, Eltern, Senioren etc. Die Verantwortung dafür, dass das gelingt, ohne wissenschaftliche Standards zu missachten, liegt in der Verantwortung der Wissenschaft und der PR gleichermaßen. Ich persönlich kann mich an keine vergleichbare Herausforderung für die Forschungs-PR erinnern wie die gegenwärtige.“
Wenn unter extrem hohen Belastungen der Forschenden, bei sehr engen Zeitfenstern und bei großen Erwartungen verschiedener Anspruchsgruppen der Druck steigt, ist es nur zu naheliegend, dass Fehler geschehen. Ein erster solcher Fehler bei der Heinsberg-Studie war es, die wissenschaftliche Community nicht zuerst zu informieren. Zentrale Informationen zum Vorgehen und der Methodik der Studie lagen noch nicht vor, als Hendrik Streeck im Schulterschluss mit Ministerpräsident Armin Laschet mit „Zwischenergebnissen“ an die Öffentlichkeit ging. Dass man hier ein Peer-Review-Verfahren nicht hatte abwarten können, ist nachvollziehbar. Die Daten aber erst nachträglich auf einem Preprint-Server den wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen, war ein Versäumnis. So entzündete sich eine intensive Diskussion über die Aussagen und die Methodik der Untersuchung, ohne dass die dafür notwendigen Hintergrundinformationen vorlagen. Im Ergebnis wirkte sich das negativ auf die Wahrnehmung der Studie aus.
Für Kritik sorgte auch die Kommunikation der Studie in Richtung der Öffentlichkeit. Hier war vor allem die intransparente Rolle der Agentur Storymachine Stein des Anstoßes. Ein nach Aussagen der Agentur zehnköpfiges Team hatte auf Twitter und Facebook schon vor der ersten Veröffentlichung das „Heinsberg-Protokoll“ veröffentlicht und Einblicke in die Arbeitsweise der Forschenden versprochen. Dass Storymachine in Eigeninitiative, finanziell unterstützt durch Unternehmen aus der freien Wirtschaft im Dienst war, wurde erst auf Nachfrage bekannt. Aktuell untersucht deshalb auch der Deutsche PR-Rat den Fall, ausgehend von der Vermutung, dass ethische Grundsätze verletzt worden seien.
Die Studiengruppe war also in zweierlei Hinsicht nicht gut beraten. Zum einen hat sie sich dem hohen Zeitdruck des Landes Nordrhein-Westfalen als Auftraggeber gebeugt und bei der Veröffentlichung der Zwischenergebnisse die Information der wissenschaftlichen Community übersprungen. Zum anderen hatte Streeck die Social-Media-Kommunikation Dienstleistern überlassen, die offenbar weniger an der Aufklärung über wissenschaftliche Methoden und Inhalte interessiert waren als an einer möglichst hohen Reichweite. Wissenschaftskommunikation wurde hier wie eine Marketingkampagne zum Launch eines neuen Produktes inszeniert. Aber wissenschaftliche Ergebnisse lassen sich nicht in einer Kampagne präsentieren, wie man sie etwa bei der Kommunikation für eine neue Waschmaschine planen würde. Die Agentur sah kein Problem darin, den Dialog mit der Öffentlichkeit zu starten und sogar eine Tendenz für Folgerungen aus der Studie zu kommunizieren, noch bevor diese überhaupt vorlag:
Die Ergebnisse der Heinsberg-Studie wurden unmittelbar mit der Argumentation politischer Entscheidungen verbunden – „möglichst schnell zurück in den Alltag“. Diese betrafen die Anliegen großer Teile der Öffentlichkeit und wurden deshalb interessiert aufgenommen. Weder die Medien noch ihre Rezipientinnen und Rezipienten konnten dabei zwischen Wissenschaft und Politik differenzieren, so eng zeigte sich die Kooperation nach außen. Diesen Eindruck hätte man in der Darstellung durchaus vermeiden können, um das Bonner Forschungsteam vor dem Eindruck der Vereinnahmung durch die Politik zu bewahren. Insgesamt hätte man ihnen eine im Sinne der Wissenschaftskommunikation professionelle Begleitung gewünscht. Das betont auch Julia Wandt, Vorsitzende des Bundesverbands für Hochschulkommunikation und Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Marketing der Universität Konstanz:
„Kommunikationsexpertinnen und -experten mit Wissenschaftserfahrung hätten die Wissenschaftler der Heinsberg-Studie schützen können. Sie hätten bereits im Vorfeld andere Fragen gestellt und auf andere Dinge hingewiesen als die Vertreter der PR-Agentur. Auf diese Weise hätte vor der Veröffentlichung einiges an Kritik abgefangen werden können. Dazu gehören die jetzt öffentlich diskutierten Punkte wie zum Beispiel auf welcher wissenschaftlichen Basis Öffentlichkeit und Politik informiert worden sind, wann informiert worden ist und in welchem Setting informiert worden ist. Damit hätte meiner Meinung nach auch verhindert werden können, dass das Ausmaß der Kritik an der Kommunikation das Ausmaß der Kritik an der Wissenschaftlichkeit der Studie beeinflusst.“
Bleibende Schäden
Die missglückte Kommunikation hat nicht nur den Verantwortlichen der Heinsberg-Studie geschadet, sondern konterkariert zudem die jahrelangen Bemühungen aller derjenigen, die die Forschenden vom Sinn und Zweck der Kommunikation außerhalb ihrer wissenschaftlichen Kreise zu überzeugen versuchen. Denn viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mögen sich nun in ihrer Ablehnung wieder bestätigt sehen, verunsichert sein und sich doch lieber zurückhalten, wenn es um den Dialog mit nichtwissenschaftlichen Zielgruppen geht.
Doch der Rückzug in den Elfenbeinturm ist bei einem so großen öffentlichen Interesse weder möglich, noch ist er überhaupt notwendig, solange die Grundsätze der seriösen Wissenschaftskommunikation befolgt werden, wie sie etwa in den Leitlinien für gute Wissenschafts-PR vom Bundesverband für Hochschulkommunikation und Wissenschaft im Dialog beschrieben sind.
Über diese Leitlinien hinaus hilft es, sich an einigen grundsätzlichen Regeln und Strategien zu orientieren, um eine transparente und unabhängige Kommunikation zu gewährleisten:
- Intern vor extern
Wie bei jeder Kommunikation sollte die interne Zielgruppe, die wissenschaftliche Community, informiert werden, bevor Studienergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Das monatelange Peer-Review-Verfahren ist der Königsweg – aber auch bei Forschung von großem aktuellem Interesse sollten die Daten zumindest auf einem Preprint-Server zugänglich sein. - Zeitplan selbst setzen
Gerade bei Auftragsforschung haben die Geldgebenden oftmals ein Interesse, Studienergebnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt zu veröffentlichen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind gut beraten, zumindest den Zeitrahmen einzufordern, der notwendig ist, um die wissenschaftliche Community angemessen zu informieren und die Ergebnisse so aufzubereiten, dass sie für ein nichtwissenschaftliches Publikum verständlich sind. - Zielgruppengerecht informieren
Die Aufbereitung der Ergebnisse sollte die Inhalte auch für Laiinnen und Laien verständlich machen. Geschieht das nicht, besteht die Gefahr, dass Journalistinnen und Journalisten ohne entsprechenden Hintergrund die Ergebnisse selbst übersetzen – dabei sind Fehler vorprogrammiert. Denn längst nicht alle, die berichten, verfügen über die notwendige Kompetenz im Umgang mit rein wissenschaftlichen Informationen. - Integriert kommunizieren
Die verschiedenen Kanäle (Webseite, Social Media, Presseinformation) sollten direkt aufeinander abgestimmt und wenn nicht aus einer Hand bestückt, so doch durch eine koordinierende Stelle geplant werden. Das ermöglicht es unter anderem auch, Abfolgen einzuhalten und Medien möglicherweise einen Informationsvorsprung zu gewähren. - Kommunikationshoheit bewahren
Gerade im Fall von Auftragsforschung kann es zu einer zentralen Frage werden, wer die Pressemitteilung herausgibt und ihre Inhalte bestimmt. Hier sollten die Verantwortlichen aus der Wissenschaft schon im Vertrag sicherstellen, dass sie genau wie in ihrer Forschung unabhängig bleiben können. - Distanz bewahren
Wie man seine Rolle als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler klar von jener der Verantwortlichen aus Politik oder Wirtschaft abgrenzt, zeigt aktuell Christian Drosten im Podcast „das Coronavirus-Update“. Er macht vor, wie man sich als Befragter immer wieder klar von den politischen Folgerungen distanziert. Entsprechend sind die Forschenden gut beraten, solche Entscheidungen selbst nicht zu kommunizieren. - Kommunikation trainieren
Die Kommunikation in den Medien funktioniert nach eigenen Regeln. Selbst wenn die eigene Darstellung seriös und zurückhaltend bleibt, ist man als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler nicht davor geschützt, für Skandalisierungen, Emotionalisierungen und unangebrachte Zuspitzungen instrumentalisiert zu werden. In einem Medientraining lassen sich Strategien entwickeln, dem zu begegnen und die eigene Souveränität zu bewahren. - Absender definieren
Der Absender der Kommunikation sollte klar benannt sein, die Personen, die sich öffentlich äußern, ebenfalls. Im Falle eines Konsortiums sollte vorab geklärt werden, ob eine Kommunikationsabteilung der verschiedenen Partner zuständig ist, wie die verschiedenen Häuser zusammenarbeiten und ob man ggf. eine übergeordnete Stelle einrichtet. - Professionell beraten lassen
Werden bei hoher Auslastung und großem öffentlichen Interesse externe Dienstleister hinzugezogen, so sollten diese danach ausgewählt werden, ob sie Referenzen von Auftraggebern aus der Forschung nachweisen können und die Regeln der guten Wissenschaftskommunikation kennen. Im Falle eines Konsortiums können externe Beraterinnen und Berater zudem auch eine vermittelnde Rolle einnehmen, sollte es unterschiedliche Vorstellungen zur Kommunikation geben.
Weitere Informationen und Artikel zum Thema
- „Streeck, Laschet, StoryMachine: Schnelle Daten, pünktlich geliefert“: Eine Rekonstruktion zur Veröffentlichung der Studienergebnisse von den „Riffreportern“ Christian Schwägerl und Joachim Budde, aktualisierte Fassung vom 18.4.2020.
- „Es gibt Leitlinien für gute Wissenschafts-PR“: Julia Wandt, Vorsitzende des Bundesverbandes Hochschulkommunikation und Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Marketing der Universität Konstanz, im Gespräch mit Brigitta Baetz im Deutschlandfunk, 17.4.2020.
- „Heinsberg-Protokoll – ein Mahnmal missglückter Wissenschaftsvermittlung”: Gastkommentar von Jens Rehländer, Leiter der Kommunikation der Volkswagenstiftung, in Meedia, 16.4.2020.
- „Corona-Studie: der Plan hinter dem „Heinsberg-Protokoll“: Thomas Steinmann über das interne PR-Konzept der Agentur Storymachine, in Capital, 17.4.2020
Weitere Beiträge unserer Kommentarreihe zum Fall der Heinsberg-Studie
- „Wer kommuniziert denn da?“: Ein Kommentar von Beatrice Lugger, Geschäftsführerin und Direktorin des Nationalen Inistuts für Wissenschaftskommunikation, 05.05.2020
- „Strategischer Akteur oder ausführendes Organ?“: Ein Kommentar von Markus Weißkopf, Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog, 07.05.2020
Update: Am 4. Juni sprach der Deutsche Rat für Public Relations eine Rüge gegen Storymachine aus.
Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wider.