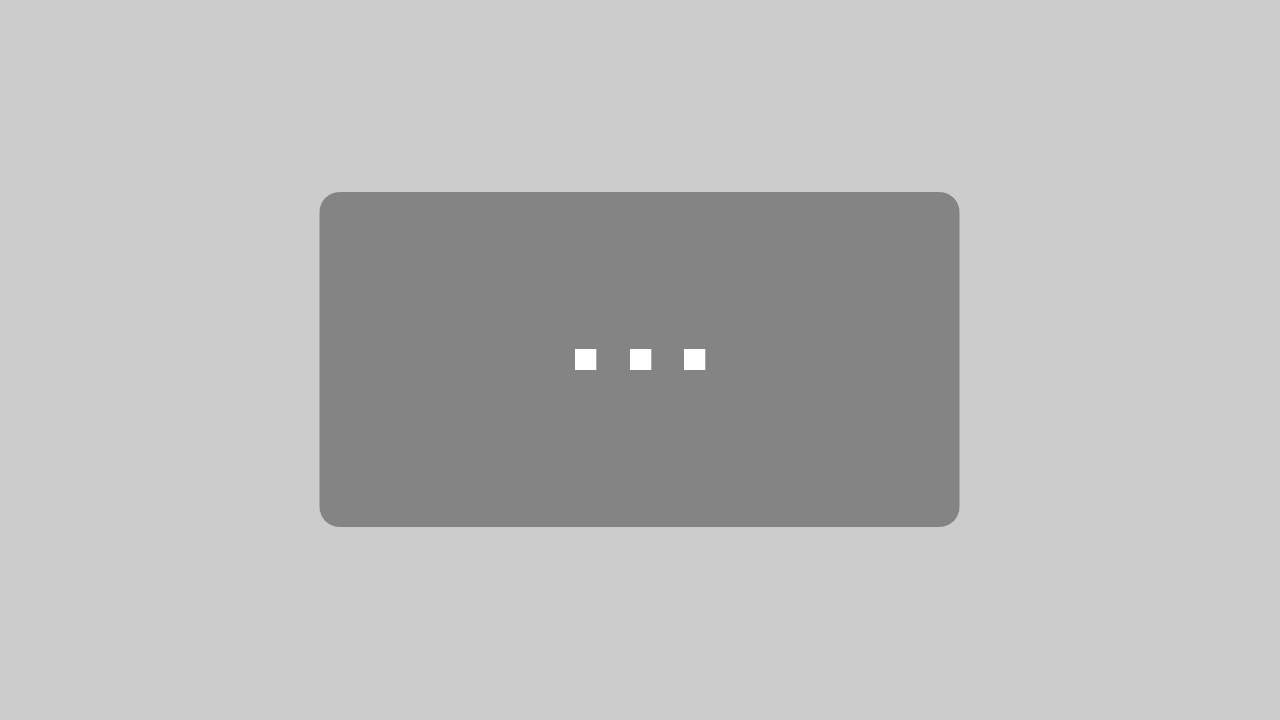In der Coronakrise gibt es eine große Nachfrage an verständlicher Information für Kinder zum Thema. Lars Dittrich, promovierter Neurobiologe und Redakteur beim Youtube-Kanal Mailab, erzählt, wie er zum Erklärbär zu Covid-19 beim Tigerenten Club wurde.
„Das Wichtigste ist, den richtigen Tonfall zu finden“
Herr Dittrich, wie kommt ein Neurobiologe dazu, bei Kindernetz.de Antworten zum Thema Corona-Pandemie zu geben?

Die Anfrage ging vom Tigerentenclub aus. Das Programm ging gerade in eine neue Staffel, für die das Studio umgebaut wurde, doch dann kam der die Covid Epidemie dazwischen. Nun konnten sie keine Kinder mehr für ihre Show einladen. Sie beschlossen, trotzdem mit den Moderatoren Action zu machen und zu improvisieren. So entstand auch die Idee des Tigerentenclub-Spezials, bei dem Corona ein Thema sein sollte. Sie fragten Mai-Thi Nguyen Kim an, die den Kanal MaiLab bei Funk betreibt. Der ist wie der Tigerenten Club der Redaktion des SWR angegliedert. Mai war zu diesem Zeitpunkt allerdings im Mutterschutz und so kam die Anfrage zu mir. Für mich war das eine tolle Gelegenheit, da ich gerne etwas für Kinder erkläre.
Sie haben ja auch eine Verbindung zu Mailab, da Sie dort mitarbeiten. Was ist Mailab und was ist Ihre Aufgabe dort?

Beim Tigerentenclub stehen Sie allerdings selbst vor der Kamera und sprechen zum Thema Covid-19. Ist es dafür eigentlich ein Problem, dass Sie kein Virologe sind?
Für die Tiefe, in die wir beim Tigerentenclub gehen, reicht mein Biologiestudium. Ich bin aber natürlich auch sehr am Thema interessiert und halte mich auf dem Laufenden. Mit einer naturwissenschaftlichen Ausbildung kann man Paper lesen und sie teilweise auch einordnen, selbst wenn man nicht in dem Bereich forscht. Also beispielsweise verstehen, was in der beschriebenen Studie untersucht wurde und was die Ergebnisse bedeuten. Aus diesen Informationen das Wichtigste für Kinder verständlich zusammenzufassen, macht mir Spaß.
Handelt es sich beim Tigerentenclub um eine Live-Schalte und kennen Sie die Themen im Vorfeld?
Am Anfang habe ich Videoclips zu Themen oder Themenbereichen vorbereitet, von denen ich dachte, dass sie interessant sein könnten. Beispielsweise zur Frage, warum die Schulen eigentlich zu sind. Dann haben wir es mit einer Live-Schalte versucht, was die Redakteure schöner fanden. Es werden tatsächlich Kinderfragen beantwortet, die die Redaktion sammelt und mir zuschickt. So kann ich mich vorbereiten und weiß, was am nächsten Tag drankommt. Sind Fragen dabei, die ich nicht seriös beantworten kann, lassen wir sie raus.
Welche Dinge muss man bei der Kommunikation eines so komplexen Themas beachten, wenn Kinder es verstehen sollen?
Bei Covid-19 gilt es natürlich zunächst für Kinder wie für Erwachsene zu verdeutlichen, dass es gefährlich ist. Wir wollen aber auch klarmachen, dass es für die meisten Individuen keine direkte Todesgefahr darstellt. Kinder haben sehr selten einen schweren Verlauf. Daher wollen wir ihnen die Angst vor einer „Horrorkrankheit“, die da draußen umgeht, nehmen. Wir wollen sie aber andererseits auch nicht mehr beruhigen, als es in dieser Situation gerechtfertigt ist. Das Wichtigste ist, den richtigen Tonfall zu finden.
Sie reden auch mal vom Genom oder nutzen andere nicht sehr geläufige Begriffe. Warum?
Da muss man natürlich vorsichtig sein. Es ist eine gute Faustregel, Fremdworte wegzulassen, wann immer es geht, und so zu sprechen, dass man keine Fachbegriffe vermisst. Ich denke aber auch an die Kinder, die unendlich viele lateinische Dinosauriernamen auswendig lernen. Wenn sie das können, dann schreckt man sie mit ein paar schwierigen Wörtern nicht automatisch ab. Sie lernen schließlich jeden Tag neue Begriffe und daher ist es eher die Frage, wie man diese einbringt. Wenn ich nun sage, dass die Information in einem Virus nicht auf Papier geschrieben ist, sondern auf RNA, dann überfordere ich kein Kind, sondern nutze einfach nur ein neues Wort. Ich versuche es natürlich richtig zu dosieren.
Welche Altersgruppe sprechen Sie in Ihren Beiträgen an?
Dieses Fernsehformat sehen kleinere Kinder bis hin zu 17-jährigen. Bei der Vorbereitung stelle ich mir aber am ehesten ein zehnjähriges Kind vor. Wenn ich ein solches Video für einen Erwachsenen machen würde, wäre meine Herangehensweise allerdings nicht zwangsläufig anders. Denn einfache Erklärungen und hilfreiche Metaphern, die nicht zu arg verfälschen, sowie eine einfache Sprache funktionieren genauso gut bei Erwachsenen. Zu denken, man dürfe es für Erwachsene nicht anschaulich oder lustig machen, ist falsch. Bei einem Kind würde ich allerdings keinen Graphen zeigen. Auch wenn die Interpretation solcher Kurven für manche Menschen selbstverständlich ist, so können Jüngere – und auch viele Erwachsene – sie nicht so leicht verstehen.
Auch über Twitter beteiligen Sie sich rege an vielen Diskussionen über Wissenschaft und Forschung. Was motiviert Sie dazu?
Twitter ist für mich ein Selbstläufer, weil ich auf die Art anspreche, wie soziale Medien funktionieren. Es macht Spaß und man erlebt einen Belohnungseffekt, wenn man mitmacht. Ich denke nicht aktiv darüber nach, über Twitter kommunizieren zu müssen, sondern nutze das Medium in meiner Freizeit. Am ehesten ziehen mich die Diskussionen an, bei denen es um wissenschaftliches Denken geht und um die Frage, ob ein Beleg für etwas erbracht ist oder nicht. Twitter und auch andere soziale Medien eigenen sich sehr gut für Forschende, um mit Fachfremden zu sprechen und mitzubekommen, wie die ticken. So können sie herausfinden, an welchen Stellen ein Verständnisproblem vorliegt und wann das Gegenüber einfach nur eine andere Meinung hat. Andersherum ist es für Laiinnen und Laien eine tolle Möglichkeit, um mit Forschenden zu sprechen und einen Einblick in ihre aktuelle Arbeit zu erhalten.
Wollen Sie Forschende motivieren, mehr zu kommunizieren und sich an der Diskussion zu beteiligen?
Auf jeden Fall! Wenn jemand Twitter nicht mag, darf man mich aber nicht so verstehen, als würde ich alle Forschenden dazu auffordern, die Zähne zusammenzubeißen und einfach trotzdem zu twittern. Ich rate immer dazu, sich eine Plattform zu suchen, die einem so viel Spaß macht, dass man sie von alleine und auch in der Freizeit gerne nutzt. Es ist also egal, ob das Medium der Wahl ein Blog ist, man Videos bei Youtube hochlädt oder ob man lieber Instagram, Twitter oder Facebook nutzt.
Warum sollten Forschende aus Ihrer Sicht überhaupt kommunizieren?
Ich finde es sehr wichtig, dass sich echte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Öffentlichkeit zu Wort melden und nicht nur über den Umweg des Wissenschaftsjournalismus gehört werden. In der aktuellen Coronakrise ist der Podcast mit Christian Drosten ein gutes Beispiel dafür. Hier spricht ein echter Wissenschafler über das Thema, und zwar so, wie man sich das vorstellt. Er sagt, in welchen Bereichen er nicht Experte ist und wann er nur seine Meinung als Privatperson nennt. Er grenzt das immer sehr schön ab. Außerdem gefällt mir die Kombination mit Wissenschaftsjournalistinnen gut, die durch die Themenauswahl, ihre Nachfragen und auch Umformulierungen helfen, es verständlich und attraktiv zu halten. Genau so etwas könnte man mit vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern machen. Ich hoffe ja, dass jetzt viele im Journalismus „den neuen Drosten-Podcast“ machen wollen und sich auch eine Forscherin oder einen Forscher suchen, um so über ein Thema zu sprechen. Natürlich gibt es nicht immer gerade eine Coronakrise, zu der man auch noch den passenden Experten hat. Deswegen wird es nicht immer so ein Blockbuster werden. Aber spannend wäre das auf jeden Fall.
Was ist Ihr wichtigster Tipp für Forschende, die sich an der Diskussion beteiligen wollen, aber kaum Zeit dafür finden?
Im Videoausschnitt des Interviews mit Lars Dittrich, fasst er seine Tipps zur Kommunikation für Forschende zusammen.