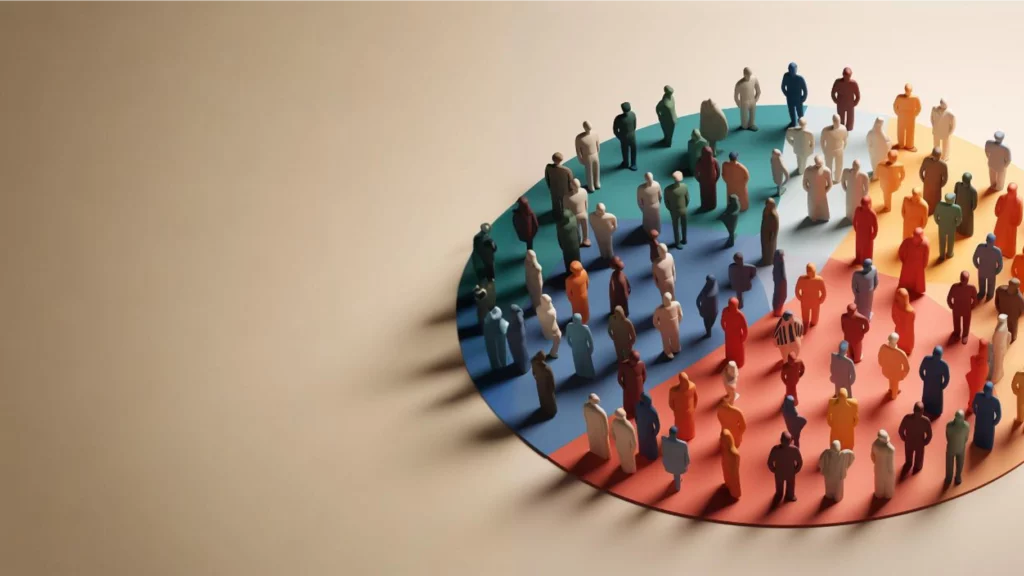Hans-Christian Pape ist seit Januar 2018 Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Gleich in seiner Antrittsrede forderte er mehr gesellschaftliches Engagement der Forschung und Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Warum das zu seinen obersten Zielen gehört, erklärt er im Interview.
„Wir müssen die Bedeutung des Systems Wissenschaft für unsere Gesellschaft verdeutlichen“
Herr Pape, welche Rolle spielt die Kommunikation mit der Öffentlichkeit im Wissenschaftssystem der Zukunft?
Eine immense. Eine der größten Herausforderung ist es, auf das zunehmende Misstrauen gegenüber der Wissenschaft zu reagieren. Dieses Misstrauen hat meines Erachtens verschiedene Ursachen. Zum einen ist Wissenschaft eine Konsequenz von Expertise. Dabei entwickeln sich die Experten (die Wissenschaft) und die Nichtexperten (die Gesellschaft) immer weiter auseinander. Dieses zunehmende Ungleichgewicht generiert Fragen zu Sinn und Bedeutung dieser Expertise – ein Problem der Komplexität und Modernität, dem sich übrigens nicht nur die Wissenschaft zu stellen hat.

Dieses im Grunde sinnvolle Hinterfragen kann in Misstrauen entgleiten, vor allem dann, wenn Beispiele von Fehlverhalten, Fälschung oder Missbrauch zu verzeichnen sind. Dabei steigen die Ansprüche an Transparenz, Dialog und Geschwindigkeit. Was aber noch bedeutender ist: Jeder kann technisch filtern, was er lesen, sehen und hören will, also was ihn überhaupt erreicht. Man muss sich nicht mehr mit anderen Ansichten auseinandersetzen, man kann sie wegfiltern. Umso irritierender ist es dann, auf Unerwartetes, Neues oder Unsicheres zu stoßen. Wissenschaft bringt aber genau das mit sich. Sie verlangt ein differenziertes Abwägen eines Für und Wider. Wenn hierfür kein Raum ist oder keine Bereitschaft, leiden Diskussionen – etwa über den Sinn und die Risiken von Impfungen, den Klimawandel oder die Evolution.
Deshalb müssen wir als Wissenschaftler und Wissenschaftsorganisationen die Kommunikation mit der Öffentlichkeit stärker als unsere Aufgabe annehmen und als Wissenschaft Antworten geben, wie wir beispielsweise in die digitalen Echokammern hineinwirken und zu Skeptikern vordringen, die sich dort eingerichtet haben. Hierfür reicht es nicht, Wissenschaft in Einzelbeispielen mit Personen und Befunden darzustellen. Vielmehr müssen wir die Bedeutung des Systems Wissenschaft für unsere Gesellschaft verdeutlichen. Was würde uns fehlen im täglichen Leben, in unserer Kultur oder auch in unserer Entwicklung, wenn wir die Wissenschaft rausnehmen? Die Wissenschaft und die Medien arbeiten an Vermittlungskonzepten. Wir als Humboldt-Stiftung unterstützen dies. Und wir treiben das Thema gemeinsam mit unseren Partnern in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen voran.
In Ihrer Antrittsrede haben Sie die Alexander-von-Humboldt-Stiftung als Vorbild für die Verbindung von Internationalität, Wissenschaft und Gesellschaft bezeichnet. Wie genau sollen diese Ziele erreicht werden?
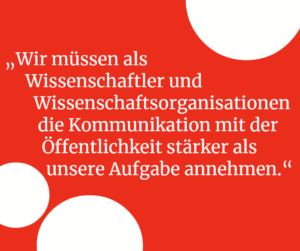 Ich bleibe beim Problem der Echokammern: Wenn mehr und mehr die Gleichgesinnten nur mit ihresgleichen kommunizieren, droht eine Gesellschaft in Gruppen zu zerfallen, und derart isolierte Gruppen tendieren zu extremen Anschauungen. Wissenschaft und ihre Erkenntnisse dagegen erfordern und fördern Diversität und Offenheit. Das macht sie so wichtig für die Demokratie. Weil Wissenschaft international ist, fördert sie zugleich Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt. Dies wird vielleicht nirgendwo deutlicher als in unserem weltumspannenden Netzwerk der Humboldt-Stiftung von 28.000 geförderten Wissenschaftlern in mehr als 140 Ländern. Wissenschaft wird hier zur Lingua franca eines vertrauensvollen und offenen Austauschs über die Grenzen von Staaten, religiösen oder politischen Anschauungen hinweg.
Ich bleibe beim Problem der Echokammern: Wenn mehr und mehr die Gleichgesinnten nur mit ihresgleichen kommunizieren, droht eine Gesellschaft in Gruppen zu zerfallen, und derart isolierte Gruppen tendieren zu extremen Anschauungen. Wissenschaft und ihre Erkenntnisse dagegen erfordern und fördern Diversität und Offenheit. Das macht sie so wichtig für die Demokratie. Weil Wissenschaft international ist, fördert sie zugleich Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt. Dies wird vielleicht nirgendwo deutlicher als in unserem weltumspannenden Netzwerk der Humboldt-Stiftung von 28.000 geförderten Wissenschaftlern in mehr als 140 Ländern. Wissenschaft wird hier zur Lingua franca eines vertrauensvollen und offenen Austauschs über die Grenzen von Staaten, religiösen oder politischen Anschauungen hinweg.  Ob Sie es Völkerverständigung nennen, Wissenschaftsdiplomatie oder Außenwissenschaftspolitik: Wissenschaft hat hier auch einen großen Kollateralnutzen für die Politik. Daneben erleben wir in der Humboldt-Stiftung immer wieder Wissenschaftler unter unseren Geförderten, die auch direkt politische Verantwortung übernehmen. So wie der aktuelle Botschafter Georgiens in Deutschland Lado Chanturia, Yesid Reyes Alvarado, bis vor kurzem Justizminister in Kolumbien, oder jüngst Jiří Drahoš, physikalischer Chemiker und Präsidentschaftskandiat in Tschechien. Sie alle sind Forscher aus dem Netzwerk der Humboldt-Stiftung. Wie übrigens auch die beiden letzten Energieminister der USA. Leider umgibt sich der aktuelle amerikanische Präsident bevorzugt mit Börsenmillionären oder Militärs. Dabei würde auch seine Regierung von wissenschaftlichem Expertenverstand in hohen Positionen profitieren. Wie eigentlich jede andere auch.
Ob Sie es Völkerverständigung nennen, Wissenschaftsdiplomatie oder Außenwissenschaftspolitik: Wissenschaft hat hier auch einen großen Kollateralnutzen für die Politik. Daneben erleben wir in der Humboldt-Stiftung immer wieder Wissenschaftler unter unseren Geförderten, die auch direkt politische Verantwortung übernehmen. So wie der aktuelle Botschafter Georgiens in Deutschland Lado Chanturia, Yesid Reyes Alvarado, bis vor kurzem Justizminister in Kolumbien, oder jüngst Jiří Drahoš, physikalischer Chemiker und Präsidentschaftskandiat in Tschechien. Sie alle sind Forscher aus dem Netzwerk der Humboldt-Stiftung. Wie übrigens auch die beiden letzten Energieminister der USA. Leider umgibt sich der aktuelle amerikanische Präsident bevorzugt mit Börsenmillionären oder Militärs. Dabei würde auch seine Regierung von wissenschaftlichem Expertenverstand in hohen Positionen profitieren. Wie eigentlich jede andere auch.
Was macht generell gute Vorbilder im Bereich der Kommunikation von Wissenschaft mit der Gesellschaft aus?
 Wissenschaft ist in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft für die Bereitstellung des jeweils besten verfügbaren Wissens verantwortlich. Sie darf allerdings nicht so tun, als hätte sie endgültige Lösungen parat. Gute Wissenschaftler kommunizieren transparent und benennen offen auch Ungewissheiten. Sie hüten sich vor jeder Art Verheißung oder Heilsversprechung gegenüber der Gesellschaft – denn das verleitet zu Selbstüberforderung auf der einen und Hoffnungsüberforderung auf der anderen Seite. Im Dialog mit ihren Kritikern sollte sich die Wissenschaft zudem bewusst sein, dass sie selbst einen Reputations- und Vertrauensverlust verschuldet hat. Vom Publikationsdruck und daraus folgender Überhitzung unseres Begutachtungssystems über das voreilige Veröffentlichen vermeintlicher Erkenntnisse, die später revidiert werden müssen, bis hin zu Fälschungen und anderem wissenschaftlichen Fehlverhalten. Solche Entwicklungen haben bei vielen Menschen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft gesät. Deshalb ist auch Einsicht und Selbstkritik nötig. Vertrauen ist schnell verspielt und nur mühsam rekonstruiert Wir müssen unsere Kritiker ernst nehmen und auf sie eingehen: Nicht jeder Skeptiker ist unbelehrbar. Und nicht jede Skepsis ist unbegründet.
Wissenschaft ist in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft für die Bereitstellung des jeweils besten verfügbaren Wissens verantwortlich. Sie darf allerdings nicht so tun, als hätte sie endgültige Lösungen parat. Gute Wissenschaftler kommunizieren transparent und benennen offen auch Ungewissheiten. Sie hüten sich vor jeder Art Verheißung oder Heilsversprechung gegenüber der Gesellschaft – denn das verleitet zu Selbstüberforderung auf der einen und Hoffnungsüberforderung auf der anderen Seite. Im Dialog mit ihren Kritikern sollte sich die Wissenschaft zudem bewusst sein, dass sie selbst einen Reputations- und Vertrauensverlust verschuldet hat. Vom Publikationsdruck und daraus folgender Überhitzung unseres Begutachtungssystems über das voreilige Veröffentlichen vermeintlicher Erkenntnisse, die später revidiert werden müssen, bis hin zu Fälschungen und anderem wissenschaftlichen Fehlverhalten. Solche Entwicklungen haben bei vielen Menschen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft gesät. Deshalb ist auch Einsicht und Selbstkritik nötig. Vertrauen ist schnell verspielt und nur mühsam rekonstruiert Wir müssen unsere Kritiker ernst nehmen und auf sie eingehen: Nicht jeder Skeptiker ist unbelehrbar. Und nicht jede Skepsis ist unbegründet.
Sie möchten das „wissenschaftliche Immunsystem stärken“, sagen Sie in ihrer Rede, und mahnen zur Selbstkritik. Was muss genau passieren, damit die Wissenschaft wieder an Glaubwürdigkeit gewinnt?
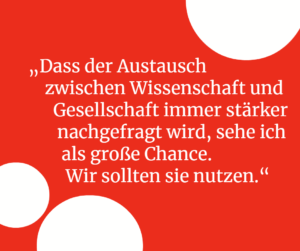
Zunächst sollten wir besser mit Fälschungsvorwürfen umgehen. Wir müssen in jedem Fall sichergehen und jedem noch so kleinen Zweifel nachgehen, etwa indem wir Studien und Versuche wiederholen oder die Ergebnisse durch unabhängige Versuchsreihen überprüfen. Whistleblower müssen wir schützen. Zugleich kann der Konkurrenzendruck unter Wissenschaftlern für Denunziantentum sorgen. Mit dem Vorwurf wissenschaftlichen Fehlverhaltens kann eine wissenschaftliche Karriere beendet sein. Fast immer bleibt irgendetwas hängen. Wir müssen deshalb Vorwürfe schneller klären und Personen rehabilitieren, die zu Unrecht beschuldigt wurden. Auch neue Wege sollten uns interessieren, etwa offene Publikationsorgane oder Crowdreviewing. Hier ist zurzeit viel in Bewegung.
Und wie kann die Gesellschaft hier einbezogen werden, die an das System glauben soll?